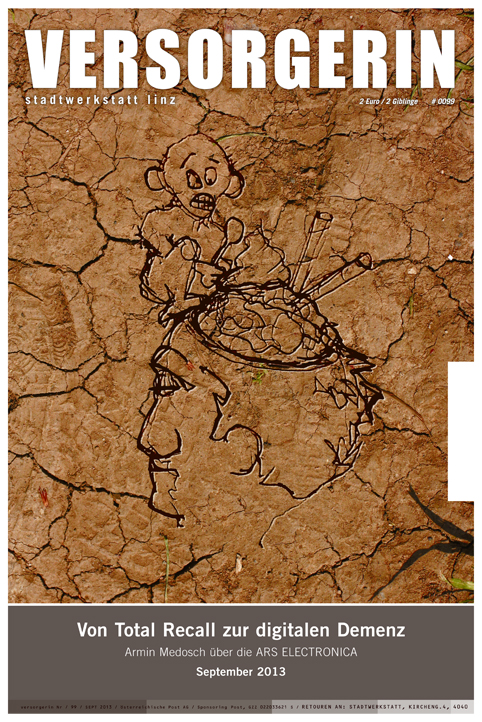Die in Wien lebende Irene Kepl (Violine, Komposition) und die aus Hamburg angereiste Nora Elberfeld (Tanz, Choreografie) sind im Juli auf der Eleonore angetreten, um für zwölf Tage Residency folgendes Konzept zu thematisieren: »Wir beschäftigen uns mit Mustern, die durch gemeinsame Nutzung von Raum entstehen, gegen eine einseitige Dominanz von Klang oder Bewegung. So wie das Wasser ein Boot durch eine permanente Hin- und Herbewegung in Schwingung versetzt, definiert sich akustische und körperliche Schwingung durch Wiederholung in minimaler Abwandlung. Es gibt kein Zentrum, sondern nur Bewegung um den Balancepunkt herum. Mit diesem Bild wollen wir Muster erforschen – durch Wiederholung, Abwandlung und Veränderung«.
Neue Musik, Geige, zeitgenössischer Tanz, wahrnehmungsgeschulte Körper – damit und mit dem beschriebenen Ansatz wurde »Hin&Her« in folgender Weise angegangen: Mit kleinen Bewegungs- und Geräuschsequenzen, die wiederholt wurden, näherte man sich einem Punkt, aus dem sich Bewegung und Musik aus sich selbst heraus verändern musste (»Repetition, bis es nicht weitergeht … und man geht weiter, man wiederholt das veränderte Schema … und man geht weiter«). Mit dem Verbot, Musik und Tanz als simple gegenseitige Interpretation zu verstehen, begann man damit, sich gegenseitig Bewegungs- und Soundmuster zu übergeben, und über diesen Verlauf des zeitlichen Hin-und Herreichens eine Transformation zu erzielen (»es geht um Autonomie und Entwicklung miteinander«). Und nicht zuletzt bedeutet Bewegung auf einem Schiff immer auch Begrenzung – eine Beschränkung, die hilft, so die Künstlerinnen. So endete eine örtliche »hin«-Bewegung an einem Punkt, wo zwingend nur mehr ein »her« woandershin erfolgen konnte. So arbeitete man sich, ausgehend vom Deck an die Barrieren, auf die kleineren Ebenen, in die Kleinteiligkeit des Schiffs und seine unmittelbare Peripherie. Gearbeitet wurde in abstrakt-reduzierter Ästhetik von Neuer Musik und Zeitgenössischem Tanz, quasi als performative Praxis mit ganz viel spartenübergreifend orientierter Kunst drinnen.
Der Ort ist stark, man muss ihm mit Konsequenz begegnen, so die beiden Künstlerinnen. Die Kulisse ist spektakulär, auch wenn sie das Gegenteil von spektakelhaft ist. Viele Spannungsfelder, die sich beinahe theatral zwischen Natur und Industrie auftun, die aber auch mit einem intimen Ort inmitten von Öffentlichkeit zu tun haben, stehen im Gegensatz zu einer Ruhe, die mit der Lage am Wasser, an der Peripherie der Stadt zu tun hat. Das bedeutet aber auch gleichzeitige Anwesenheit von vielen Dingen: »Es ist eine Insel inmitten der Zivilisation«, so Nora Elberfeld, »trotzdem ist es kein hermetischer Ort, es passiert viel«. Irene Kepl dazu: »Es geht nicht darum, die optischen und akustischen Unterbrechungen, die in unsere Arbeit hineinspielen, in Frage zu stellen, sondern es geht um die Erfahrung, mit diesen Brüchen und Störungen zu arbeiten«. So gesehen wurden Bewegungen und Geräusche der Umgebung (Sirenen, vorbeifahrende Boote, Segelflieger, Autos, BesucherInnen, Wasservögel, Plätschern, Kommunikationsfetzen, etc) zu einem weiteren Anreiz, den eine der beiden dialogisch mittels Geige oder Tanz aufgenommen hat, um ihn der anderen auf abstrakter Ebene zur Weiterbearbeitung anzubieten – ein weiterer Aspekt von »hin und her« von Eindrücken zwischen vordefinierter künstlerischer Absicht und »draußen«.
Noch etwas zum starken Ort: Interessant ist die Aussage, dass am Schiff zuerst »die äußeren Sensationen des Ortes abgearbeitet werden mussten«, um sie auf eine selbstverständlichere Weise in die künstlerische Arbeit zu integrieren. Geräusche oder optische Eindrücke wurden miteinander in Beziehung gesetzt, indem sie sukzessive zitathaft in die künstlerische Arbeit eingearbeitet und weiter reduziert wurden. Weder in der Musik, noch im Tanz ging es darum, fixe Architekturen von Zeit oder Raum zu bauen (Kompositionen oder Choreographien), sondern es wurde mit Statik und Veränderungsimpuls gearbeitet: In der momenthaften Dynamik der Repetition und der Verdrängung vollzog sich Entwicklung. Hinsichtlich Grundsituation und Prozesshaftigkeit wurde zum Beispiel von Nora Elberfeld festgestellt, dass man am Schiff mit all seiner Inspiration, aber auch Begrenzung, zuallererst einmal zurückgeworfen ist auf eine Art Kernintention des eigenen künstlerischen Schaffens – zum Beispiel auf Tanz anstatt Choreographie, auf Intention vor Ausgestaltung. In positiver Weise herausfordernd lässt sich so schwerer auf eingeübte Praktiken zurückgreifen. Besonders am Ende lag die Aufmerksamkeit vor allem wieder auf dem am offensichtlichsten vorhandenen Element, auf dem Wasser: So wie die Wasseroberfläche im Hafenbecken durch stetige Hin- und Herbewegung in sich, als auch durch statisches Vorhandensein von Wassermasse verstanden werden kann, wollte man auch den Arbeitsansatz verstanden wissen: zwischen bewusster Setzung von in sich schwingenden Sequenzen, und einem größeren Platz machen von »Ereignissen« von außen, zwischen unabhängigem Vorhandensein von Geigenspiel und Tanz, und einem Hineinrücken in die künstlerische Sphäre der Anderen. Jedenfalls ging es, mit dem Bild des Wassers gesprochen, vielmehr um ein kommunikatives Fließen ineinander und auseinander – jedenfalls aber nicht darum, etwas »Aufstrebendes« als kompositorische oder choreographische Architektur von Zeit und Raum zu formulieren. In einem durchaus netten Verhältnis zur Nicht-Architektur von Zeit steht übrigens Irene Kepls Bemerkung, dass »sich in der Freiheit, hier Zeit geschenkt zu bekommen, eine selbstgewählte, totale Routine im Tages- und Arbeitsablauf eingestellt hat«. Und: Dass einem tagsüber die Hitze zusetzt, während man nachsieht, ob das Wasser noch reichen wird, und einem abends die kühle Abendluft umweht, während der Industriebetrieb rundum eindrücklich ruht, ringt einem mitunter plötzliche Aha-Erlebnisse über die Ökonomie des eigenen Arbeitseinsatzes ab: Man macht hier nur mehr das Notwendigste – nämlich das, was Sinn macht.
Generell setzt das Arbeiten mit Schiff, Umraum, (Un-)Ruhe und Kulisse andere Prioritäten als das Arbeiten in einer neutralen Black Box. Performative Praxis braucht auf der Eleonore keine Setzung eines ungewöhnlichen Rahmens: Eine als performative Kulisse umdefinierte Umgebung, die sich zwar langsam, aber in ihrer Eindrücklichkeit permanent umgestaltet, dirigiert in gewisser Weise ein Geschehen. Weiters empfanden sich Nora Elberfeld und Irene Kepl selbst als exponierter Teil des Geschehens, weil sie nicht unbeobachtet und unabhängig vom Ort herausgelöst agierten. Sie bespielten das ganze Schiff und konnten vor allem an Deck gesehen werden. Bei der Residency »Hin&Her« wurde demzufolge im Bewusstsein nach den vielgestaltigen Möglichkeiten des in-Beziehung-Tretens geforscht, mit der Kollegin, aber auch mit jedem anderen Aspekt der Umgebung. Eine site-spezifische Praxis, die sich derart mit den Gegebenheiten und Brüchen einer Umgebung auseinandersetzt, während man selbst Teil des Geschehens ist, lässt kaum neutrale Performance-Ergebnisse zu, so die Künstlerinnen einhellig, oder coole Statements über die eigene, fantastisch-abgetrennte Arbeitskonstruktion – vielmehr arbeitet man hier an den Grundlagen, als intimer Teil des Geschehens, man kommuniziert und überprüft.
Ergebnisse der Residency waren mehrere Zwischen-Sichtungen, bei denen Publikum eingeladen war. Weiters wurde Blog, Foto- und Videomaterial angefertigt, die den Prozess des künstlerischen Researches festgehalten haben. Außerdem werden die beiden die Ergebnisse ihrer Arbeit in ein Projekt einfließen lassen, das nächstes Jahr in Hamburg produziert wird.
Hin&Her: Keine Architektur von Zeit
Ungewöhnliche Kulisse, intimes Spektakel, Sensationen abarbeiten: Mit Geige und zeitgenössischem Tanz haben Irene Kepl und Nora Elberfeld auf dem Messschiff Eleonore ihre Residency mit dem Titel »Hin&Her« stattfinden lassen.
Artists-Blog zu dieser Residency: donautics.stwst.at/lab/story/hinher-logbuch-überbord
Übersicht über alle Residencies dieser Reihe: donautics.stwst.at/floating-bodies-labs
Tanja Brandmayr ist Künstlerin, Autorin und arbeitet seit vielen Jahren und in unterschiedlichen Zusammenhängen mit Text, Medien und erweiterten Kunstformaten. Leitung und Programmierung Stadtwerkstatt. (Co)Betreibt die Zeitungen Referentin und Versorgerin.
https://stwst.at/, https://versorgerin.stwst.at/, https://diereferentin.servus.at/, https://quasikunst.stwst.at,
http://brandjung.servus.at/