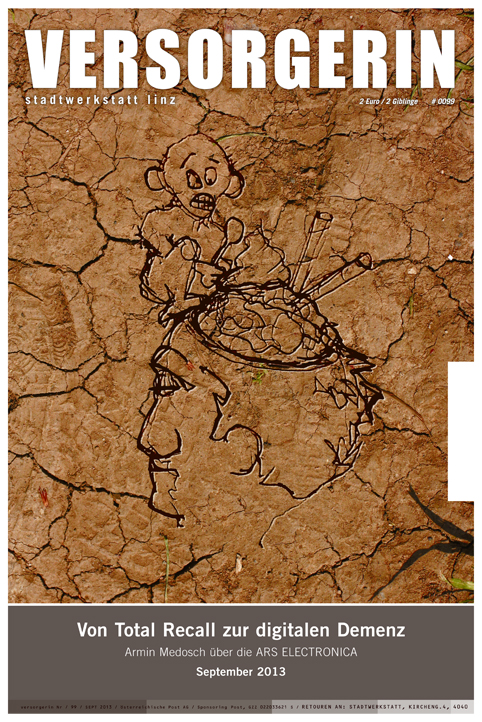»Zuerst einmal am Bushalteplatz stehen, ringsum blödsinniges Autogehupe, jaja, es macht ihnen Spaß, ist südländisch, ramponiert./Hinter dem Baugelände, an dessen Seite stumpf Busse abgestellt waren, kam das mechanische Gebrüll (als hätten sie den Wahnsinn im Kopf, und der sagte ihnen, daß sich durch Hupen der Autostau auflösen würde?)/Viele kleine ödelnde Stinker von Fiats mit den bleichen Morgenleuten, dazwischen in stockenden jähen Sätzen und Sprüngen und darauf wieder betäubtem Schlendern die Einzelnen./Und immer neu das Autogehupe, zehn Minuten lang, eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang. Nur Autohupen, zwei und drei auf einmal, dann in ganzen Rudeln.« (Rolf Dieter Brinkmann: Rom, Blicke, Hamburg 1979, 179.)
Wenn die Fotografin streunt, die Kamera stets griffbereit, sieht sie die Stadt mit anderen Augen, mit einem Auge bei Lichte betrachtet, mit dem Auge nämlich, mit dem sie durch den Apparat lugt. Das Objektiv hat sie nicht nur auf die Kamera, sondern auch auf das Subjekt geschraubt. Der Blick sucht nach Motiven, vielversprechenden Ereignisherden, reizvollen Schattenspielen, architektonischen Verschiebungen, Originalen. Die Perspektiven sind dabei virtuell gerastert, die Fotografin tastet die Gemäuer, Häuserfluchten und Plätze mit dem Maß von Bildformaten ab. Die Stadt ist im Fokus. Die Fortbewegung im urbanen Strom wird von Bau- und Menschenmassen geleitet: flotieren, treiben lassen, bis wieder ein Sujet auftaucht: auflaufen, stranden, lichten. Die Fotografin passiert und wird passiert: Vehikel aller Art, eilende EinwohnerInnen, faulenzende Katzen, Schaufensterpuppen, Lichtquellen, Reflexionen, im aufsteigenden Rauch, im sich senkenden Smog. Die Wahrnehmung ist offen - Weitwinkel.
Ich bin keine Fotografin. Ich arbeite beim Radio. Ich streune nicht mit der Kamera in den Straßen, sondern mit dem Audiorecorder. Wenn ein Gerät zwischen mir und der Stadt vermittelt, dann hört es auf den Namen »Zoom H2N«. Mit ihm als Begleiter höre ich anders: differenzierter, sorgfältiger, mehr. Der Flügelschlag der Tauben wird plastisch. Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof bekommen Mehrwert - das gibt eine schöne »Atmo« für ein Feature ab. Gesprächsfetzen, Hufschlag auf Kopfsteinplaster, das Piepsen eines Automaten, das Klirren von Gläsern in einer Bar, ein Flugzeugstart; wer weiß, vielleicht kann ich das Schaben der Baggerschaufel für mein Hörspiel brauchen.
Ein Medium, egal welches, steht immerzu und per se zwischen zwei Polen, es ist zwischen Ich und Welt geschaltet. Das Aufnahmegerät eröffnet mir nicht nur Wirklichkeit, sondern entfernt mich auch von ihr. Ich halte keine Linse vor mein Sichtfeld, aber verbarrikadiere mir mit Kopfhörern die Gehörgange. Und selbst wenn ich darauf verzichte und quasi auf gut Glück die Aufnahmetaste betätige - wie die Fotografin ein Foto aus der Hüfte schießt - : Ich nehme mir von der Stadt, was ich brauchen kann. Die Stadt wird zu einem Ordner voller WAV-Files. Ich bin ein Schallpirat, ein akustischer Plünderer. Immer auf der Suche nach Stereo-Gold, nach brauchbaren Klängen. Mein Hören ist kein interesseloses, es ist ein Belauschen, ein Abhören, es will entdecken, ausgraben, festhalten und mitnehmen. Obwohl ich ganz Ohr bin, wird ästhetische Erfahrung im Vollsinn wenn nicht verhindert, dann zumindest erschwert. Mit dem Recorder in der Hand wird nämlich allzu leicht aus gelassenem Erleben ein Jagen und Sammeln, ein Ausstopfen und Präsentieren.
Durch Rom spazieren, das ist nicht nur eine optische Safari. Das bald 2000 Jahre alte Pantheon mit seinen dreizehn Meter hohen Säulen sieht zweifelsohne imposant aus und gibt hervorragendes Material für jeden Diavortrag ab. Auf die Akustik unter der Kuppel weist kein Stadtführer hin, geschweige denn auf das babylonische Geraune der Schaulustigen, auf dieses wogende Gewebe, das im Bauch der Rotunde jeden Moment aufs Neue aus den Klängen hunderter tuschelnder, kichernder, Referate haltender Kehlen geflochten wird und unter dem Oculus (!) widerhallt, zerschellt, widerhallt. Und der Trevi-Brunnen begeistert ebenfalls durch seine Dimension, und durch seinen monumentalen Leichtsinn, durch meisterhaft geformte und trefflich arrangierte Skulpturen, sowie durch ein nahezu surreales Setting. Aber darüber hinaus blubbert er ganz einfach ganz fantastisch und sprudelt und klatscht und quakt sogar gelegentlich. Und der römische Verkehr ist - für die anderen Ohren -
ein Hupkonzert im Vollsinn, eine groß angelegte Noise-Komposition mit unzähligen AutorInnen, die nicht wissen, was sie tun. Aber Spektakel bleibt Spektakel - ist stets auch Übermaß, Belastung und akustische Umweltverschmutzung bis zur Gesundheitsgefährdung. Vor allem,
wenn man einen Monat lang einen Steinwurf entfernt von der Piazza Navona wohnt.
Ich hatte keinen besseren Freund als den Regen. Er unterbrach die Bauarbeiten im Hof, dumpfes Hämmern, schrilles Sägen, das Herab-rasseln von Schutt und alten Batterien; er spülte die knatternden Motorräder aus den Gassen, spülte sie aus den Gassen oder stellte sie vor dem Kiosk ruhig; er platzte in das Geschnatter der Touristenhorden und zwang die BildungsbürgerInnen, die Fashion Victims, die gröhlenden Studierenden, die US-Amerikaner, die Südkoreaner und die Deutschen ins Innere der Restaurants oder gleich zurück in ihre Unterkünfte; und vor allem vertrieb er die StraßenmusikerInnen, die unter meinem Fenster jeden Tag die selben drei Lieder (»Volare«, »My way« und ... »Volare«) mit aufgesetzter Inbrunst in die heiße Luft bliesen. Selbst wenn ich am Vorabend die Finger von Vino Rosso und Nastro Azzurro gelassen hatte, erwachte ich stets schweißnass in einem hellhörigen Haus mit hohen weißen Räumen - und mein Kopf war schwer, angeräumt mit lautstarken Träumen. Wenn es stark genug regnete, wurde es endlich still. Es war Juli, es war Rom. Regen war ein seltener Gast.
Ich gehe noch einmal zum Fenster, ziehe ein letztes Mal an der Zigarette und werfe den Stummel in ein Glas, in dem sich Regenwasser gesammelt hat. Es zischt, doch was ist dieses »es«, das zischt, von dem die Sprache behauptet, es existiere?
Rom, Töne
Über andere Ohren, eine andere Stadt und andere Ohren in einer anderen Stadt