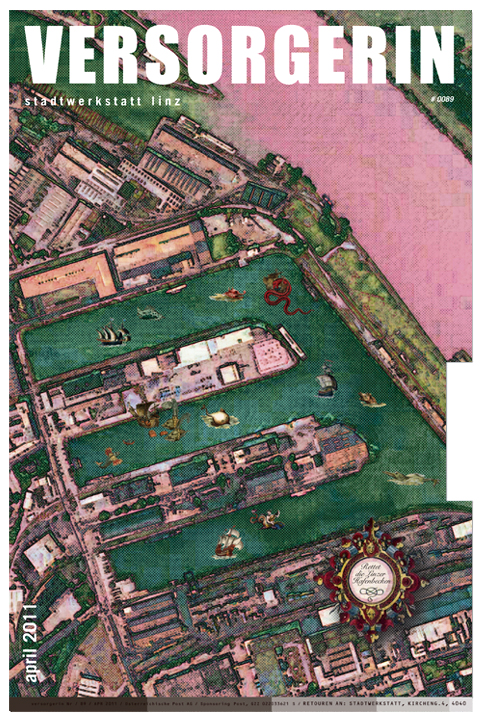Kommentatoren wie beispielsweise Karim El-Gawhary erklären den Israelis, sie sollten sich nicht soviel Sorgen machen und auch einmal das Positive sehen. Gute Gründe können sie dafür in der Regel aber nicht nennen, und so erteilen sie ganz so wie die Vertreter der EU dem jüdischen Staat stattdessen Ratschläge, wie er ausgerechnet in der jetzigen Situation durch ein Nachgeben gegenüber den palästinensischen Begehrlichkeiten den berechtigten Zorn der arabischen Massen besänftigen könne – dann würde schon alles gut werden.
Das sehen die israelische Regierung und große Teile der Opposition zu Recht anders: Unter den Ersten, welche die neue regionale Instabilität für sich zu nutzen wussten, war erwartungsgemäß das iranische Regime. Im Februar schickte der Iran zum ersten Mal seit 32 Jahren zwei Kriegsschiffe durch den Suezkanal; Ägypten hat ihre Passage ins Mittelmeer genehmigt – ebenfalls zum ersten Mal seit 32 Jahren. Erstmals seit 30 Jahren ist der jüdische Staat gezwungen, nachrichtendienstliche Kapazitäten, die bisher zur Informationsbeschaffung über den Iran, Syrien und die Hisbollah zum Einsatz kamen, auf Ägypten auszurichten. Hamas-Anhänger und – Funktionäre haben den Sturz Mubaraks frenetisch gefeiert. Völlig zu Recht, denn sie können sich von so gut wie jeder zukünftigen Regierungskonstel-lation im Nachbarland eine Lockerung, wenn nicht gar Aufhebung der Blockade an der Grenze des Gaza-Streifens zu Ägypten erwarten, was für Israel ein Ende der relativen Ruhe an der Südgrenze bedeuten würde, da sich die Hamas durch unkontrollierte iranische Waffenlieferungen zu einer ähnlichen Bedrohung wie die Hisbollah im Norden entwickeln könnte. Yusuf al-Qaradawi, einer der prominentesten und übelsten Hetzer im sunnitischen Islam, kehrte nach Jahrzehnten der Verbannung vor wenigen Wochen nach Ägypten zurück. In seiner ersten großen öffentlichen Predigt, die offenbar mit Billigung der neuen Militärregierung auf dem Tahrir-Platz stattfand, schwärmte er vor Tausenden davon, bald auch im »befreiten« Jerusalem Allah preisen zu können.
Das sind völlig andere Bilder als jene aus Tunesien, wo sich auf einer Islamisten-Kundgebung vor der Synagoge in Tunis nur wenige Hundert zum antisemitischen Mob zusammenrotteten, während sich auf der Gegendemo ein paar Tage später über 15.000 einfanden. Und jenes Al-Dschasira-Interview, in dem sich Rachid al-Ghannouchi, der Chef der islamistischen Partei Nahda, bitter enttäuscht zeigte, dass partout niemand mit ihm reden, geschweige denn ihn in irgendein politisches Bündnis aufnehmen möchte, gehörte mit zu den schönsten Fernsehmomenten der letzen Monate. In Kairo jedoch wurden Vertreter der Muslimbruderschaft bereits vom neu ernannten Vizepräsidenten zu Gesprächen über die Zukunft des Landes em-pfangen, als sie sich offiziell noch nicht einmal als Partei betätigen durften.
Wer sich von seiner Begeisterung dazu verleiten lässt, den arabischen Aufbruch blindlings abzufeiern, verschließt die Augen davor, dass Volksaufstände schon viel zu oft das Schlechte durch etwas Schlimmeres ersetzt haben. Die keineswegs dominierenden, aber immer wieder auftauchenden Bilder, auf denen die Demonstranten Mubarak mit aufgemalten Davidsternen als ‚Judenknecht’ gebrandmarkt haben, rufen in Erinnerung, worin dieser Aufstand enden könnte. Es ist kein Zufall, dass iranische Oppositionelle, von den Rätekommunisten bis zu den Liberalen, ihre Grußadressen an die tunesischen und insbesondere die ägyptischen Revolutionäre stets mit eindringlichen Warnungen spicken, nicht die Fehler aus der iranischen Revolution von 1979 zu wiederholen und die Islamisten zu unterschätzen. Ihre Sorgen werden durch die offen zur Schau gestellte Begeisterung des Regimes in Teheran über die Kairoer Demonstrationen gespeist. Die ist nicht verwunderlich, sahen die Ajatollahs die prowestliche ägyptische Diktatur doch seit dem Friedensschluss mit Israel als einen ihrer Erzfeinde an.
Israel hat bezüglich Ägypten gute Gründe, nicht nur den Machtzuwachs der Muslimbruderschaft zu fürchten. In der Armeeführung gibt es Kräfte, die zwecks Machtsicherung auf eine Kooperation mit den Islamisten setzen, mit denen auch Mohammed el-Baradei, der ehemalige IAEO-Direktor und ein möglicher Präsidentschaftskandidat, zusammenarbeitet. Das ägyptische Oppositionsbündnis Kifaya, das in der Vorbereitung des Sturzes Mubaraks eine maßgebliche Rolle gespielt hat und in dem sich Linke, Nationalliberale und jene Islamisten zusammengeschlossen haben, die mit der Muslimbrüderschaft gebrochen haben oder schon immer in Konkurrenz zu ihr standen, wurde überhaupt erst ins Leben gerufen, um die »Al Aksa-Intifada« der Palästinenser zu unterstützen, in der über 1000 Israelis ermordet und mehr als 7000 verletzt wurden. Bald nach ihrer Gründung initiierte Kifaya eine viel beachtete Petition zur Aufkündigung des Friedensvertrags mit Israel. Kein Wunder, dass die Antiimperialistische Koordination in Österreich, welche die Kooperation von Linken und Islamisten schon seit Jahren nicht nur propagiert, sondern auch praktiziert, 2005 einen Vertreter von Kifaya nach Wien eingeladen hat.
Von Tariq al Bishri, jenem Juristen, der zum Vorsitzenden des Ausschusses für die Überarbeitung der Verfassung ernannt wurde, hört man, dass er dem iranischen Regime schon deswegen Bewunderung entgegenbringt, weil es ein leuchtendes Beispiel im Kampf gegen Israel sei. Ayman Nour, der Vorsitzende der liberalen Ghad-Partei und im Westen seit Jahren als wichtiger Gegenspieler Mubaraks gehandelt, stellt den Friedensvertrag mit Israel zumindest in Frage. Die vergleichsweise unbedeutenden, in der anachronistischen Tradition des Nasserismus stehenden Bündnisse sind ohnehin eindeutig antiisraelisch ausgerichtet. Aber auch die neu entstandene »Jugendbewegung des 6. April« fordert die Einstellung der Erdgaslieferungen an Israel, womit sie sich gegen die Politik der jetzigen Militärregierung stellt. Nichtsdestotrotz wird die Gruppe von deutschen und österreichischen Beobachtern als großer Hoffnungsträger präsentiert, ohne dass ihre antiisraelische Stoßrichtung überhaupt erwähnt wird.
Die Ziele der ägyptischen Muslimbrüder, deren ideologische Vordenker wie Sayyid Qutb Schriften mit so eindeutigen Titeln wie »Unser Kampf mit den Juden« verfasst haben, sind trotz des sunnitisch-schiitischen Gegensatzes jenen des iranischen Regimes durchaus ähnlich. Der heutige Oberste Geistliche Führer im Iran, Ali Khamenei, gehörte in den 1960er Jahren zu den Übersetzern der Schriften von Qutb. Bei den ägyptischen Muslimbrüdern, die auf Zeit setzen, existieren zweifellos unterschiedliche Flügel, von denen sich einer an der türkischen AKP orientiert. Schaut man sich deren immer hemmungslosere antiisraelische Politik und die Annäherung an das Regime in Teheran an, ist allerdings fraglich, warum das als Anlass zur Entwarnung gesehen wird. Sollte Ägypten den Weg der Türkei gehen, würde das eine fundamentale Kräfteverschiebung in jener Konfrontation bedeuten, die seit Jahren im Nahen Osten zwischen einer pro- und einer antiiranischen Achse stattfindet – was zwangsläufig zu Ungunsten Israels ausgehen würde, für das die Bedrohung durch das iranische Nuklearwaffen- und Raketenprogramm weiterhin Priorität hat.
Die Machthaber in Teheran setzen derweil völlig unbehelligt auf brutale Repression gegen die Freiheitsbewegung und werden dafür mit Besuchen europäischer Außenminister wie zuletzt Guido Westerwelle belohnt. Aber auch in Österreich zeigt man sich weiterhin unbeeindruckt vom Terror des iranischen Regimes und seinem unbeirrten Festhalten an der nuklearen und konventionellen Aufrüstung: Trotz aller Sanktionen sind die österreichischen Exporte in den Iran im letzten Jahr abermals gewachsen, die Importzahlen sind mit einer Steigerung von 400% geradezu explodiert. In Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner des Regimes im Westen, schaut die Situation nicht viel anders aus. Genau diese Politik hält das iranische Regime mit am Leben. Dabei wäre sein Sturz eine gute, wenn auch sicher nicht hinreichende Versicherung, dass der arabische Frühling nicht zu einer Intifada gegen Israel verkommt, die den Massen weder Freiheit noch Brot zu bieten hätte – was aber bekanntlich überhaupt kein Grund ist, sie nicht vom Zaun zu brechen.
Die Frage lautet, ob jener für den Nahen Osten so typische Mechanismus durchbrochen werden kann, bei dem die innergesellschaftlichen und durch den Weltmarkt evozierten Widersprüche, die allein durch den Sturz eines Regimes nicht verschwinden, stets in Aggression gegen den jüdischen Staat transformiert werden. Diese Verschiebungsleistung erfolgt keineswegs automatisch, und selbstverständlich wäre es für Israel wünschenswert, wenn mit einem neuen Ägypten endlich ein Frieden nicht nur mit der Führung, sondern mit der Bevölkerung geschlossen werden könnte und dadurch auch all jene zivilgesellschaftlichen Projekte möglich würden, die schon im Abkommen von Camp David vorgesehen waren, aber unter dem Regime Mubaraks nie eine Chance hatten. Israel aber hat nichts davon, sich etwas zu wünschen. Es muss sich, wie immer, auf das Schlimmste vorbereiten. Wenn die Entwicklungen dann doch einem Beobachter wie dem ehemaligen Likud-Minister Natan Sharansky Recht geben, der im arabischen Aufbruch eine Bestätigung der Thesen seines Buches »The Case for Democracy« und eine große Chance für Israel sieht – umso besser.