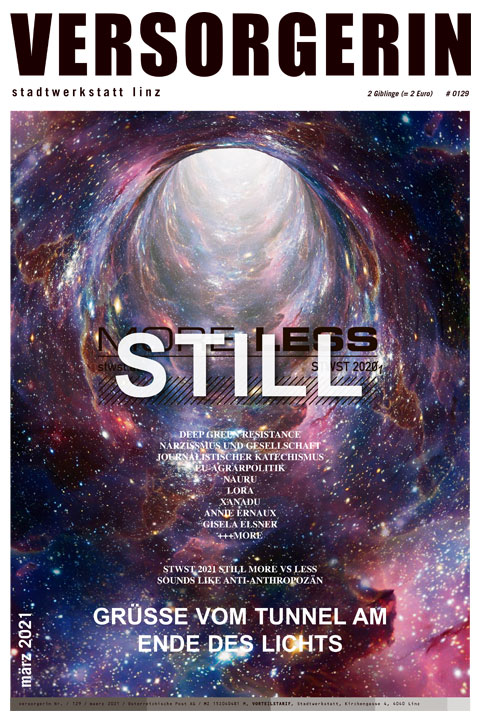Annie Ernaux versetzt auf dem Abstellgleis befindliche Erinnerungen immer wieder aufs Neue in Bewegung, wofür sie Bilder in Worte fasst, die zwischen Autobiografie und Historiografie unterscheiden. In Les années, einem Buch, das die Jahrzehnte Frankreichs von den 1940er Jahren bis in die 2000er darstellt, will sie die ‚große‘ und ‚kleine‘ Geschichte zusammendenken. Dort gibt sie an verstreuten Stellen dankenswerterweise auch immer wieder Einblick in ihre methodologischen Überlegungen, an der sich Ernaux’ weitere Literatur messen ließe, lesen sich doch in vielerlei Hinsicht ihre kleineren Erzählungen wie Antworten auf die zeitlich erst später erschienene Arbeit, die erstmals 2017 bei Suhrkamp erschien: in La Place forscht sie ihrem Verhältnis zum Vater nach, Une femme handelt von der Beziehung zur Mutter und in La Honte versetzt sie sich in die Dreiecksbeziehung von Mutter-Vater-Kind. In Letzterer fragt sie sich, was sie heute – die Schrift stammt aus dem Jahr 1997 und wurde 2020 erstmals auf Deutsch publiziert – selbst noch mit dem zwölfjährigen Ich verbindet und möchte im Schreibprozess, der zugleich Erkenntnisprozess sein soll, offenlegen, wie sie überhaupt einen Zugang zu ihrer eigenen Biografie finden kann. Doch was ihre kleinen Arbeiten vom verhältnismäßig umfangreichen Werk Les années unterscheidet, ist, dass sie es in diesen Schriften angenehmerweise unversucht lässt, die Epoche selbst zur Darstellung zu bringen und gerade nicht vom Besonderen aufs Allgemeine schließt. In den zeitlich früher entstandenen Erzählungen wird zwar bereits das Verlangen kenntlich, die erst einmal unverstandenen Initialereignisse unter die soziologisch verfassten Milieus zu subsumieren, womit das so geschaffene Gebilde einem Sozialkonstruktivismus sich annähert und wodurch letztlich unaussprechbar wird, dass jedes Milieu selbst Moment des Falschen immer schon ist. Doch bringt sich Ernaux in ihren kleinen Arbeiten nicht selbst um den Ausdruck des Besonderen, der dann keinen Sinn hat, wenn der Anspruch aufgegeben wird, das gesellschaftlich Allgemeine in der Weise verändern zu wollen, dass dem je Besonderen zu seinem Recht verholfen werden müsse und womit Besonderes gerade als eines nicht mehr erscheint: als Besonderes schlechthin – jede negative Dialektik von Besonderem und Allgemeinen wäre getilgt.
In La Honte wird die anfänglich unverstandene Szene, die die Autorin an das sehr viel jüngere Ich denken lässt, in diesen für ihr Leben einschneidenden ersten Satz gefasst: »An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen.« Dieses schauerliche Erlebnis im Leben der namenlosen 12jährigen Icherzählerin soll sich ihr selbst verständlich zeigen. Dieser Tag, der 15. Juni 1952, war das »erste präzise und eindeutige Datum meiner Kindheit.« Der Mordversuch des Vaters war von solcher Rohheit gekennzeichnet, dass die Szene zu notieren sie sich nie traute: »Als wäre es etwas Verbotenes, wofür man bestraft wird.« Ist die Szene einmal verschriftlicht, gerät sie in Gefahr, zur Banalität zu verkommen: »Vielleicht macht das Erzählen, egal in welcher Form, jede beliebige Tat, sogar die dramatischste, zu etwas Normalem.« Die Worte, in der sie die Szene beschreibt, werden ihr zunehmend fremd: »Die Szene gehört jetzt anderen.« Denn bloße Worte für das Bild gefunden zu haben, reicht nicht aus: »Über die Szene war kein Urteil möglich. Mein Vater, der mich liebte, hatte meine Mutter, die mich ebenfalls liebte, töten wollen.« Der Urszene dennoch einen adäquaten Namen geben zu wollen, sie greifbar zu machen, darum kreist diese Schrift.
Um zu verstehen, weshalb sie sich bei dieser Szene an das zwölfjährige Ich erinnert, geht die Erzählerin zuallererst den »materiellen Spuren« nach, sie nimmt sich Postkarten und Zeitungsartikel aus dem Jahr 1952 vor. Doch sie merkt, dass die Darstellung so nicht gelingen kann, dass die Szene »in Worte gefasst zu haben«, »nichts an ihrer Bedeutungsleere« ändert. Sie muss das Rätsel anders entschlüsseln. Anfänglich sei »nichts wirklich enthüllt, nur die rohe Tat.« Dafür, dass das Bild wieder lebendig werden kann, beschließt die Erzählerin, die »damalige Lebenswirklichkeit« zu ergründen, wofür es nur »eine verlässliche Möglichkeit« gibt: »ich muss mir die Gesetze und Riten, die Glaubenssätze und Werte der verschiedenen Milieus vergegenwärtigen, Schule, Familie, Provinz, in denen ich gefangen war und die, ohne dass ich mir ihrer Widersprüche bewusst gewesen wäre, mein Leben beherrschten.« Dieses hybride soziologisch-literarische Programm einmal formuliert, beginnt Ernaux damit, den familiären Wohnort Y zu beschreiben, erklärt, wie fremd sie sich bei den Ausflügen in die nächstgrößere Stadt fühlte; sie erzählt, dass das Stadtzentrums Ys dort war, wo man keinen Blaumann beim Einkaufen anhatte; kurzum: es gab klar abgegrenzte, aber dennoch unsichtbare Grenzen zu den verschiedenen Vierteln, diejenigen, in denen die Bürger stolzierten, andere wiederum, die die Arbeiter nie verließen. Alles klar durch das ›Soziale‹ umgrenzt, dazwischen irgendwo das Familienhaus: ein Krämerladen mit angeschlossener Kneipe und kleinem Rückzugsort. Das Familienleben spielte sich weitestgehend öffentlich ab. Die Eltern erteilten der Zwölfjährigen, die nach der Schule im Laden oft aushelfen musste, die Anweisung, gegenüber den Kunden möglichst nichts über die Familie preiszugeben. Merklich wird, dass die Gewaltszene in dieser Welt keinen Platz haben darf, sie nicht nach außen dringen darf, sich ihr gegenüber als unverstanden behaupten muss. Die Situation der heranwachsenden Frau wirkt daher keineswegs zufällig isoliert, oftmals freundlich-eigenbrötlerisch, da sie immer wieder in eine Welt phantasierten Spiels eintaucht und sich ansonsten in die Lektüre versenkt, was darauf vorausweist, dass sie sich schließlich vom provinziellen Milieu der Eltern entfremden wird.
Im Verlauf des Buchs kommt die Erzählfigur dazu, das »Universum der katholischen Privatschule« zu »rekonstruieren«, das sie in dieser Zeit am stärksten »beherrschte«. Auch dort gab es Regeln ganz eigener Art. Dort siezt man selbst die jüngsten Schulkinder, will sich mit Händen und Füßen vom Laizismus abgrenzen, inszeniert sich durch Schulaufführun-gen im Städtchen Y als vorbildlich. Es will der Eindruck entstehen, dass dieses Milieu, das durch Frömmigkeit charakterisiert ist und wo folglich eine rigide Sexualmoral herrscht, die Lücke zur Familie hin öffnet, »verschmolz« dort »Religion und Wissen«. Wobei die Grenzen des Wissens klar umrissen sind, war es doch undenkbar, »Fotoromane zu lesen«. Literatur erhält die Zwölfjährige von ihrer Mutter, der eine Schlüsselrolle zukommen wird und die zwar an der Religiosität irgendwie festhält, die katholische Ordnung aber dennoch belächelt. Der Zwang, den die katholische Privatschule ausübt, bleibt subtil, was den Kontrast zu den rohen Umgangsformen der biologischen Familie deutlich werden lässt: »Das Gesetz übt seine Macht auf sanfte, familiäre Weise aus, zum Beispiel durch das beifällige Lächeln der Mademoiselle, der wir auf der Straße begegnen und die wir respektvoll grüßen.«
Die Mutter zeichnet sich – im Gegensatz zum Vater, der in seinen Umgangsformen dem Arbeitermilieu verhaftet bleibt – dadurch aus, dass sie im Gestus den bürgerlichen Anschein wahren will, der in einer eindrücklich geschilderten Szene, in der die Welt der katholischen Privatschule in Konfrontation mit der Wirklichkeit des familiären Elternhaus gerät, zusammenbricht. Gerade weil ihr die Mutter als »Vermittlerin des religiösen Gesetzes und der schulischen Vorschriften« gilt, steigt in ihr durch das äußere Erscheinungsbild der Mutter das Gefühl auf, vor Scham im Boden versinken zu wollen: Eines Nachts, nach einem »Fest der Jugend«, begleitet die Lehrerin, Mademoiselle L., die Zwölfjährige und andere Kinder nach Hause. Die Mutter begrüßt die Entourage um ein Uhr früh im hellen Rechteck der Tür »in einem zerknitterten, fleckigen Nachthemd (wir benutzten unsere Nachthemden, um uns nach dem Urinieren abzuwischen).« »Mademoiselle L. und die zwei, drei Mitschülerinnen verstummten. … In meiner Erinnerung ist diese Szene, die in keiner Weise vergleichbar ist mit der anderen, in der mein Vater meine Mutter umbringen wollte, deren Fortsetzung.« Für die Erzählerin wird nun klar: »Wir gehören nicht länger zu den anständigen Leuten, die nicht trinken, sich nicht prügeln, sich ordentlich kleiden, wenn sie in die Stadt gehen. … Ich wusste etwas, was ich in der sozialen Unschuld der Privatschule nicht hätte wissen dürfen, etwas, was mich auf unsagbare Weise in das Lager derjenigen einordnete, deren Gewalttätigkeit, Alkoholismus und geistige Verwirrung den Stoff für Erzählungen lieferten, die mit ‚so was ist wirklich traurig mit anzusehen‘ endeten.« »Von jetzt an lebte ich in der Scham« – »Die Scham ist die letzte Wahrheit. Sie vereint das Mädchen von 52 mit der Frau, die dies jetzt gerade schreibt.« Ernaux spricht ausdrücklich von einer Scham, die sich nicht situativ einstellt, sondern sich dauerhaft bemerkbar mache: »Die Scham ist nichts als Wiederholung und Akkumulation«; die Scham soll die Identität ihrer Person ausdrücken, wurde sie doch »Teil« ihres »Körpers« und ihr so zur Normalität: »Es war normal, sich zu schämen, als wäre die Scham eine Konsequenz aus dem Beruf meiner Eltern, ihren Geldsorgen, ihrer Arbeitervergangenheit, unserer ganzen Art zu leben. Eine Konsequenz der Szene des Junisonntags. Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise.«
Indem Ernaux die Scham, die sich der Erzählerin nur als Grenzgängerin zwischen zwei grundverschiedenen Milieus bemerkbar machen kann, als dauerhaftes Empfinden charakterisiert, gerinnt ihr zur Gewissheit, dem alten Milieu nie gänzlich entfliehen zu können,[1] weshalb kein Staunen und Zurückschrecken des Individuums darüber, sich in falscher Gesellschaft zu wähnen, möglich ist. Letztlich bringt sich Ernaux um den Austragungsort des in der Luft liegenden Konflikts mit ihren Eltern, wo Protest artikuliert werden könnte. So mag es gleich doch wieder so scheinen, als wäre die negative Dialektik von Besonderem und Allgemeinem hier stillgestellt, da die nie irgendwie begreiflich zu machende Gewalttat – dessen Unbegreiflichkeit allein Darstellung finden kann, ja muss – in die eigentümlich verfasste Scham ›verschoben‹ wird; oder anders ausgedrückt: zwar erhält das Initialereignis sprachlichen Ausdruck, erfährt aber dadurch zugleich Rationalisierung. Insofern es also Ernaux gelingen mag, ihrem anfänglich unverstandenen Gefühl, das sich einst während des Mordversuchs einstellte, einen Namen zu geben, misslingt ihr gleichzeitig, das nie fasslich zu machende Gefühl in der ganzen Unbegreiflichkeit auszudrücken. So betrachtet, scheitert Ernaux, womit sie aber vielleicht dennoch unwillentlich in ihrer Literatur der nicht gelingen wollenden Gesellschaft einen Platz einräumt.
Das Buch
Annie Ernaux: Scham. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Bibliothek Suhrkamp 2020. 110 Seiten, 18 Euro.