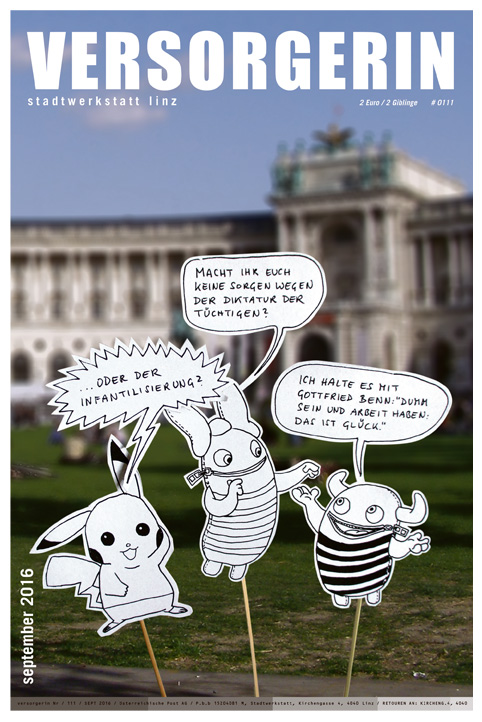»Obama ist nicht schwarz«1, behauptete die schwarze US-amerikanische Autorin Debra Dickerson, kurz nachdem dieser Anfang 2007 seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hatte – und »Eine Mehrheit der Schwarzen«, sekundierte damals das deutsche Magazin DER SPIEGEL »scheint diese Meinung zu teilen. In einer aktuellen Umfrage der Washington Post unter Afro-Amerikanern unterstützen 60 Prozent die weiße Parteirivalin Obamas, Hillary Clinton. Obama selbst kam bei den Schwarzen dagegen nur auf 20 Prozent [...] Dieses Phänomen erklärt sich dadurch, daß in den USA [...] unter Schwarzen die Bezeichnung ‚schwarz’ nicht allein [die] Hautfarbe beschreibt. Sondern viel mehr: Kulturerbe, Herkunft, Philosophie, Sprache. Dickerson zieht die Linie glasklar: ‚Schwarz heißt in unserer politischen und sozialen Realität, daß jemand von westafrikanischen Sklaven abstammt.’«2
Gute eineinhalb Jahre später berichtete Salon, das selbe Online-Magazin, in dem Dickerson Obama das »Schwarz-Sein« abgesprochen hatte, über folgende Episode: »Ein Mann fragt beim canvassing [von Haus zu Haus gehen und um Stimmen werben (Anmerkung des Autors)] für Obama im westlichen Pennsylvania eine Hausfrau, welchen Kandidaten sie wählen würde. Sie brüllt ins Haus, um es herauszufinden. Der Mann im Inneren des Hauses brüllt zurück: »we’re voting for the nigger!« (‚Wir wählen den nigger!’). Woraufhin sich die Hausfrau dem Stimmenwerber zuwendet - und die Aussage ihres Mannes in aller Ruhe wiederholt.«3
Jenen beiden Rassisten, der Hausfrau und ihrem Mann, ist es herzlich egal, ob Obama von westafrikanischen Sklaven abstammt oder nicht. Der Sohn einer weißen US-amerikanischen Mutter und eines kenianischen Vaters, ist für sie genauso ein nigger wie ein aus Nigeria eingewanderter Taxifahrer, auch wenn sie – aus welchen Gründen auch immer – bereit sind, diesmal einen nigger zum Präsidenten zu wählen.
Dieser brutalen, fremdbestimmten, gleichmacherischen Identifizierung des »nigger ist nigger« versucht Debra Dickersens Rede von »Schwarz heißt, daß jemand von westafrikanischen Sklaven abstammt« eine selbstbestimmte Identifizierung entgegenzusetzen, indem sie sich und »ihr eigenes Kollektiv« als Nachfahren westafrikanischer Sklaven zu identifizieren versucht. Oder anders: Dickersen setzt der Identifizierung durch den Feind eine - selbstbestimmte - Identität entgegen.
Erstaunlicherweise - und entgegen der vom Spiegel zitierten Umfrage - stimmten am 4. November 2008 nicht 20, sondern 95 Prozent aller schwarzen Wähler für Obama, einschließlich jener schwarzen Wähler, die wie Debra Dickersen ihre Identität auf ihre Abstammung von westafrikanischen Sklaven gründen. Zwar dürften jene »Westafrikaner« Obama selbstverständlich nicht nur aufgrund seines Schwarz-Seins (oder trotz seines angeblichen »Nicht-Schwarz-Seins«) gewählt haben, wir sind aber dennoch mit dem seltsamen Befund konfrontiert, daß am 4. November 2008 nicht die Identität als Nachfahre westafrikanischer Sklaven ausschlaggebend gewesen ist, sondern die gleichmacherische Identifizierung durch den rassistischen Feind - die zwischen Obama und den »Westafrikanern« keinen Unterschied macht.
*
Der Schriftsteller und Widerstandskämpfer Jean Améry war ein Kleinkind als sein jüdischer Vater als Tiroler Kaiserjäger im Ersten Weltkrieg fiel. Er wurde dann von seiner katholischen Mutter erzogen. 1938, nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, floh er mit seiner jüdischen Frau aus Wien nach Belgien, wo er 1940 von den Nazis festgenommen und in einem südfranzösischen Lager interniert wurde. 1941 gelang ihm die Flucht. Zurück in Belgien schloss er sich einer Widerstandsgruppe an. 1943 wurde er erneut verhaftet und im Lager Breendonk schwer gefoltert. 1944 wurde er nach Auschwitz und in weiterer Folge nach Buchenwald und Bergen-Belsen deportiert. Als er schließlich befreit wurde, war seine Frau, um derentwillen er in jenen Konzentrationslagern »zwei Jahre lang die Lebenskräfte wach gehalten hatte«4, nicht mehr am Leben.
Zwanzig Jahre später begann Améry das Unbewältigbare jener Erlebnisse im Essayband Jenseits von Schuld und Sühne schreibend zu bewältigen.
» ... als ich 1935 in einem Wiener Café über eine Zeitung saß und die eben drüben in Deutschland erlassenen Nürnberger Gesetze studierte [...] brauchte [ich] sie nur zu überfliegen und konnte schon gewahr werden, daß sie auf mich zutrafen. Die Gesellschaft, sinnfällig im nationalsozialistischen deutschen Staat, den [...] die Welt als legitimen Vertreter des deutschen Volkes anerkannte, hatte mich soeben in aller Form [...] zum Juden gemacht [...] Ich war, als ich die Nürnberger Gesetze gelesen hatte, nicht jüdischer als eine halbe Stunde zuvor. Meine Gesichtszüge waren nicht mediterran-semitischer geworden [...] der Weihnachtsbaum hatte sich nicht magisch verwandelt in den siebenarmigen Leuchter. Wenn das von der Gesellschaft über mich verhängte Urteil einen greifbaren Sinn hatte, konnte es nur bedeuten, ich sei fürderhin dem Tode ausgesetzt. Dem Tode. Nun, dem gehören wir allen an, über kurz oder lang. Aber der Jude, als der ich durch Gesetzes- und Gesellschaftsbeschluß jetzt dastand [...], dessen Tage waren eine zu jeder Sekunde widerrufbare Ungnadenfrist [...] ich [bin] gewiß, daß ich in [...] diesem Augenblick der Gesetzeslektüre [...] das Todesurteil schon vernahm, und dazu gehörte [ja] auch keine besondere Geschichtsempfindlichkeit [...] Ich hatte [...] in diesen Tagen [einmal] in einer illustrierten Zeitung das Photo einer Winterhilfsveranstaltung in einer rheinischen Stadt gesehen, und da prangte im Vordergrund, vor dem elektrisch strahlenden Lichterbaum ein Spruchband [...] ‚Keiner soll hungern, keiner soll frieren, aber die Juden sollen krepieren...’«5
Die – von den Nationalsozialisten beherrschte - Gesellschaft hatte also Améry in diesem Augenblick »zum Juden gemacht«. Die Nürnberger Rassengesetze definierten ja akribisch anhand der Kriterien Abstammung, konfessionelle Zugehörigkeit und Ehe, ob jemand als Jude galt, als jüdischer Mischling ersten oder zweiten Grades, oder als »deutschblütig«. Améry galt, weil er zwei jüdische Großeltern besaß und mit einer Jüdin verheiratet war als »Volljude« - die jüdische Identität wurde hier also gesetzlich konstruiert.
Aber: »Wenn Jude sein heißt«, schreibt Améry an einer anderen Stelle, »mit anderen Juden das religiöse Bekenntnis zu teilen, zu partizipieren an jüdischer Kultur und Familientradition, ein jüdisches Nationalideal zu pflegen, dann befinde ich mich in aussichtsloser Lage. Ich glaube nicht an den Gott Israels. Ich weiß sehr wenig von jüdischer Kultur. Ich sehe mich, einen Knaben, Weihnachten zur Mitternachtsmette durch ein verschneites Dorf stapfen, ich sehe mich in keiner Synagoge. Das Bild des Vaters – den ich kaum gekannt habe [...] – zeigt mir keinen bärtigen jüdischen Weisen, sondern einen Tiroler Kaiserjäger in der Uniform des Ersten Weltkriegs.«6
Identität denken wir gewöhnlich als etwas eigenes, uns zugehöriges, vertrautes – und bedeutsames. Glauben wir diese unsere Identität sei »verschüttet« oder gar »verloren«, fühlen wir uns aufgerufen, dieses Verschüttete oder Verlorene zu suchen: in den Tiefen unseres Selbst, in Erinnerungen oder in den Traditionen der Vorfahren.
Von all dem finden wir in Amérys Verhältnis zu »seinem« Jüdisch-sein nicht die geringste Spur.
»Ich war neunzehn Jahre alt, als ich von der Existenz einer jiddischen Sprache vernahm, wiewohl ich [...] genau wußte, daß meine religiös und ethnisch vielfach gemischte Familie den Nachbarn als eine jüdische galt [...] Ich war Jude so wie einer meiner Mitschüler Sohn eines bankrotten Wirtes war: wenn der Knabe mit sich allein war, mochte der geschäftliche Niedergang der Seinen so gut wie nichts für ihn bedeutet haben [...] Meint also Jude sein einen kulturellen Besitz, eine religiöse Verbundenheit, dann war ich keiner und kann niemals einer werden.«7
Eine wie auch immer geartete positive Identität als Jude hatte Améry also nicht - was aber nicht heißt, daß er glaubte, jenen brutalen negativen Akt der Identifizierung als Jude per Rassengesetz einfach zurückweisen zu können.
»Als ich 1935 die Nürnberger Gesetze las und mir bewußt wurde, nicht nur, daß sie auf mich zutrafen, sondern daß sie der juridisch [...] zusammengefaßte Ausdruck des schon vorher von der deutschen Gesellschaft durch ihr ‚Verrecke!’ gefällten Urteilsspruches waren, hätte ich geistig die Flucht ergreifen [...] können. Dann hätte ich mir gesagt: So, so, dies ist also der Wille des nationalsozialistischen Staates [...] er hat aber nichts zu schaffen mit dem wirklichen Deutschland. Oder ich hätte argumentieren können, daß es eben nur Deutschland sei, ein leider in einem blutigen Wahn versinkendes Land, das mich da absurderweise zum Untermenschen [...] stempelte, während zu meinem Heil die große und weite Welt draußen, in der es Engländer, Franzosen, Amerikaner, Russen gibt, gefeit ist gegen die Deutschland geißelnde Paranoia. Oder ich hätte [mir] schließlich [...] zusprechen können: Was immer man von mir auch sage: es ist nicht wahr. Wahr bin ich nur, als der ich mich selber im Innenraum sehe [...]; ich bin, der ich für mich und in mir bin, nichts anderes. Ich will nicht sagen, daß ich nicht bisweilen solcher Versuchung unterlag. [Hervorhebungen von mir]«8
Bisweilen – aber nicht dauerhaft. Denn: »Ich verstand, wenn auch undeutlich, daß ich [...] den Urteilsspruch [der Nürnberger Gesetze (Anmerkung des Autors)] als einen solchen akzeptieren müsse [...] Ich nahm das Welturteil an [...]«9
Und weiter: »Ich kann in meinen Erwägungen den Juden, die Jude sind, weil eine Tradition sie birgt, keinen Raum lassen. Nur für mich selber darf ich sprechen – und [...] für die wohl nach Millionen zählenden Zeitgenossen, auf die ihr Judesein hereinbrach, ein Elementarereignis, und die es bestehen müssen ohne Gott, ohne Geschichte, ohne messianisch-nationale Erwartung. Für sie, für mich heißt Jude sein die Tragödie von gestern in sich lasten spüren. Ich trage auf meinem linken Arm die Auschwitz-Nummer; sie liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch [...] gründlicher Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel der jüdischen Existenz.«10
Jener von Debra Dickersen repräsentierte Diskurs, der Obama das Schwarz-Sein abspricht, bringt gegen die negative rassistische Identifizierung aller Schwarzen als nigger eine positive Identität in Stellung: die Abstammung »echter« schwarzer US-Amerikaner von westafrikanischen Sklaven.
Anders Améry, der seine Identifizierung als Jude durch den nationalsozialistischen Todfeind als gesellschaftliches Urteil radikal auf sich nahm - und sich weigerte, vor der negativen Identität, die ihm als Auschwitz-Nummer auf dem linken Unterarm eingeschrieben war in eine positive Identität als - religiöser, nationaler, kultureller, traditioneller - Jude zu flüchten.
*
Juden sind, nach Moishe Postone, für den modernen Antisemiten »Personifikationen der unfaßbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen [...] Herrschaft des Kapitals.«11
Der Antisemitismus ist daher, wie Detlev Claussen bemerkt, nicht einfach irgendeine »Unterabteilung des Rassismus«.12 Dennoch aber, und bei aller Unterschiedlichkeit, gibt es eine für unseren Zusammenhang wichtige Gemeinsamkeit zwischen der Identifizierung von Juden durch die Rassengesetze der Nazis und der rassistischen Identifizierung schwarzer US-Amerikaner als nigger. Die per Gesetz zu Juden Gestempelten sind, wie die als nigger Identifizierten, Opfer eines - wie Améry es nennt - »Würdeentzugs«, den dieser in der Todesdrohung eingebettet sieht.
»Jude sein, das hieß für mich von diesem Anfang an, ein Toter auf Urlaub sein, ein zu Ermordender, der nur durch Zufall noch nicht dort war, wohin er rechtens gehörte [...] In der Todesdrohung, die ich zum ersten Mal in voller Deutlichkeit beim Lesen der Nürnberger Gesetze verspürte, lag auch das, was man [...] die methodische ‚Entwürdigung’ der Juden durch die Nazis nennt.«
Die Todesdrohung, mit der Schwarze in den USA konfrontiert waren und sind, ist zwar – weil sie nicht, wie im Falle des Holocaust, einen industriellen Massenmord ankündigt - gänzlich anderer Art als jene von der Améry spricht. Todesdrohung, die Entwürdigung in sich birgt, war, ist und bleibt sie aber dennoch.
»Grundsätzlich galt ... für alle Sklaven, daß sie [...] in den Südstaaten der USA vor dem Gesetz so wie Vieh als Eigentum galten und keinerlei persönliche Rechte hatten. Sie waren der Willkür ihres Besitzers schutzlos ausgeliefert, d.h. er konnte sie einsperren, hungern lassen, auspeitschen [...] ja töten ohne dafür rechtlich belangt zu werden.«13
Die Ku Klux Klan-Morde, etwa die Morde an den Bürgerrechtsaktivisten 1964 in Mississippi, die bis heute nicht angemessen gesühnt wurden, und der Umstand, daß der Ku Klux Klan seit der Wahl Obamas neuen Zulauf verzeichnet, erinnern daran, daß diese Vergangenheit nicht vergehen will. Gibt man in die Google-Suchleiste die Begriffe »USA« und »Polizist« ein, lautet der erste Vorschlag: »erschießt Schwarzen«.
*
Der Berliner Psychoanalytiker Karl Abraham, ein Pionier der Psychoanalyse, beschreibt in seiner 1924 publizierten Schrift »Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen« den Fall eines Patienten, der »in seinen ersten Lebensjahren ein in jedem Sinne verwöhntes Kind [war]. [Von der Brust] [...] entwöhnte ihn [die Mutter] erst mit drei Jahren. Mit der Entwöhnung, die unter großen Schwierigkeiten erfolgte, traf nun zeitlich eine Reihe von Ereignissen zusammen, die den [...] Knaben plötzlich seines Paradieses beraubten. Er war bisher der Liebling der Eltern, der um drei Jahre älteren Schwester und der Kinderfrau gewesen. Die Schwester starb, die Mutter zog sich in eine [...] langdauernde Trauer zurück [...]. Die Kinderfrau verließ die Familie. Die Eltern [...] aber ertrugen das Leben in dem bisherigen Hause nicht, da sie sich beständig an das verstorbene ältere Kind erinnert fühlten. Man zog in [...] ein neues Haus. Mein Patient hatte ... alles verloren, was ihm bis dahin an Mütterlichkeit zuteil geworden war. Die Mutter hatte ihm zuerst die Brust entzogen und sich dann in ihrer Trauer auch psychisch gegen ihn abgesperrt. Schwester und Kinderfrau waren nicht mehr da, und selbst das Haus — ein so wichtiges Symbol der Mutter - existierte nicht mehr.
[...] Im halberwachsenen Alter verlor der Patient seinen Vater [...] und lebte nun mit der Mutter, der er jetzt [wieder] liebevoll zugetan war. Aber nach kurzer Witwenschaft heiratete die Mutter und ging mit ihrem Mann für längere Zeit auf Reisen. Sie stieß damit die Liebe des Sohnes aufs neue von sich ab [...]
Nach einer Reihe von Jahren starb die Mutter des Patienten. Er weilte während ihrer letzten Krankheit bei ihr und hielt die Sterbende in seinen Armen. Die starke Nachwirkung dieses Erlebnisses erklärt sich [...] daraus, daß es eine vollkommene Umkehrung der unvergessenen Situation darstellte, in welcher der Patient als kleines Kind in den Armen und an der Brust der Mutter gelegen hatte.
Kaum war die Mutter gestorben, so eilte der Sohn in die [...] Stadt, in welcher er sonst lebte, zurück. Seine Affektlage aber war keineswegs die eines Trauernden, sondern gehoben, glückselig. Er schildert, wie er von dem Gefühl beherrscht war, die Mutter nun für immer und unverlierbar in sich zu tragen. Eine innere Unruhe bezog sich nur auf die Beerdigung der Mutter. Es war, als störte ihn die Tatsache, daß der Körper der Mutter noch sichtbar im Sterbehause lag. Erst nach der Beerdigung konnte er sich dem ... Gefühl des unverlierbaren Besitzes der Mutter hingeben. [Hervorhebungen von mir]«14
Karl Abraham entwickelt hier, in einer geradezu poetischen Sprache, die psychoanalytische Theorie der Identifizierung - als Mechanismus der Verlustverarbeitung. Abrahams Patient reagiert auf den Verlust des mütterlichen Objekts, indem er sich mit der Mutter identifiziert, sich die Mutter buchstäblich einverleibt: er trägt »die Mutter nun für immer und unverlierbar in sich«. Identifizierung bedeutet hier zugleich Rückzug ins Innere: In Reaktion auf den Verlust des geliebten Objekts zieht sich das Subjekt auf die Bühne seines Inneren zurück. Und wechselt dabei die Rolle: Es ist nun nicht mehr der Patient, der die Mutter liebt. Da er sich die Mutter »einverleibt« hat, ist er selbst zur Mutter geworden - ist nun also selbst das geliebte Objekt. Er liebt nicht mehr, sondern wird geliebt. Und zwar von sich selbst.
Identifizierungen gehen daher, um mit Freud zu sprechen, stets mit einer Zunahme an narzißtischer Libido auf Kosten von Objektlibido einher. Es kommt also – in die Alltagssprache übersetzt – zu einer Zunahme an Selbstachtung und Selbstwertgefühl auf Kosten des Interesses an real existierenden Objekten der Außenwelt. Nach dem Motto: »Ich habe nun das Objekt meiner Liebe unverlierbar in mir – das macht mich stark, weil unabhängig von der Welt da draußen«.
Lesen wir nun Debra Dickersens Satz (»Schwarz heißt, daß jemand von westafrikanischen Sklaven abstammt«) vor diesem Hintergrund, läßt sich jene Würde, die den Schwarzen unter Todesdrohung entzogen wurde, als – immer schon - verlorenes »äußeres Objekt« auffassen, das hier zu einem inneren Objekt wird, mit dem sich Dickersen und andere »echte« schwarze US-Amerikaner identifizieren. Und das den Namen »Abstammung von westafrikanischen Sklaven« trägt.
Wie jede Identität verlagert auch die Identität, die auf der Identifizierung mit der »Abstammung von westafrikanischen Sklaven« gründet, das Interesse der Subjekte von der realen Außenwelt auf das imaginäre Innere. Dort bietet sie dem Subjekt - als Ersatz für das draußen, in der gesellschaftlichen Realität, fehlende Objekt »Würde« - ein imaginäres inneres Objekt an, mit dem es sich identifizieren kann. Das Subjekt selbst wird, anders gesagt, zu jener Würde, die es - in den Augen der rassistischen Gesellschaft – nicht hat.
*
»Unsere Ehre wurde mit Füßen getreten. Irans Größe und Ehre ist verloren. Die Größe und Ehre der iranischen Armee ist verloren. Das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das allen amerikanischen Militärberatern samt ihren Familien, ihrem technischen Personal und ihren Hausangestellten, welches Verbrechen sie auch immer begehen mögen, Immunität zuspricht. Nun ist das iranische Volk weniger wert als amerikanische Hunde. Wenn jemand einen amerikanischen Hund überfährt, wird er zur Rechenschaft gezogen. Wenn der iranische Kaiser einen amerikanischen Hund überfährt, wird er zur Rechenschaft gezogen. Überfährt ein amerikanischer Koch den Kaiser [...] hat niemand das Recht, zu protestieren. Ich warne vor einer großen Gefahr! [...] Ihr Führer des Islam, der Islam ist in Gefahr. Rettet den Islam!«15
In dieser Passage seiner berühmten Rede vom 26. Oktober 1964 beklagte Ruhollah Khomeyni, der spätere Führer der islamischen Revolution, die Verabschiedung eines Gesetzes durch das iranische Parlament, das US-Militärberatern eine Art diplomatische Immunität zusprach, sofern das in Frage stehende Delikt in Ausübung ihres Dienstes begangen wurde.
Noch am selben Tag veröffentlichte Khomeyni ein Kommuniqué, in dem es hieß: »Die Welt soll wissen, daß an allen Problemen des iranischen Volkes und anderer islamischer Völker die Ausländer [sic!] schuld sind - die Ausländer, und die Amerikaner. Das iranische Volk hasst Ausländer im allgemeinen und Amerikaner im besonderen«.16
Der Begriff, den Khomeyni hier für jenes Objekt verwendet, dessen Verlust er beklagt bzw. befürchtet – »Ezzat« - hat einen weiteren Bedeutungsumfang als die deutsche Übersetzung »Ehre« vermuten läßt. Das Wörterbuch übersetzt »Ezzat« darüber hinaus mit Ehrfurcht, Achtung, Glorie, Herrlichkeit. Eine Umschreibung, die diesen Bedeutungsumfang in etwa wiedergeben würde, wäre: »Der (ehrfurchtgebietende) Glanz der Herrschaft/der Macht«. Oder: »Der Glanz, der den Mächtigen umgibt«.
Die Klage des Islamisten Khomeyni ist prototypisch für die Haltung und die Weltsicht aller Islamisten. Es ist die Klage über den Verlust - oder den drohenden Verlust - der Macht und der »Herrlichkeit der Macht« des Islam. Beruht die Identität der »echten Schwarzen« im Sinne Dickersens auf der Identifizierung mit dem verlorenen Objekt »Würde«, so gründet die Identität des Islamisten auf seiner Identifizierung mit dem verlorenen Objekt »Ehre« - im Sinne der »Herrlichkeit der Macht« des Islam. Und es sind die Ungläubigen, der Kolonialismus, der US-Imperialismus, der globale Kapitalismus, die Juden, Israel etc., die diese Ehre in seinen Augen mit Füßen getreten haben und treten.
»Amerika ist schlimmer als England, England ist schlimmer als Amerika, die Sowjetunion ist schlimmer als alle anderen, alle sind schlimmer als alle anderen [sic] ... alle unsere Probleme sind von Amerika gemacht, alle unsere Probleme sind von Israel gemacht. Israel gehört zu Amerika.«17
sagt Khomeyni an einer anderen Stelle der zitierten Rede.
Der Islamist, dem das Objekt »Ehre des Islam« in der Gegenwart verloren erscheint - verloren oder beschädigt oder bedroht -, und da er mit dem »Islam« identifiziert ist, seine eigene Ehre, dieser Islamist identifiziert sich, in Reaktion auf diesen Verlust, mit dem frühen Islam. Mit jenem vermeintlich goldenen Zeitalter, in dem er die unbeschädigte »Herrlichkeit der Macht« des Islam noch in Kraft sieht.
Zwischen dem Objekt »Ehre« und dem Objekt »Würde« existiert allerdings ein für unseren Zusammenhang entscheidender Unterschied. Zwar ist entgegen anderslautender Behauptungen die Würde des Menschen - siehe Amérys Rede vom »Würdeentzug« – durchaus antastbar. »Würde« ist also kein vom gesellschaftlichen Außen gänzlich abgekapselter Wert. Dennoch verortet unsere Alltagsintuition »Würde«, nicht ganz zu unrecht, primär im »Innenraum« der Subjekte.
»Ehre« hingegen ist ein gesellschaftlich hergestellter, dem Subjekt von Außen zugeteilter und im gesellschaftlichen Umgang leicht wieder zu zerstörender Wert - und dementsprechend verletzlich. Die Ehre ist daher auch in modernen Gesellschaften ein rechtlich geschütztes, weil zerbrechliches Gut (Ehrverletzungsdelikte). Daß es andererseits, um die Würde des Menschen zu verletzen, oder sie ihm gar zu entziehen, viel radikalerer Maßnahmen bedarf (siehe oben), scheint der erwähnten Alltagsintuition, welche die Würde des Menschen ungleich fester in seinem Inneren verankert sieht als die Ehre, recht zu geben. Zumal, wenn uns Ehre in der spezifischen Gestalt von »Ezzat« begegnet. Als Glanz, der die Macht umgibt, kann diese Art Ehre ihren Ort natürlich nicht in subjektiver Innerlichkeit haben, setzt sie doch die Herrschaft über real existierende andere in der »handfesten« äußeren Realität voraus.
*
»Wenn das Ich«, schreibt Freud in Das Ich und das Es »die Züge des [verlorenen] Objekts annimmt [sich mit dem Objekt also identifiziert (Anm. von mir)], drängt es sich sozusagen selbst dem Es als Liebesobjekt auf, sucht ihm seinen Verlust zu ersetzen, indem es sagt: ‚Sieh, du kannst auch mich lieben, ich bin dem Objekt so ähnlich’. Die Umsetzung von Objektlibido in narzißtische Libido, die hier vor sich geht, bringt eine Desexualisierung mit sich, also eine Art Sublimierung«.18
Folgen wir dieser Überlegung Freuds gründet Sublimierung als Verzicht auf die unmittelbare Befriedigung von sexuellen oder auch aggressiven Triebzielen auf Identifizierung - als Mechanismus der Verarbeitung von Objektverlusten. Mit anderen Worten: auf der Entschärfung von Liebe, oder auch von Hass, durch Verinnerlichung und Verwandlung in Selbstachtung.
Da sich nun aber Ehre, zumal Ehre im Sinne jener »Herrlichkeit der Macht« (im Unterschied zur Würde) nicht in Innerlichkeit aufzulösen vermag, gelingt es dem Islamisten nicht, den Verlust des Objektes »Ehre« durch Identifizierung (mit dem frühen Islam) zu verarbeiten, die aggressiven Energien, die der Machtverlust des Islam freizusetzen vermag (siehe Khomeynis Rede) zu sublimieren.
Im Gegenteil: jene Identifizierung mit dem frühen Islam - auf der die Identität des Islamisten beruht - radikalisiert seine Wut und seinen Hass. Denn verglichen mit der (vermeintlichen) Herrlichkeit des frühen Islam, muß ihm das real existierende Elend islamisch geprägter Gesellschaften der Gegenwart umso schändlicher erscheinen. Und je schändlicher ihm »das Elend des Islam« erscheint, umso flammender sein Hass, umso rasender seine Wut. Identifizierung führt hier also nicht nur nicht zur Sublimierung und somit zur Zähmung aggressiver Triebziele bei den Subjekten. Identifizierung gießt - im Gegenteil - Öl ins Feuer ihres Zorns.
*
Unter bestimmten Umständen scheint jedoch die Identifizierung mit dem Objekt »Ehre« sehr wohl geeignet zu sein, einer Sublimierung aggressiver Triebenergien den Weg zu bereiten, oder eine solche (Sublimierung) zumindest nicht zu behindern. Am 7. Juni 1844 erschien die erste - und letzte - Nummer der Zeitschrift Nauvoo Expositor. Nauvoo, eine Ortschaft im US-Bundestaat Illinois, war damals überwiegend von Mormonen bewohnt, die aufgrund religiöser Verfolgungen aus dem benachbarten Missouri ausgewandert waren. Der Nauvoo Expositor kritisierte Joseph Smith, den Propheten des Mormonentums, und einige seiner Lehren, insbesondere die Polygamie. Der von Mormonen dominierte Stadtrat von Nauvoo bezeichnete in einer Sitzung, unter Vorsitz Smiths, der zugleich Nauvoos Stadtoberhaupt war, die Zeitung als »öffentliches Ärgernis« und beschloss die Zerstörung ihrer Druckerpresse. Der Beschluss wurde am 10. Juni vom obersten Polizisten der Stadt in Begleitung von hunderten Bürgern vollstreckt.
In weiterer Folge wurden Joseph Smith und andere Mitglieder des Stadtrats vom Gericht des Landkreises Hancock wegen Landfriedens-bruchs angeklagt. Smith widersetzte sich zunächst der Verhaftung, rief am 18. Juni das Kriegsrecht aus und mobilisierte die 5000 Mann zählende Nauvoo Legion, deren Oberbefehlshaber er war - lenkte aber schließlich ein. Er wurde verhaftet und nach Carthage, Illinois, gebracht, wo er, in Erwartung seines Verfahrens, im Gefängnis vom Mob gelyncht wurde.
2011 wurde am Broadway das Musical The Book of Mormon aufgeführt. Das von Trey Parker und Matt Stone, den Machern der Animationsserie South Park, geschrieben und komponiert wurde, und das von zwei jungen Mormonen handelt, die ihren Missionsdienst in einem Dorf in Uganda ableisten müssen, wo die zu missionierenden Menschen, geplagt von AIDS, Armut und Warlords, kein Interesse für die Inhalte des Buches Mormon, des Heiligen Buches der Mormonen, aufzubringen vermögen.
The Book of Mormon, das Publikum und Kritik gleichermaßen begeisterte, ist eine beißende, streckenweise derbe Satire auf das Mormonentum, gegen die sich die Mohammed-Karikaturen als absolut harmlos ausnehmen.
Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, daß der eine oder andere Mormone »die Ehre des Mormonentums« durch The Book of Mormon verletzt, ja verloren sieht - und bedenkt man, daß uns jene Art »handfester« politischer und militärischer Herrschaft, mit der Islamisten sich identifizieren, auch in der Geschichte des Mormonentums begegnet, ist der Gedanke nicht fern, daß The Book of Mormon das Potential gehabt hätte, Hass und aggressive Energien freizusetzen - bis hin zu terroristischen Akten.
Daß dem nicht so war, mag nicht zuletzt damit zusammenhängen, daß die Identifizierung mit dem Objekt »Ehre« - im Sinne jenes Glanzes der Herrschaft - im kollektiven Bewußtsein der Mormonen keine, oder eine weitaus geringere Rolle spielen dürfte, als im Bewußtsein von Subjekten, die mit dem Islam identifiziert sind.
Schon deshalb nicht, weil die »Macht« des frühen Mormonentums ungleich geringer war als die imperiale Macht des frühen Islam. Während der von Joseph Smith gegründeten Siedlung Nauvoo bestenfalls der Status einer autonomen Gemeinde zukam (Smith mußte sich ja der Jurisdiktion des Bezirksgerichts Hancock unterwerfen, was ihm schließlich das Leben kostete), erstreckte sich das Herrschaftsgebiet des Islam beim Tode Mohammeds auf die gesamte arabische Halbinsel. Gute eineinhalb Jahrhunderte später war den Arabern die Errichtung eines islamisch beherrschten Weltreichs zwischen Indien und Spanien gelungen.
»Die Leute«, sagte Matt Stone, einer der Macher des Musicals, in einem Radio-Interview, »fragten uns, ‚Habt Ihr keine Angst vor der Reaktion der Mormonen?’, Trey und ich meinten: ‚Die werden cool reagieren’. Und die Leute: ‚Werden sie nicht. Es wird Proteste geben’, und wir: ‚Nein. Die werden cool reagieren.’«19
Als Reaktion auf das Musical The Book of Mormon schaltete die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage folgende an das Publikum gerichtete Anzeige in den Programmheften der Theaterhäuser: »Sie haben das Stück gesehen, lesen Sie jetzt - das Buch.«
»Obama ist nicht schwarz«
[1] Debra Dickerson, Colorblind, Salon, 22. Januar 2007, http://www.salon.com/2007/01/22/obama_161/
[2] Marc Pitzke, US-Wahlkampf: Ist Barack Obama schwarz genug?, SPIEGEL ONLINE, 10. Februar 2007, http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahlkampf-ist-barack-obama-schwarz-genug-a-465571.html
[3] James Hannaham, Racists For Obama, Salon, 3. November 2008, http://www.salon.com/2008/11/03/racists_for_obama/
[4] Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Stuttgart 1977, S. 77
[5] Ebd. S. 149 f.
[6] Ebd. S. 131
[7] Ebd.
[8] Ebd. S. 156
[9] Ebd. S. 157
[10] Ebd. S. 146
[11] Moishe Postone, Nationalsozialismus und Antisemitismus, http://www.anarchismus.at/antifaschismus/faschismus-und-nationalsozialismus/367-postone-nationalsozialismus-und-antisemitismus
[12] Antisemitismus ist nicht gleich Rassismus. Interview mit Detlev Claussen, http://www.zag-berlin.de/antirassismus/archiv/39claussen.html
[13] Britta Waldschmidt-Nelson, Malcolm X. Der schwarze Revolutionär. Eine Biografie, München 2015, S. 14
[14] Karl Abraham, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen, Leipzig – Wien – Zürich 1924, S. 28 f.
[15] https://fa.wikipedia.org/wiki/ کاپیتولاسیون_در_ایران
[16] Ebd.
[17] Ebd.
[18] Sigmund Freud, Das Ich und das Es, Frankfurt 1992, S. 269
[19] http://www.npr.org/2011/05/19/136142322/book-of-mormon-creators-on-their-broadway-smash