Gerhard Scheits neustes Buch Im Ameisenstaat: Von Wagners Erlösung zu Badious Ereignis besticht dadurch, dass der Autor fast pedantisch auf der Differenz zwischen Begriff und Sache, in den Obertönen sozusagen, insistiert und dort oftmals ‚den Hebel‘ zur Kritik ansetzt, ohne jedoch das Thema, den Grundton, wenn man so will, zu ignorieren. Als Referenz- und Abstoßungspunkt der Abhandlung dient nicht zufällig Richard Wagner, dessen Kompositionen, aber auch literarische Tiraden, die Wende hin zur Moderne charakterisieren.
In Wagners Musikdramen wimmelt es von »Judenkarikaturen« (Adorno), die in seinen Figuren wie beispielsweise Mime in Siegfried oder Beckmesser in Die Meistersinger von Nürnberg verkörpert werden. Auch der einstige Wiener Komponist und Operndirektor Gustav Mahler, ein Verehrer Wagners Musik, erkannte die »leibhaftige, von Wagner gewollte Persiflage eines Juden« (9) insbesondere in der Figur des Mime. Dem Symphoniker Mahler gelang es, so Scheit, die »musik-dramatischen Charaktere Wagners in absolut-musikalische ‚Charaktere‘ zu transportieren.« (18) So hat Mahler in seinen ersten Symphonien »wirklich alle Möglichkeiten, die in Mime stecken« (20) realisieren können. Durch »Mahlers Symphonik« eröffne sich »zugleich die Möglichkeit einer Wagner-Deutung jenseits der ‚Judenkarikaturen‘.« (21)
Zwar hätte Mahler die »Sehnsucht nach Frieden mit dem Naturwesen« (22) aus Wagners Ring gelernt, doch Scheit erläutert eindrucksvoll, entlang der musikalischen Technik und Partitur, wie Mahler ein ganz anderes Verständnis von Natur musikalisch auszudrücken vermochte. Denn während bei Wagner die Beherrschung der Natur im Vordergrund stünde – und Adorno in diesem Zusammenhang das erste Mal in seiner Schrift Versuch über Wagner, worauf Scheit beinahe beiläufig hinweist, den Naturbegriff der Kritischen Theorie entfaltet –, zielt Mahler auf die Versöhnung mit ihr ab. Dass in Mahlers Spätwerk diese Versöhnung selbst wieder anders Darstellung findet, »jene erzwungene Versöhnung im Finale selbst noch zurückgenommen wird« (82), darauf weist der Autor ebenso geflissentlich hin.
Ganz anders als Mahler rezipierte der österreichische Philosoph Otto Weininger Wagners Werk. Wagners Parsifal sollte ihm nicht nur als Vorlage für Teile seines Buchs Geschlecht und Charakter dienen. Weininger, der dort seinen »explizierten Frauenhass mit antisemitischen Projektionen gleichsam untermauert« (25), hat sich aufs Äußerste mit der in Wagners Parsifal präsentierten Figur Kundry identifiziert, so dass ihm das selbe Schicksal der Selbstvernichtung wie Kundry ereilte. Am 4. Oktober 1903 erschoss sich Weininger in Beethovens Sterbehaus und er galt vielen damit als vom ‚jüdischen Selbsthass‘ erfüllt. Wobei, wie Scheit bemerkt: »Die Rede vom Selbsthass fixiert im Inneren des Judentums oder des einzelnen Juden, was in Wahrheit außerhalb entspringt. […] Wo Juden dem Druck der antisemitischen Gesellschaft nicht mehr standhalten können, dort entstehen Phantasmagorien wie die von Geschlecht und Charakter.« (26) Weiniger bloß als Antisemiten zu denunzieren, würde nach Scheit verkennen, dass das Buch zugleich auch eine Schrift »gegen den Antisemitismus, ja selbst gegen den ‚jüdischen Antisemiten‘« (27) darstelle.
Scheit konzentriert sich im Abschnitt über Weininger vor allem auf die sexualpathologischen Momente in dessen Werk und entschlüsselt sie mit Sigmund Freud. Weininger gilt die Sexualität als unrein, ‚das Weib‘ als Ausdruck der »Objektivation der männlichen Sexualität, die verkörperte Geschlechtlichkeit seiner Fleisch gewordenen Schuld.« (41) Indem der Autor den »desexualisierten Sexus« (Adorno) in den Fokus rückt, kommt er abermals auf Mahler zu sprechen, dem er attestiert, Ungeheureres in seinen Scherzi geschafft zu haben und damit den Kontrast zu Weiningers Reinheitsphantasien bildet. Denn dort lässt Mahler die »körperliche Berührung von Mann und Frau beim Tanzen« ausdrücklich zu; »der Rhythmus, der mehr oder weniger deutlich auf die gleichförmigen Bewegungen, auf das Aneinanderreiben, also das ‚Ficken‘, anspielt.« (78) »Was als das Schmutzige des Triebs empfunden wurde, aus dem Konzertsaal ausgegrenzt werden sollte und verleugnet wurde, kehrt hier zurück.« (79f.)
Im zweiten Teil des Essays konfrontiert der Autor Wagner mit Karl Marx. Im Gegensatz zu Wagner vermeidet Marx, der auch nicht von »Judenkarikaturen« absah, »jede Konkretisierung: jüdisch ist in seinem Verständnis das Profitmachen, aber nicht eine bestimmte Physiognomie, eine besondere Art zu reden oder sich zu bewegen.« (97f.) Während Wagners Aufsatz Das Judenthum in der Musik als »eine Art Einleitung zum modernen Antisemitismus« (102) gelesen werden könne, in dem er »das unbegriffene Unwesen des Geldes an jede einzelne von ihm idiosynkratisch modellierte Eigenschaft, an alle Einzelheiten der von ihm entworfenen Erscheinungen des Judentums« festmachen wolle, »sodass sie schließlich identifizierbar werden und die Vernichtung des Judentums auch die Vernichtung des Geldes« (102) suggeriert, unterlässt Marx gerade solche Identifikation. Hiervon ausgehend deutet Scheit Wagners Werk durch die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie hindurch neu.
Dadurch, dass Scheit immer wieder die Rezeptionen auf Wagner rückbezieht, ohne dass er sich scheut, Musik auf Philosophie (und umgekehrt) zu beziehen und ohne beide in einer Einheit ohne Differenz gleichmachen zu wollen, öffnet sich ein neuer Zugang zu Wagner, aber ebenso kann ein neues Bild von der Rezeption gewonnen werden, was Erkenntnis überhaupt erst zulässt. Hätte man für solche Denkbewegung noch keinen Begriff, man könnte sie glatt Dialektik taufen.
Dissonanz und Differenz
David Hellbrück rezensiert die neueste Veröffentlichung von Gerhard Scheit.
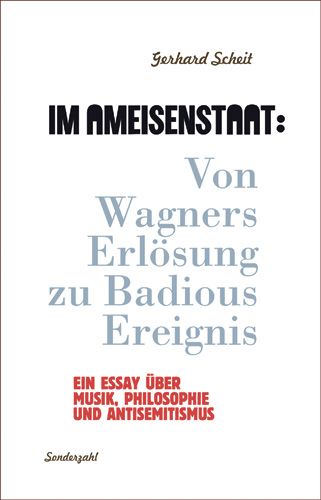
Gerhard Scheit: Im Ameisenstaat: Von Wagners Erlösung zu Badious Ereignis. Ein Essay über Musik, Philosophie und Antisemitismus. Sonderzahl, Wien 2017, 160 Seiten, 19,90 Euro.
