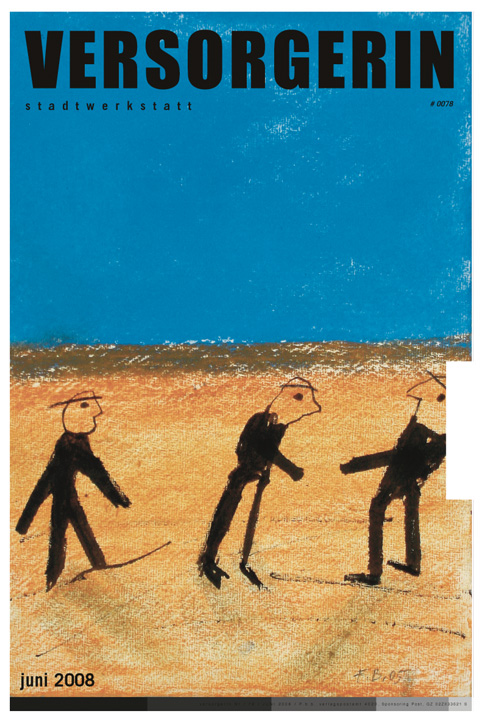Der Begriff »Öffentlichkeit« erscheint als eine etwas heikle Angelegenheit: Einerseits lässt sich deskriptiv darunter verstehen »alles, was nicht privat ist«, andererseits ist er normativ mit Erwartungen der Artikulation eines politischen Subjekts, eines genuinen politischen Willens der Beherrschten, verknüpft, zumindest für den kritischen Intellektuellen.
Das Thema »Öffentlichkeit« ist für mich wichtig, da ich selbst, ironisch gesagt, »ein Mann der Öffentlichkeit« bin. Das heißt, ich muss Interessen kultivieren, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind. »Öffentlichkeit« berührt mein Eigeninteresse. Beim Verfolgen meines Eigeninteresses merkte ich sofort, dass die Öffentlichkeit für den in der Öffentlichkeit agierenden Menschen so nicht existiert. Für den denkenden Menschen ist klar: Öffentlichkeit ist eine Konstruktion, ein Gedanke, eine Idee; aber wenn einer veröffentlichen möchte, dann tritt er, sagen wir, Agenten dieser Öffentlichkeit gegenüber, also Verlegern, Redaktionen, Institutionen wie z.B. Universitäten; was tun die alle? Sie hindern ihn, schleifen ihn zurecht, sie bringen ihm was bei, richten ihn zu. Am Ende eines langen Prozesses veröffentlichen sie ihn dann vielleicht.
Nun kann man die Idee der Öffentlichkeit nach bestimmten Prinzipien konzipieren. Ein Prinzip, das mir als, sagen wir, künstlerischen Menschen entsprechen würde, wäre nicht allein ein unzensuriertes, sondern ein unselektiertes Veröffentlichen von allem, also der Internet-Gedanke. Es wäre doch faszinierend, würde der »Spiegel« nicht den von ihm extra selektierten Gemeinsinn veröffentlichen, diese aufgeregten Banalitäten, würde er auf seine einheitliche Sprache verzichten, auf seine gut ausgewählten Redakteure, würde er alles veröffentlichen, alles von allen, dann würde er avantgardistisch sein – amorph werden – und leider ein schlechtes Geschäft.
Unter dem Vorzeichen einer gewissen Verfallsrhetorik glaubt man heute, eben in Anlehnung an die Möglichkeiten des Internet, Verschiebungen hinsichtlich traditioneller Grenzen zwischen Öffentlich und Privat konstatieren zu können, die Schamgrenzen, Privates zu einer öffentlichen Sache zu machen, scheinen niedriger zu werden. Wenn man sagt, dass man sich in der Öffentlichkeit der Vergangenheit über – artifizielle – bürgerliche Masken bewegt hätte, so könnte man im Hinblick auf Internet, Fernsehformate oder auch zeitgenössische Erscheinungen in der Literatur, befinden, dass heute ein großes Bedürfnis nach Authentizität vorherrschend erscheint.
Diesem Theorem gegenüber bin ich sehr skeptisch. Ich denke, dass man Verschiebungen im Rahmen des gesellschaftlichen Gefüges allzu schnell mit der Etikette einer Totalveränderung qualifizieren möchte. Ich behaupte, wenn es überhaupt etwas Privates gibt, dann kann man es als solches durch Veröffentlichen niemals ganz aufheben. Das heißt, wenn ich meinen schönen, nackten Körper veröffentlichen möchte – auf YouTube oder in der Kronenzeitung auf Seite 3 – bleibt dieser Körper (m)ein Körper im Umgang mit mir selbst und meinen Nächsten. Die Veröffentlichung meines Körpers nimmt mir die Intimität meines Umgangs mit ihm nur zum Schein und nur eine Zeit lang weg. Die Plausibilität, die mein Körper im privaten und im intimen Umgang hat, kann zwar durch Veröffentlichung beschädigt, aber nicht beseitigt werden. Denken Sie an Bärbel Schäfer und Michel Friedman, an diese Prominenz des Grauens, die naturgemäß fürs Fernsehen arbeitet: »Sohn Samuel kam 2005 zur Welt - zuvor hatte Gatte Michel Friedman einige Fehltritte begangen, für die er sich öffentlich bei Schäfer entschuldigte.« Die Fehltritte bestanden darin, dass er zusammen mit ein paar Huren Kokain zu sich nahm, wovon die Welt erfuhr. Und dennoch hat Bärbel Schäfer ihn genommen, und gewiss doch deshalb, weil sie hat glauben können, dass dieser kokainschnupfende Hurenkonsument, als der er öffentlich fixiert wurde, privat ein Anderer, ein ganz Anderer sein muss. Selbst der entlarvteste Verbrecher, dessen Kellerverliese vor den tränenden Augen der Öffentlichkeit offen liegen, ist in seiner Zelle mit sich allein, und man kann sogar sagen, dass das Veröffentlichen seiner Taten seine Einsamkeit steigert.
Aber, dass es Veränderungen gibt im Verhältnis Privat und Öffentlich, ist unvermeidbar und geht tautologisch daraus hervor, dass die Gesellschaft sich verändert; die Konstellation Privat/Öffentlich ist einer der Indikatoren für gesellschaftliche Veränderungen. Die klassische bürgerliche Privatheit: Der Verfüger über die Produktionsmittel in seiner Villa ist eine andere Art von Privatheit als die des Managers, der, siehe Karl-Heinz Grasser, die Öffentlichkeit seinerzeit zu Reklamezwecken benötigte und sie daher mit seinem Privatleben voll stopfen musste.
Ein Indikator für welche gesellschaftlichen Veränderungen?
Bedenken Sie, wenn eine Politik der Geheimkabinette gemacht wird, wenn Politik prinzipiell ihre Absichten geheim hält, ist das eine völlig andere Gesellschaft als eine, in der die Politik öffentlich legitimieren muss, was sie zu tun beabsichtigt. Im ersten Fall agiert die Politik rein politisch, also jenseits eines Marktes. In einer Gesellschaft hingegen, in der die Politik ihre Absichten veröffentlichen muss, teilweise auch, um sie überhaupt durchzusetzen, existiert ein Markt für Politik und Politik als Ware. Die Ware kriegt man nur an, wenn man für sie Reklame macht. In unserer Gesellschaft ist Politik medial vermischt, und was politisch präsentiert wird und was geheim bleibt, folgt einer Mischung aus medialer und politischer Logik. Politik muss verkauft werden, weshalb die Herrschaften, die Politik machen, im Übrigen nicht selten sagen »Unsere Politik ist gut, wir haben sie nur schlecht verkauft.«
Im Allgemeinen nimmt man aber einen weit gehenden Kompetenzverlust der nationalen Politik gegenüber den privaten Interessen eines global agierenden Kapitals sowie im Hinblick der Herausbildung von Formen von »Governance« als internationaler Leitlinien von Politik und Regierungsführung wahr, sodass im Angesicht dessen die Profile der traditionellen politischen Parteien immer ähnlicher erscheinen, und man den Eindruck hat, die Ware Politik definiert sich immer mehr über Verpackung als über Substanz - wozu auch zählt, dass einige Politiker immer schamloser Aspekte ihres Privatlebens zu ins-zenatorischen Zwecken öffentlich verbraten.
Das ist meiner Meinung nach falsch, die These ist jedoch brauchbar, da man sich mit Gewinn fragen kann: Stimmt das, oder stimmt das nicht? Ich behaupte, das Problem ist keineswegs ein Abdanken der Politik. Das Problem ist, dass es ein Zusammenspiel zwischen Politik und Ökonomie gibt; ein Zusammenspiel, welches manchmal ganz offenkundig erscheint, wie zum Beispiel im Fall der Familie Bush, das aber in den meisten Fällen unterschwellig und selten mit einer solchen Öffentlichkeit funktioniert wie bei dem texanischen Familienbetrieb. Die Politik hat im Lauf der Jahrhunderte gelernt, dass sie ohne ökonomische Erfolge nicht legitimierbar ist. Das bedeutet naturgemäß den Triumph der Politischen Ökonomie, aber anders, als Marx »Politische Ökonomie« konzipiert hat: In einem kapitalistischen System kann und will Politik es sich nicht leisten, gegen die Ökonomie zu agieren, und umgekehrt gibt es keine Führungsgestalt in der Wirtschaft, die sich nicht mit der Politik eventuell was aushandeln möchte, zum Beispiel Zugänge zu neuen Gebieten, siehe österreichische Banken in Osteuropa. Ökonomie vermittelt Politik und Politik vermittelt Ökonomie, und jede dieser Fraktionen versucht, Vorteile für sich heraus zu schlagen und, wie man von Marx lernen kann: Die Ökonomie sitzt am stärkeren Ast und alle hängen über dem Abgrund in der Luft.
Öffentlichkeit konstituiert sich praktisch über eine Vielzahl von Teilöffentlichkeiten. Unter diesen befinden sich auch sich als solche begreifende und aus diesem Verständnis einen Teil ihrer Energie beziehende Gegenöffentlichkeiten, die sich gegen einen als herrschend und allgemein empfundenen Konsens stellen. Was können die damit erreichen?
Gerade in einem kapitalistischen System, das einen hohen Konsenszwang erzeugt, zum Beispiel über den Verkauf der Arbeitskraft oder der Angst, diese nicht anzubringen, kann gesagt werden, dass in diesem System der Wunsch nach Gegenöffentlichkeiten sehr groß ist. So ein System hat - in unseren Breiten - den Trick heraus, einerseits Druck zu machen, anderseits Entspannungen zu ermöglichen, also Freiheiten dem Individuum zu gewähren, die traumhaft sind. Daher sind - außer in revolutionären Situationen oder am Beginn des Entstehens revolutionärer Situationen - solche Gegenöffentlichkeiten immer auch system-immanent. Die besten Schreiber werden abgesaugt und kommen in die größten Zeitungen, die besten Demonstranten bekommen einen Job in der Werbung, wo sie ja auch auf die Massen zugehen, die größten Idealisten werden eines Besseren belehrt und stehen dafür, dass sie plötzlich genau wissen, wo’s lang geht. Das ist die alles verkehrende Macht des Geldes. Linke werden Rechte, aber Rechte niemals Linke, und Gegen-Öffentlichkeiten blitzen nur für Momente auf, die ich nicht missen möchte. Im Augenblick erscheint es mir aber als Illusion, dass gewährte Freiheiten in irgendein absolutes Gegen, in einen Umsturz des Systems (oder auch nur in eine halbwegs präzise Vorstellung eines solchen Umsturzes) münden könnten.
Die Hegemonie des Neoliberalismus scheint jedoch trotzdem ihren Zenit überschritten zu haben. Wird eine mögliche Transformation des Neoliberalismus in ein anderes Regulationsmodell aufgrund einer passiven Revolution erfolgen, oder werden die kritischen Gegenöffentlichkeiten federführend sein?
Ich bin Literat und kein Soziologe, aber radikale gesellschaftliche Veränderungen scheinen mir immer aus einer unerwarteten Ecke zu kommen. Sie beziehen nicht zuletzt ihr umwälzendes Potenzial daraus, dass sie überraschend sind. Also lassen wir uns überraschen.
»Gegen-Öffentlichkeiten blitzen nur für Momente auf«
Philip Hautmann im Gespräch mit dem Publizisten Franz Schuh über »Öffentlichkeit«
Dr. Franz Schuh, Jg. 1947, ist Literat und Geistesarbeiter und lebt in Wien. Zuletzt von ihm veröffentlicht: »Hilfe! Ein Versuch zur Güte« und »Memoiren. Ein Interview gegen mich selbst«, beide erschienen im Zsolnay Verlag, 2008.