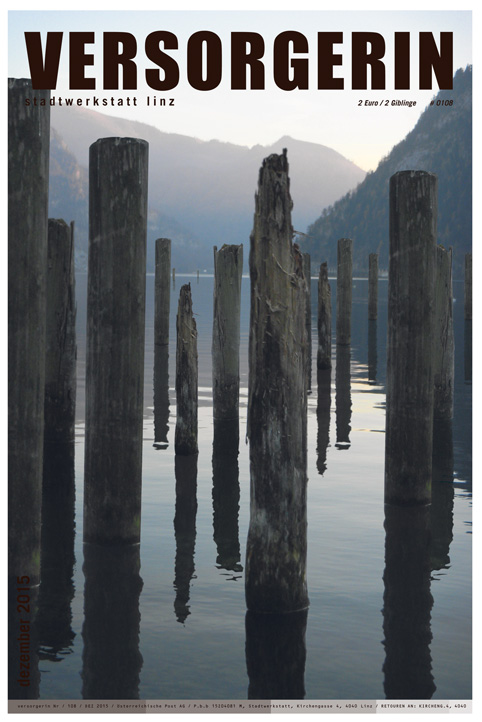Seit einiger Zeit wird zunehmend die Praxis kritisiert, transsexuelle Rollen im Film nicht mit transsexuellen, sondern sogenannten cissexuellen Schauspielern zu besetzen. In Anlehnung an den Begriff »Blackface« wird der Gegenstand des Unmuts als »Transface« gefasst. Maßgeblichen Aufschwung bekam diese Debatte 2013 im Zuge der Oscarverleihung an Jared Leto für seine Verkörperung der transsexuellen Rayon in Dallas Buyers Club. Hier wurde kritisiert, dass eine Transsexuelle durch einen Mann dargestellt wurde, wobei sich die Kritik keineswegs an ästhetische, sondern ausschließlich an aktivistische Maßstäbe hielt. Das Online-Magazin »Buzzfeed«[1] unterzog die betreffenden Mainstreamfilme einer schablonenhaften Analyse. Der Auflistung kann man schließlich eine implizite Rangfolge entnehmen: Das Ideal besteht in der Darstellung transsexueller Rollen durch transsexuelle Schauspieler; als möglicher Kompromiss wird eventuell noch zähneknirschend toleriert, wenn eine fiktive Transsexuelle durch eine Frau sowie vice versa verkörpert wird; und komplett abzulehnen sei schließlich die Darstellung einer Transfrau durch einen Mann und das dazugehörende Pendant. Die Kritik von der hier ausgegangen werden soll, ist jedoch vor allem die »kompromisslose« und deren Moral, dass eben nur eine Transsexuelle eine Transsexuelle darstellen dürfe. Damit ist man bei der in den einschlägigen Kreisen gefeierte transsexuelle Schauspielerin und Aktivistin Laverne Cox angelangt. Diese verkündete anlässlich ihrer Emmy-Nominierung über ihre Erwartungen an Filme: »I want to see myself. I want to turn on the television and see people who look like me who have similar experiences that I have.«[2]
Der Film ist mehr noch als das Theater eine maßgeblich visuelle Kunstform, deren technische Traditionslinie von der Malerei über die Photographie zum Stummfilm verläuft. Diese Entwicklung der Fähigkeit zur Verdopplung des visuellen Eindrucks brachte einen Fetisch des Details hervor, der die Vorstellung von Authentizität stark getroffen hat. Davon ausgehend hatte sich schon Walter Benjamin arg vergaloppiert, als er in seinem wohl bekanntesten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, der sich neben äußerst scharfen Beobachtungen, vor allem auch durch überaus absurde Deutungen auszeichnet, am Beispiel des Schrifttums und besonders dem Aufkommen der Presse eine Tendenz skizzierte, in der die Zahl der Schreibenden stetig zunimmt: »Damit ist die Unterscheidung zwischen Autor und Publikum im Begriff, ihren grundsätzlichen Charakter zu verlieren.«[3] Hier liegt sowohl der Wahrheits- als auch der Zeitkern des von Roland Barthes und Michel Foucault verkündeten »Tod des Autors«. Allen den Genannten gemein ist, dass sie in dieser Entwicklung etwas zu Begrüßendes erkennen wollten. Mit Blick auf den sich entfaltenden Film meinte Benjamin nun: »Jeder heutige Mensch kann einen Anspruch vorbringen, gefilmt zu werden.«[4] In revolutionärer Manier kritisiert er dies nicht, sondern rechtfertigt es: »Ein Teil der im russischen Film begegnenden Darsteller sind nicht Darsteller in unserem Sinn, sondern Leute die sich – und zwar in erster Linie in ihrem Arbeitsprozess – darstellen. In Westeuropa verbietet die kapitalistische Ausbeutung des Films dem legitimen Anspruch, den der heutige Mensch auf sein Reproduziertwerden hat, die Berücksichtigung.«[5] Auch Benjamin ging es somit darum, dass jeder sich selbst sehen könne. In grober Verkennung des sowjetischen Staatskapitalismus ist dieses Selbst die Reduktion des Arbeiters auf eine Ware, deren Träger er eigentlich nur ist: Arbeitskraft, die als irgendeine konkrete Arbeit angewandt wird. Der Mensch ist somit dargestellt als Warenexemplar, das er in der Realität glücklicherweise nie ganz ist.
Wurden die Gattungen bei den Sowjets noch durch Berufsgruppen gebildet, sind es heute Ethno-, Geschlechts- oder Sexualitätsidentitäten und deren Repräsentanten, die wie Markenlabel gehandhabt werden. Die Rolle ist also die Darstellung einer personalisierten Funktion – Marx nannte es Charaktermaske – und weitergehend sogar die Verdinglichung dieser Personalisierung: »Wenn der Schauspieler zum Requisit wird, so fungiert auf der anderen Seite das Requisit nicht selten als Schauspieler.«[6] Was hier begrüßt wird, ist schlicht das Erscheinen des Fetischcharakters der Ware in der Kunst. Vor allem Oscar Wilde und Karl Kraus haben mit ihren Idiosynkrasien gegen die Presse bzw. den Journalismus – welche ihnen meist als elitäre Züge ausgelegt wurden – genau jene Tendenz vorausschauend attackiert. In der Ära der entfalteten Kulturindustrie haben Blogs, Bewertungsplattformen und Kommentarfunktionen schließlich wirklich jeglichen Unterschied sowohl zwischen Künstler und Publikum als auch zwischen Kritiker und Publikum kassiert: »Im Kino fallen kritische und genießende Haltung des Publikums zusammen.«[7] Der quantitative Fortschritt – als Emanzipation zur Schrift – ging und geht einher mit einer zunehmenden qualitativen Regression, die ebenfalls in der Rezeption zu beobachten ist. Gerade im Massenpublikum ist die Fähigkeit zur Kontemplation eliminiert: »Dagegen versenkt die zerstreute Masse ihrerseits das Kunstwerk in sich.«[8] Dabei wird die Kunst heute im bisher schlimmstmöglichen Sinne populär. Prägnantestes Beispiel ist Erika Leonards »Fifty Shades of Grey«, das sich mittlerweile um die 100 Millionen Mal verkauft hat. Das Werk wurde ursprünglich als fan fiction im Internet veröffentlicht und hat den Begriff auch gleich zur vollen Geltung gebracht, indem Leonard sämtliche Kommentare und Kritiken vor der Veröffentlichung der Buchform einarbeitete, wodurch die Trilogie zu einem guten Teil von dem eigenen Publikum mitverfasst wurde.
Das Bedürfnis, die Welt und sich selbst zum Zeichen zu machen, also das Verlangen nach »Sichtbarkeit« als Symptom zu deuten, verlangt danach, das Optische des psychoanalytischen Unbewussten ernst zu nehmen. Dabei kann man sich hier von zweierlei Seiten nähern: vom Schauspieler oder vom Publikum. Psychoanalytisch betrachtet sind dies jedoch nur die ambivalenten Seiten derselben Medaille. Es handelt sich um den Schau- und den Zeigetrieb oder anders ausgedrückt um Voyeurismus und Exhibitionismus. Beide sind sexuelle Partialtriebe, die einen wesentlichen Bestandteil der Vorlust darstellen. Gerade der Exhibitionismus lässt sich in den männlichen, auf das Genital fixierte, und den weiblichen, unter Aussparung der Fixierung auf den gesamten Körper verschobenen Zeigetrieb unterscheiden. Letzterer wird als ‚sublimierter‘ wesentlich eher gesellschaftlich geduldet und gilt in den meisten Fällen nicht als ‚pervers‘. Davon ausgehend, dass »jede Sublimierung des Exhibitionismus etwas Feminines hat«, erklärt sich Otto Fenichel die Tatsache, dass »die Kunst der Schauspielerei im allgemeinen als feminin betrachtet wird.«[9] Zum männlich charakterisierten zurückkehrend beschreibt er weiter, dass hier »erogene Lust und die narzisstische Befriedigung, ein Publikum zu haben, nicht miteinander verdichtet sind, sie sind ein und dasselbe. Die sexuelle Lust des Exhibitionisten besteht darin, den Zuschauer zur Befriedigung seiner eigenen narzisstischen Bedürfnisse zu verwenden.«[10] Der sublimierte Zeigetrieb ist jedoch ein entsexualisierter und somit »fehlt die erogene Lust, aber die narzisstische bleibt erhalten.«[11] Befriedigung findet der Schauspieler durch den Applaus sowie die magieähnliche Beeinflussung des Publikums – in beiden Fällen instrumentalisiert er die Zuschauer. Nicht umsonst sind seine Vorfahren die Priester, welche durch Darbietungen die Gläubigen zu beeinflussen versuchten. Die niemals gänzlich unterdrückte sexuelle Erregung darf im Schauspiel niemals zu stark durchdringen, da sie das Spiel andernfalls gefährden würde. Schauspielerei ist also eine grundlegend narzisstische Form der Vorlust, die bei sich verweilt bzw. durch das Publikum zu sich zurückkehrt. In diesem Sinne sind einem auch Kriterien gegeben, mit denen sich eine gute von einer schlechten Darstellung unterscheiden lässt, wobei die Frage der Authentizität tatsächlich eine wichtige Bedeutung hat. Bernd Stegemann hat vor einiger Zeit kurz auf den Punkt gebracht: »Authentizität ist das gelungene Spiel des erzwungenen Lügens.« Der Doppelcharakter des Schauspielers besteht darin, dass er einerseits eine Rolle spielt, sich also nicht selbst darstellt, sondern maskiert. Andererseits: »Ein guter Schauspieler offenbart in der Tat sich selbst. Er kann keine Emotionen spielen, die er nicht selbst erfahren hat. Der gute Schauspieler glaubt, dass er seine Rolle spielt. In Wirklichkeit spielt er sich selbst.«[12] Keineswegs kommt dies nun aber der Forderung von Laverne Cox nach »similar experiences« entgegen. Um Trauer oder Glück anlässlich einer fiktiven Situation darstellen zu können, müssen jene Gefühle irgendwann erfahren worden sein, ohne dass die Situation real und deckungsgleich erlebt worden sein muss. Schauspiel ist also eine fiktive Identifikation: »Gewiss spielt ein Schauspieler sich nicht so, wie er ist, sondern so, wie er sich unter anderen Bedingungen hätte entwickeln könne.«[13] Diese Identifikation im Konjunktiv verlangt dabei viel eher nach einer gewissen Distanz als nach unmittelbarer Nähe zu dem konkret Dargestellten. Es sind Emotionen auf Probe, denn nur demjenigen, der weiß, dass er eine Rolle beizeiten wieder verlassen oder aufgeben kann, ist es möglich, sich mit Haut und Haar in dieser zu versenken und sie trotzdem zu meistern. Fallen Lebensumstände von Schauspieler und Charakter zu sehr in eins, »dann vermag er diese Rolle nicht länger erfolgreich zu spielen. Er sieht sich dann der unmittelbaren Notwendigkeit konfrontiert, seine Emotionen weiter zu verdrängen, und wird unfähig, sie schauspielerisch darzustellen.«[14] Eine gute schauspielerische Darstellung besteht darin, das Publikum unbewusst zur Identifikation zu verleiten und das größtenteils visuell Dargestellte auf emotionaler Ebene wirklich mitempfinden zu lassen. Doch diese quasi magische Manipulation darf niemals zu offensichtlich werden, muss unabsichtlich sein, um überhaupt in Tiefenschichten zu wirken. Dies ist der einzige Garant für das bewusste Ziel des Aktes – die Lustprämie im direkten Applaus, der im Film schon nur noch über Einspielergebnisse vermittelt wird. Für das Theater ließe sich annehmen, dass die Nähe zum Publikum viel eher gegeben ist als in dem durch die Kamera und Leinwand überlieferten Film. Bei letzterem ist es schließlich das traurige Los der Darsteller, dass der Ort und die Zeit des Drehs mit den Vorführungen weit auseinanderklaffen. Der Filmdarsteller spielt direkt nur für den Regisseur. Ein Spielen mit dem Publikum in Form des Reagierens auf dessen Regungen ist somit unmöglich. Das Theater war immer auch vielmehr ein Spielen gegen als für das Publikum, da letzteres nur das notwendige Mittel für den befriedigenden Applaus darstellte, »wenn nötig selbst um den Preis der Vernichtung oder der ‚Kastration‘ des Publikums.«[15] Die Entschädigung des Filmschauspielers für den mangelnden direkten Applaus besteht nun darin, dass er selbst zumindest potenziell bei der Filmpremiere anwesend ist. Was vorher sowohl räumlich als auch zeitlich getrennt war, fällt nun komplett zusammen: Er wird sein eigener Zuschauer und Teil seines eigenen Publikums: He can see himself. Der Filmdarsteller spielt – vorausahnend – schon aus dem Publikum. Da er in erster Linie bzw. in subjektiver Hinsicht für sich spielt, spielt er nun also notwendig für das Publikum, dessen Teil er ist. Im Theater wird der Narzissmus nur vermittelt über den Applaus befriedigt. Der Film hingegen löst das tragische Schicksal der namensgebenden Figur tatsächlich ein: Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte, das er in einem Bach erblickte, und schließlich entweder vor diesem verhungerte oder nach einer anderen Variante in selbiges Wasser stürzte und ertrank. Dieser Narzissmus des Sich-selbst-sehens, war im Theater nie möglich; wie auch die Stimme nicht mehr nur als Echo zurückhallt, sondern gefühlt aus fremden Munde vernommen wird und doch nur Selbstgespräch ist. Im Endeffekt wird der Exhibitionist in und mit dem Publikum zu seinem eigenem Voyeur.
Der Schautrieb des Voyeurismus steht vor allem im Zusammenhang mit der orale Phase. Dieser Charakter der okularen Einverleibung kommt in dem Wunsch, etwas »mit den Augen zu verschlingen«, deutlich zum Ausdruck. Das Schauen ist in dem hier vorliegenden Fall, wie man an der energischen Debatte über das Transface sehen kann, extrem libidinös besetzt. Es wird krampfhaftes Starren und erinnert an den magischen Blick. Dieser ist als aktiver Bildzauber oder passiver Blick- oder Sehzauber so ziemlich die weltweit verbreitetste Erscheinung magischen Denkens. Des Weiteren ist das Auge psychoanalytisch betrachtet ein bisexuelles Organ. Der durch dieses geworfene Blick formt das Angesehene oder aber Eigenschaften des Angesehenen gehen auf den Blickenden über. Beides kommt im göttlichen »Du sollst dir kein Bild machen!« zum Ausdruck. Das Bilderverbot richtete sich grundlegend gegen bestehende magische Vorstellungen. Wenn das Bilderverbot ein Verbot der Gottesnachahmung meint, wäre zu klären, was dann dies Gebot bzw. der Befehl der Aktivisten, sie anzustarren, bedeutet. So manch einer wird ähnliches kennen, nämlich das elterliche oder vor allem väterliche »Schau mich gefälligst an, wenn ich mit Dir rede!« Wie auch der Vater umso roher wird, je schwächer seine reelle Macht, zeigt sich hier ebenso die Brüchigkeit der Identität derer, die sich als Autorität einzusetzen versuchen. Der strenge bannende Blick findet sein Gegenüber im kindlichen Erstarren. Problematisch ist nur, dass die Aktivisten im Gegensatz zu manchen Eltern überhaupt nichts zu vermitteln haben, für das es sich lohnen würde, sich auf sie zu konzentrieren. Im Mythos versinnbildlicht der Kopf der Medusa, deren Anblick jeden zu Stein erstarren lässt, die Kastrationsangst. Etwas abstrahierend kann man also sagen, dass die Forderung des Anschauens maßgeblich damit verbunden ist, Andere auf ihren Platz zu verweisen und in ihrer Identität festzulegen. Die Verwandlung in Stein und die Blendung sind die beiden häufigsten Strafen des Voyeurs und kehren hier wieder als Verbote, die eigene Identität zu überschreiten oder Kritik zu üben, die in einer Darstellung mehr erkennen oder sehen möchte als Agitation. In Zeiten, in denen sich die Geschlechterrollen maßgeblich in Auflösung befinden, wird es für zahlreiche Transsexuelle zunehmend schwieriger, die notwendige Distinktionsleistung zu erbringen. In der Kunst, in der die Überschreitung von einheitlichen Identitäten maßgeblich forciert wurde, verhärten sich nun die Fronten – mit dem absurden Ergebnis, dass queere Aktivisten fordern, dass Männer gefälligst Männer und Frauen Frauen zu sein haben. Die begründete Angst der meisten Darstellern vor einer Rollen- oder Charakterfixierung wird hier forciert, und der Schauspieler selbstverschuldet und -gewollt zu jener steinernen Skulptur, als die Benjamin ihn schon beschrieb, zur Requisite oder zur Marke seines Grüppchens. Seine Anhimmelung ist Götzendienst – Fetischismus im klassischen Sinne. Er muss der Glaubensgemeinschaft konkret nützen, um als Mittel zum Zweck gefeiert zu werden. Als Totem hat er die Verwandtschaft zu symbolisieren und Gemeinsamkeiten zu suggerieren, die die Vereinzelung übertünchen und darüber hinwegtäuschen müssen, wie wenig man sich eigentlich zu sagen hat. Angestrebt wird Identifizierung statt Objektwahl, also sich bzw. ein Äquivalent seiner selbst auf der Leinwand zu sehen, statt irgendjemand anderen, vielleicht jemand Begehrenswertes oder auch Abstoßenden. In sich versenkt das aktivistische Publikum nicht das Kunstwerk, sondern ausschließlich einen aus ihren Reihen. Jener wird als Ich-Ideal eingesetzt. So wie sie sind, sind sie sich ideales Vorbild und können sich deshalb wunderbar einander ihrer Identität vergewissern. Freud unterschied die Objektwahl nach dem narzisstischen Typus folgendermaßen: »a) was man selbst ist (sich selbst), b) was man selbst war, c) was man selbst sein möchte (...)«.[16] In einem Artikel zu der Thematik ist dies alles enthalten: »Denn, so der Tenor der Transgemeinde, Transfrauen seien Frauen, Transmänner seien Männer, das Casten von Männern für Transfrauenrollen beziehungsweise von Frauen für Transmännerrollen sei diskriminierend.«[17] Ausgesprochen ist, was man war, gleichzeitig nicht sein wollte und nie wieder sein will, wie auch das, was man eigentlich gerne sein würde. Jedoch erscheint hier der Wunsch als Tatsache. Die Ahnung, dass dies nicht ganz der Realität entspricht, kommt dann auch schnell zum Ausdruck: »Wenn es nach uns ginge, würden Transcharaktere von Transschauspielern dargestellt, genau wie afroamerikanische und asiatische Charaktere von afroamerikanischen und asiatischen Schauspielern dargestellt werden.«[18] So sieht es schließlich aus, wenn der Traum von der Realität eingeholt wird. Jedoch gibt es mindestens einen feinen Unterschied, der in der reflexhaften Kritik der Gleichsetzung eklatant verkannt wird, nämlich dass das mit dem »Transfrauen sind Frauen« so ganz einfach nicht ist. Die Kritik am Transface tut vor allem denen Unrecht, die durch sie scheinbar verteidigt werden. Denn nicht alle Transsexuelle haben es sich in ihrer momentanen »Identität« so dermaßen eingerichtet, wie die betreffenden Aktivisten. Um es einmal im Vokabular der Szene zu versuchen: Für Transfrauen wird mit den Cisfrauen der wünschende Traum nach Überschreitung des eigenen Selbst und mit den Cistypen der leidvolle Albtraum des Scheiterns verbannt. Dieser Bruch in der individuellen Geschichte, der über die gesellschaftlich durchschnittlichen biographischen Zäsuren hinausgeht, ist ja gerade das »Besondere« von Trans-Charakteren und stellt zusätzliche Herausforderung an deren Darstellung. Das Präfix Trans- (hinüber, auf die andere Seite) verdeutlicht ja schon die gesteigerte Prozesshaftigkeit der Rolle – im Gegensatz zur Intersexualität (zwischen, mitten). Da einer selbst als Transsexuellen die »authentische Weiblichkeit« bzw. das »Passing« ofmals nicht abgenommen wird, bleibt dem Strafbedürfnis nur, anderen anzutun, was man selbst erfährt. Diese »kompromisslose Kritik« verdrängt das eigene Scheitern und beruht auf projektiver Eifersucht sowie der Abwehr eigener Wünsche und Ängste, die in den Anderen verlegt werden. Die psychische, innere Zensur der eigenen Versagungen wird zu einer ideologischen, äußeren Verurteilung all jener, die den eigenen Wunsch oder das eigene Leid verkörpern. Die individuelle Geschichte, die in den meisten Fällen tatsächlich sehr leidvoll ist, soll selbst in der Fiktion ausgelöscht und stellvertretend die Schauspielerin ihrer Rolle geopfert werden, als würde diese Realitätsverleugnung irgendetwas ändern. Kunstverachtung offenbart sich hier als Menschenverachtung. Gewisse Filme, wie Xavier Dolans Laurence Anyways oder Pedro Almodóvars Todo sobre mi madre, haben dagegen recht anschaulich gezeigt, wie sehr man die eigene Vorgeschichte und biographische Prägung mitschleift und sich von dieser nicht einfach wegdefinieren kann – auch bzw. gerade als Transsexuelle: »Wie kann man so ein Macho sein, wenn man so prächtige Titten hat?«
Jene aktivistische Vorstellung einer Doppelrolle, also der Trugschluss, dass es einen klaren Bruch gebe, nach dem alles anders sei, ist gerade ein Grund, warum zahlreiche Darstellungen zum Teil wirklich unglaubwürdig daherkommen. Statt aus dem Theater zu lernen, hat der Film sich größtenteils dem Detailfetisch der Fotografie überlassen und bezahlt nun dafür, nicht zuletzt mit Kritikversuchen, wie dem geschilderten. Jeder hat heute ein Recht auf die Reproduktion der eigenen Oberfläche und dieses Recht wird zunehmend eingeklagt. Die Phrase von der Kunst und speziell dem Film als Spiegel der Gesellschaft realisiert sich als detaillierter Teil des universellen Verblendungszusammenhangs. Dagegen war das Theater einige Zeit noch einer der wenigen Orte, an dem nicht nur Geschlechter-, sondern alle erdenklichen Wechsel sehr kunstvoll inszeniert wurden. Doch auch hier regt sich bekanntlich Kritik. In Prousts À la recherche du temps perdu beweist der Erzähler Marcel seine krude Wahrnehmung, indem er seine Geliebte Albertine aus jeder Perspektive als eine andere betrachtet, dabei aber vor allem versucht, sie in seiner Lieblingsperspektive zu fixieren. Indem er sie auch sonst zu überwachen und zu kontrollieren versucht, hebt er nur noch praktisch hervor, dass ihm seine Perspektive wichtiger ist als der wirkliche Mensch. Engagierte Kunstwerke und kontrollierende Liebschaften widersprechen sich selbst in ihrem Charakter als Kunst und Liebe, da beiden immer auch ein Zug der Zweckfreiheit anhängen muss, um sich ihnen überlassen zu können. Aber die Ästhetikfeindschaft – wohlgemerkt nicht der Transgendergemeinde, sondern eines kleinen Teils, sich mit Vertretungsanspruch versehender Aktivisten – zeigte sich jetzt auch in Glasgow, wo Drag Queens von der dortigen Pride Parade verbannt wurden, da sie durch ihr Auftreten Transexuelle beleidigen oder verletzen könnten.[19] Dabei erkannte bereits der von Benjamin verehrte Baudelaire den ästhetischen Gegensatz von Positivismus und Realismus im emphatischen Sinne: »Der Maler zeigt immer mehr Neigung, zu malen, was er sieht, und nicht, was er träumt.«[20]
Das gelungene Spiel des erzwungenen Lügens
[1] http://www.buzzfeed.com/rafeposey/21-times-cisgender-actors-played-transgender-characters#.qhM3RPzr8
[2] Zitiert nach: http://time.com/2973497/laverne-cox-emmy/ (Hervorh. d. Verf.)
[3] Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp 2010. S. 47
[4] Ebd. S. 46
[5] Ebd. S. 49f. Hrvhb. i.O.
[6] Ebd. S. 41
[7] Ebd. S. 55
[8] Ebd. S. 70
[9] Fenichel: Über die Schauspielkunst. In: Ders.: Aufsätze Band 2, S. 391
[10] Ebd.S. 393
[11] Ebd.
[12] Ebd. S. 395
[13] Ebd.
[14] Ebd. S. 397
[15] Ebd. S. 402
[16] Freud: Zur Einführung in den Narzissmus. In: dersl: Das Ich und das Es. Fischer 2009. S. 66
[17] Sarah Pines: Transforming Hollywood. Jungle World Nr. 51, 18. Dezember 2014 (Hervorh. d. Verf)
[18] Ebd.
[19] http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/drag-queens-banned-from-performing-at-free-pride-glasgow-event-over-fears-acts-will-offend-trans-10405214.html
[20] Charles Baudelaire, Die Fotografie und das moderne Publikum, In: Theorie der Fotografie I . (Hervorh. d. Verf .)