Es ist ein Satz von eindringlicher Einfachheit, mit dem Alba de Céspedes ihren als Tagebuch konzipierten Roman »Das verbotene Notizbuch« beginnt: »Es war ein Fehler, dieses Heft zu kaufen, ein schlimmer Fehler«, notiert Valeria vierzehn Tage nach dessen Kauf in ebenjenes Heft, das ihr fortan als Tagebuch dient. Ihr erster Eintrag, der zunächst nur ihre Schuldgefühle für ihre Familie zum Ausdruck bringt, die sie seit dem Kauf plagen, kündigt schon ein Unheil an, das Valeria durch das Schreiben heraufbeschwört. Denn verboten ist das Notizbuch nicht bloß, weil sie es an einem Sonntag in einem Tabakladen kauft und an einem Polizisten vorbeischmuggeln muss, der darüber wacht, dass am Tag des Herrn – eigentlich möchte sie Zigaretten für ihren Mann kaufen – nur Tabak verkauft wird, sondern vor allem, weil ihr als Ehefrau, Mutter und Büroangestellte zu Beginn der fünfziger Jahre die Freiheit des Schreibens eigentlich versagt ist.
Valeria, 43 Jahre alt, lebt mit ihrem Ehemann Michele, mit dem sie seit 23 Jahren verheiratet ist, sowie ihren Kindern Riccardo und Mirella, die beide Jura studieren, in kleinbürgerlich einfachen Verhältnissen in Rom. Das Einkommen ihres Mannes reicht für die Familie nicht aus, weshalb Valeria, für die damalige Zeit eher außergewöhnlich, neben ihrer Arbeit als Hausfrau einer Bürotätigkeit nachgeht. Während ihr die Arbeit eine Distanz und Freiheit von den Haushaltspflichten gestattet, beginnt sie durch das heimliche Schreiben im Tagebuch, das sie vor ihrer Familie versteckt, jene Distanz auch in den eigenen vier Wänden einzuziehen, die auf sie zunehmend einengend wirken. Programmatisch für den gesamten Tagebuchroman und in Anlehnung an Virginia Woolfs berühmtesten Essay, schreibt Valeria, ohne dass sie von der Schriftstellerin wusste, sie wünsche sich ein Zimmer für sich allein. Denn die Enge ihres Daseins erfährt sie recht eigentlich erst durch das nächtliche Schreiben, wenn ihr darin plötzlich etwa aufgeht, dass Michele sie schon seit Jahren nicht mehr beim Namen, sondern, wie ihre Kinder, nur noch »Mama« nennt.
Ihr Tagebuch schreibt sie über mehrere Monate, von November 1950 bis Mai 1951, oftmals liegen mehrere Tage zwischen den einzelnen Einträgen, in denen Valeria ihre Rolle als Ehefrau und Mutter reflektiert und hinterfragt. Durch das Schreiben scheint sie ein Bewusstsein ihrer selbst zu gewinnen, das sie zuvor nicht hatte, und durch dieses Bewusstsein wiederum die Möglichkeit zu erahnen, dass sie aus jener Enge ausbrechen könnte. Sie beginnt, auch samstags ins Büro zu gehen, nicht nur, um sich den eigenen Raum zu nehmen, der ihr zu Hause besonders am Wochenende fehlt, sondern auch, weil sie Gefühle für ihren Vorgesetzten Guido entwickelt. In ihr Notizbuch schreibt sie: »Hätte ich damals das Heft nicht gekauft, hätte ich Guido ebensowenig wahrgenommen wie mich selbst.« Und weiter: »Die Möglichkeit, sich nicht zu fügen. Das ist es, was alles verändert hat, zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen Mann und Frau.«
Während ihre Mutter ihr Vorwürfe macht, dass sie überhaupt arbeiten geht und partiell eine finanzielle Unabhängigkeit von ihrem Mann genießt, ist auch Valeria nicht frei von patriarchalen Rollenbildern, gegen die sie doch ankämpft. Die Selbstständigkeit ihrer Tochter, die bereits früh neben dem Studium in einer Kanzlei arbeitet, um der für sie später vorgesehenen Rolle als Frau zu entkommen, ist auch Valerias innerster Wunsch, den sie sich aber kaum zu denken traut und ihn deshalb bei der Tochter immer wieder harsch als naiv zurückweist. An ihrer Mutter und ihrer Tochter spürt Valeria den Generationenkonflikt, in dessen Mitte sie steht: »Die eine ist mit der alten Zeit untergegangen, die andere ist daraus geboren. In mir prallen diese beiden Welten aufeinander, lassen mich aufstöhnen. Vielleicht fühlte ich mich deshalb oft, als hätte ich keinerlei festen Bestand. Vielleicht bin ich nur dieser Übergang, dieser Zusammenprall.«
Im eingangs zitierten Satz steckt eigentlich bereits die ganze literarische Qualität und die ungeheure Sogkraft, die von Céspedes’ Roman ausgeht, weil in Form des Notizbuchs Gegenstand und Medium des Erzählens verschwimmen, eins werden. Valeria arbeitet sich an der Sprache ab, um ihre eigene zu finden, reflektiert über ihre Stellung in der Außenwelt, um im Schreiben mit dieser zu brechen und ihre eigene zu entwerfen: Das Notizbuch wird ihr zur Realität zweiter Ordnung; wirken ihre Gedanken anfangs zuweilen noch naiv, werden sie von Tag zu Tag elaborierter. Die Intensität des Romans besteht darin, dass es Céspedes gelingt, die Spannung zwischen der Unmittelbarkeit, die das Tagebuch als Medium des Erzählens einfordert, und der Reflexion über weibliches Schreiben und weibliche Subjektivität ständig aufrechtzuerhalten. Nicht zufällig ist für Silvia Bovenschen das Tagebuch die Schwelle vom vorästhetischen zum literarischen Raum gewesen, über die Frauen ab dem 18. Jahrhundert die Kunstsphäre betreten haben; auch nicht zufällig wurde der Roman, der 1953 in Italien erschien, damals von Kritikern als Hausfrauenroman diffamiert.
Dass die Romane von Alba de Céspedes erst jetzt wieder neu ins Deutsche übersetzt werden (erste Übersetzungen gab es bereits in den fünfziger Jahren, als ihre Romane auch international erfolgreich waren), hängt wohl damit zusammen, dass sie sich heute auch unter dem etwas hilflosen Schlagwort des autofiktionalen Schreibens vermarkten lassen. Tatsächlich haben Autorinnen wie Annie Ernaux sich an Céspedes’ Literatur orientiert, aber die sozialen Verhältnisse, in denen deren Protagonistinnen leben, waren ihre nicht. Céspedes wurde 1911 in Rom geboren, als Tochter einer Italienerin und des kubanischen Diplomaten Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, der 1933 kurzzeitig Präsident Kubas war und Sohn des Freiheitskämpfers und ersten kubanischen Präsidenten Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Sie wuchs im bürgerlichen Familienumfeld auf, schrieb mit 24 Jahren ihren ersten Erzählband und veröffentlichte mit 27 Jahren ihren ersten Roman (»Der Ruf ans andere Ufer«), aus der Erfahrung, wie sie 1994 schrieb, »die Zwänge, die die Frauen davon abhielten, ihrem Handlungswillen Ausdruck zu verleihen, immer weniger akzeptieren« zu können. Mit nur 15 Jahren heiratete sie einen Adligen, mit dem sie zwei Jahre später einen Sohn bekam, heiratete zwanzig Jahre später erneut, diesmal einen italienischen Diplomaten, dem sie in die USA und die Sowjetunion folgte. Während des Zweiten Weltkriegs engagierte sie sich über den Rundfunk in der italienischen Resistenza, nach dem Krieg schrieb sie weiterhin Romane auf Italienisch, zog aber 1967 nach Paris und begann dort, auch auf Französisch zu schreiben.
Autobiographische Züge tragen ihre Romane gleichwohl, so beispielsweise die Figur Alessandras im Roman »Aus ihrer Sicht«, der erst vergangenes Jahr in neuer Übersetzung wiederveröffentlicht wurde. Auch sie wächst wie Valeria in einfachen Verhältnissen in Rom auf, zieht nach dem Suizid ihrer Mutter, den diese als Konsequenz einer Affäre begeht, zu ihrer Verwandtschaft in die Abruzzen, weg von ihrem Vater, den sie für den Freitod der Mutter verantwortlich macht, kehrt jedoch nach Rom zurück, weil sie sich mit der Rolle als Hausfrau auf dem Land nicht abfindet, und lernt dort den antifaschistischen Philosophen Francesco kennen, in den sie sich verliebt. Während des Krieges, und das ist die biographische Analogie zu Céspedes, möchte sie im Widerstand gegen den italienischen und deutschen Faschismus aktiv werden, was Francesco ihr als Frau aber untersagt (Céspedes Radiokolumne in der Resistenza trug übrigens bereits den Namen des Romans »Dalla parte di lei«).
An »Das verbotene Notizbuch« und dessen Formgestaltung reicht der Roman »Aus ihrer Sicht«, an dem Céspedes zwischen 1945 und 1948 arbeitet und der 1949 erscheint, zwar nicht heran, aber die Thematisierung des Geschlechterverhältnisses konnte für die damalige Zeit fortschrittlicher kaum sein. Denn Alessandra, die leidenschaftlich Liebende, möchte sich weder mit dem einfachen Landleben ihrer weiblichen Verwandten arrangieren, die der Liebe entsagen, noch sich dem ehelichen Zwang beugen, der ihrer Mutter nur den Ausweg in den Tod lässt. Deren Begeisterung für Flauberts »Madame Bovary« kann sie kaum etwas abgewinnen, und doch schwebt die Drohung, die von den literarischen Frauenfiguren im Roman ausgeht – ihre Mutter begeht ihren Selbstmord im Bühnenkostüm von Ophelia, das sie wiederum von ihrer Mutter erbt –, auch über Alessandra.
In der Liebe zu Francesco, dem Partisanen und späteren Professor für Rechtsphilosophie, erfährt sie zunächst die Kraft der Liebe, die die konservativen Verhältnisse zu jener Zeit zu übersteigen vermöchte, doch auch für Alessandra wird die Ehe mit ihm schließlich zur einschnürenden Institution, die die Liebe zerstört. Sie verzweifelt an der wachsenden Kälte Francescos, an der »Mauer seiner Schultern, seines Rückens«, doch im Verlangen nach dem Ausbruch aus jener Institution wählt sie nicht den Weg ihrer Mutter, Bovarys oder Ophelias, sondern bringt ihren Ehemann, als sie nach dem Krieg auf ihre Rolle als Hausfrau zurückgeworfen wird, aus unerfüllter Liebe und Leidenschaft um. »Dieser Mord ist ein Akt des heroischen Widerstands gegen eine mörderische Institution, die Ehe«, schreibt Barbara Vinken im Nachwort zum Roman, und tatsächlich kann man Alessandras Tat als verspätete Teilnahme am Partisanenkampf lesen, an dem sie sich nicht beteiligen darf.
Denn die Befreiung, die vom Widerstand gegen den Faschismus ausgeht, bleibt für Alessandra nur unzureichend, wenn jene nicht auch die vom traditionellen Geschlechterverhältnis einschließt. Das ist gewissermaßen Céspedes‘ politische Botschaft, deren Realisierung ausbleibt. Am Ende des Romans leuchtet zwar die Utopie der romantischen Liebe, indem sich Alessandra nach ihrer Verurteilung im Gefängnis, das ihr zuvor die Ehe war, die anfängliche Zuneigung zu Francesco imaginiert, aber nur um den Preis, dass sie sich in der Realität nicht mehr erfüllen kann. Die Tragik des Schicksals indes ereilt auch Valeria am Ende des Romans »Das verbotene Notizbuch«. Weil sie die Konsequenzen der Emanzipation ahnt, die das Schreiben für sie bereithält, entscheidet sie sich, das Tagebuch zu verbrennen und beschließt es mit den Worten: »Dies wird die letzte Seite sein: Die folgenden werde ich nicht mehr beschreiben, und meine künftigen Tage werden sein wie sie, weiß, glatt und kalt. Von all dem, was ich in diesen Monaten gefühlt und gelebt habe, wird in wenigen Minuten nichts mehr übrig sein. Nichts als ein schwacher Brandgeruch in der Luft.«
Ein Zimmer für sich allein
Robin Becker über zwei unlängst in neuer Übersetzung erschienene Bücher der kubanisch-italienischen Schriftstellerin, Journalistin und Widerstandskämpferin Alba de Céspedes.

Alba de Céspedes (ca. 1965) (Bild: Gemeinfrei)
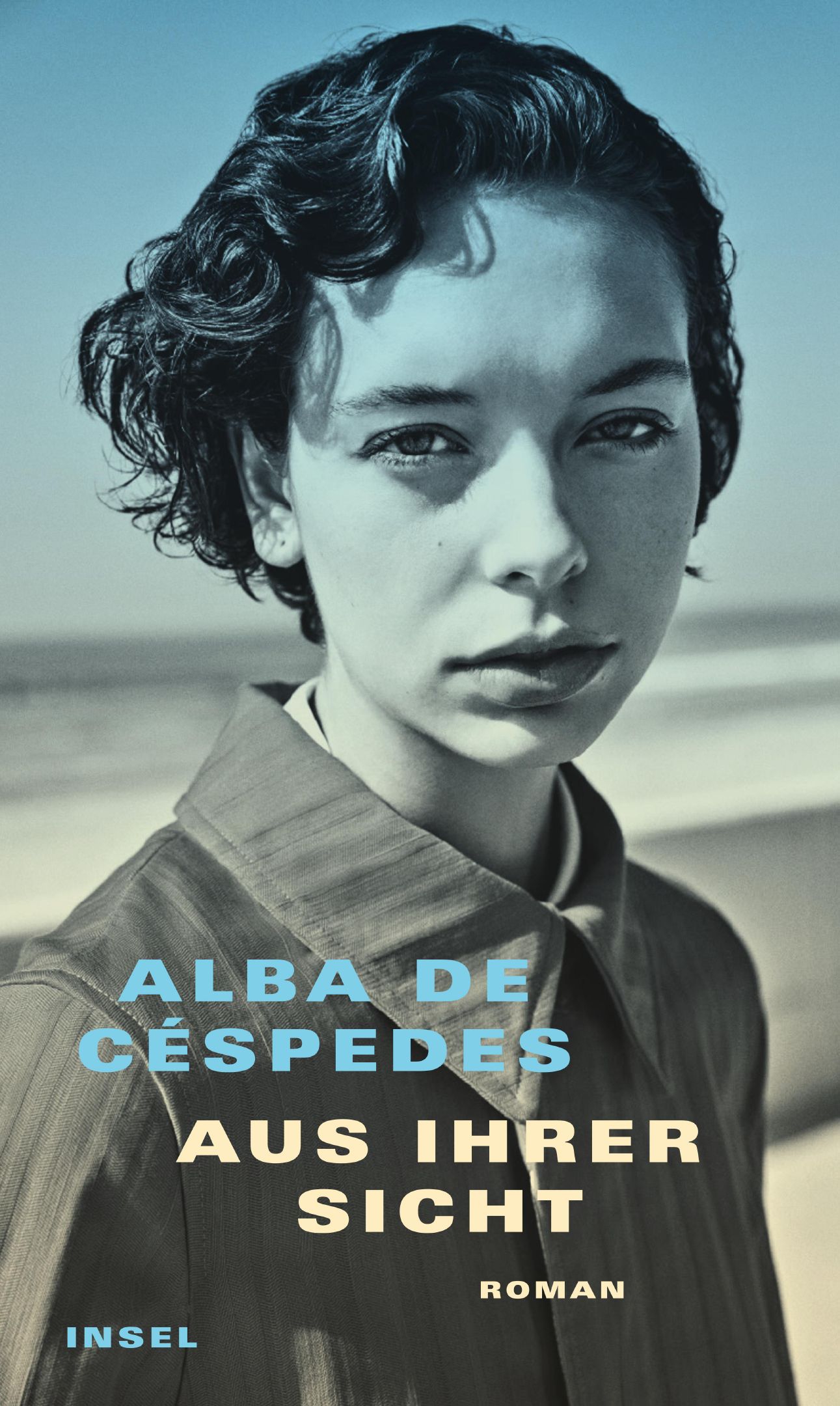
Alba de Céspedes: Aus ihrer Sicht. Aus dem Italienischen von Karin Krieger, mit einem Nachwort von Barbara Vinken. Insel Verlag, Berlin 2023. 637 Seiten, 28 Euro.
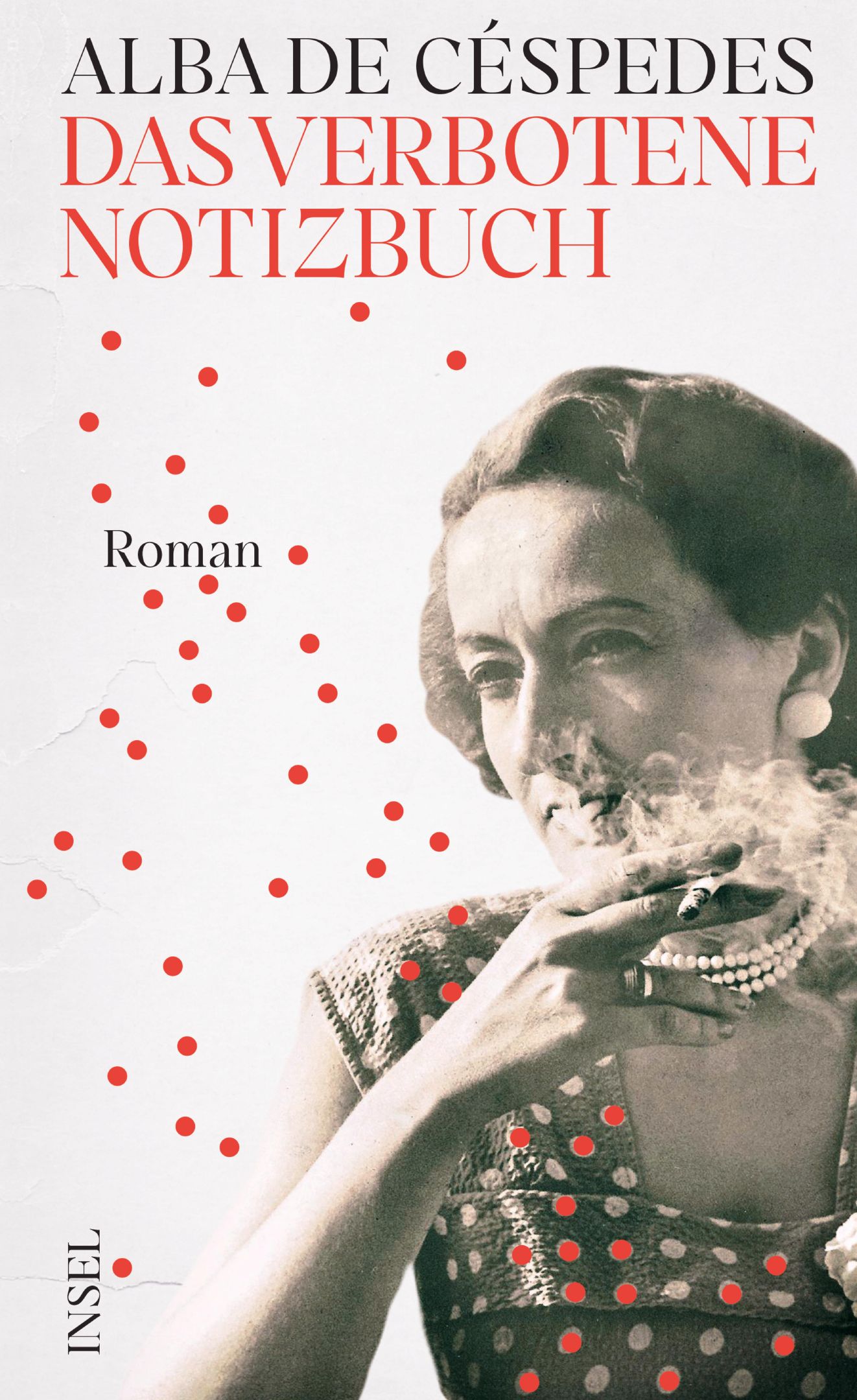
Alba de Céspedes: Das verbotene Notizbuch. Aus dem Italienischen von Verena von Koskull. Insel Verlag, Berlin 2021. 302 Seiten, 24 Euro.
