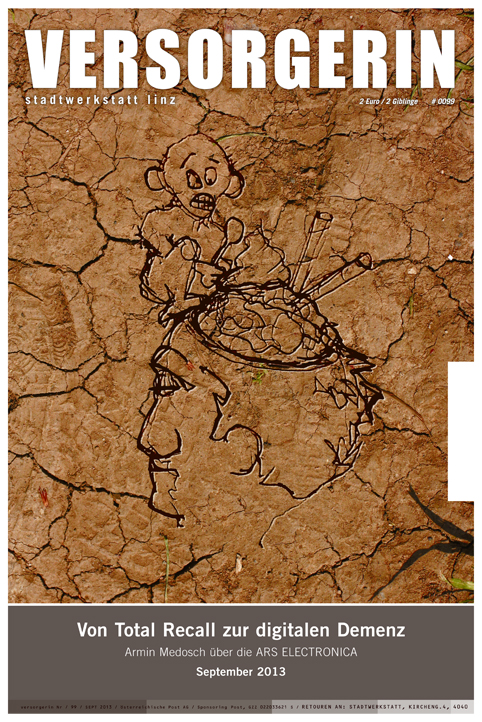Als Wagner mit seiner Schrift »Das Judenthum in der Musik« daran ging, seinen Kollegen und vormaligen Förderer Meyerbeer zu diskreditieren, verfasste er nicht bloß ein Schlüsseldokument des modernen Antisemitismus. Er etablierte zugleich ein Muster, dem noch heute die hiesigen Vorzeige-Popmusiker gerne folgen. Wenn sie etwa, wie Heinz Rudolf Kunze, eine Quote für deutschsprachige Produktionen fordern, dann einerseits, weil sie wissen, dass sie anders gegen die überlegene Konkurrenz aus Übersee keine Chance hätten; was andererseits eben ganz und gar nicht ausschließt, dass sie sich dabei, stellvertretend für die ganze altehrwürdige Kulturnation, wirklich als Opfer US-amerikanischer Machenschaften wähnen. Der Wahn verleiht dabei dem Kalkül erst die richtige Schlagkraft. Deutsch sein heißt schließlich, nach Wagners bekanntem Reklamespruch, eine Sache um ihrer selbst willen tun, also, wie Adorno ergänzte, keine Lüge auszusprechen, ohne sie selbst zu glauben.
Dafür ist Kulturindustrie das ideale Medium. Sie zwingt noch jeden Gegensatz abgründig zusammen: den Feierabend und den Werkeltag, das Vergnügen und die Versagung, den kleinen Mann und die große weite Welt, den Mob und die Elite. In Wagner, dem Erfinder des Gesamtkunstwerks, das alle Sinne in Beschlag nimmt, erlebt sie so etwas wie ihre Urszene. In seiner wunderbaren Studie Richard Wagner: Die Entstehung einer Marke zeigt Richard Vazsonyi, wie zielgerichtet der Komponist in jeder seiner Rollen – als Revoluzzer und als völkischer Agitator, als Opernreformer und Musentempelpriester – an der Produktion eines eigenen, unverwechselbaren Images wirkte: an der Etablierung von Richard Wagner®. Als erster begriff Wagner, dass kaum etwas am Markt besser zieht als das verkannte Genie, der Undergroundartist, der sich nicht verkaufen will.
Wenn Wagner, in seinen ästhetischen Entwürfen, die Oper seiner Zeit, d.h. die französische und italienische Operntradition als oberflächlichen Schund denunziert und ihr das Musikdrama als organische Einheit von Dichtung, Komposition und Szene entgegenstellt, und wenn er, in seinen antisemitischen Hetzschriften, die Juden als nachäffende, zu jeder Inspiration und inneren Anteilnahme unfähige Kulturschmarotzer charakterisiert – dann speist sich beides aus ein und derselben Wurzel. Ressentiment ist, als Stereotypie, immer auch ein kulturindustrielles Erfolgsrezept. Genial daher Vazsonyis Deutung der Meistersinger als ein Stück Infotainment. Im Sängerwettstreit scheitert das Konkurrenzprodukt (der Pedant Beckmesser1, der nur auswendig lernt und, horribile dictu, sich die Texte von anderen schreiben lässt) blamabel, während das Wagner®-Originalgenie, Walther von Stolzing, jede Aufgabe glanzvoll bewältigt, gerade weil er statt Beckmessers Regeln nur seiner Inspiration gehorcht – und der Experte, Hanns von Sachs, kann dem Publikum beständig die Vorzüge des »deutschen Sangs« gegenüber dem »welschen Tand« einbläuen. Kein Wunder, dass am Ende der Jubel des Volkes überwältigend ist.
So wenig Wagner aber als Antisemit einfach geschrieben hat, wie ihm der Schnabel gewachsen war, sondern stets auf seinen Vorteil bedacht, so wenig hat er auch komponiert, wie er seinen Walther es vormachen lässt. Seine Behauptung, das besonders mythologisch aufgeladene Rheingold-Vorspiel sei ihm im Halbschlaf eingegeben worden, darf man getrost in den Bereich der Verkaufslegenden verweisen. Auch Wagner gebietet selbstverständlich äußerst bewusst über seine musikalischen Mittel; nur dass die Technik, in einem bis dahin unbekannten Ausmaß, vor allem darauf berechnet ist, die Technizität des Kunstwerks, seine menschliche Gemachtheit, zu verschleiern und es stattdessen als mystisches Urereignis, als reine musikalische Präsenz zu fingieren. Seine Opern sind nicht Rückkehr in die bessere Welt des Mittelalters, sondern entschieden modern – nur eben als Wendung der Moderne gegen sich selbst.
Kulturindustrie heißt nicht zuletzt, den Anteil des Subjekts an ihr unsichtbar zu machen: ihre Produkte zu präsentieren, als entstammten sie nicht der Arbeit, sondern einer höheren Macht. Benjamin fasste es, auf die wagnerschen Züge Baudelaires gemünzt, unübertroffen zusammen: »Die Nonkonformisten rebellieren gegen die Auslieferung der Kunst an den Markt. Sie scharen sich um das Banner des ›l‘art pour l‘art‹. Dieser Parole entspringt die Konzeption des Gesamtkunstwerks, das versucht, die Kunst gegen die Technik abzudichten. Die Weihe, mit der es sich zelebriert, ist das Pendant der Zerstreuung, die die Ware verklärt.« Statt, urbürgerlich, durch Gestaltung von Affekten das Subjekt zu idealisieren, umfasst seine Musik es in einer Art höherer Ordnung, die nie ganz zu überblicken ist und darum nur umso auratischer erscheint. Die Rezeptionshaltung, die sie befördert, ist das Schwelgen: In ihr konsumiert das Publikum seine eigene Erhebung.
Als Schlüssel zu Wagners Werk gilt daher, seit Nietzsches epochaler Kritik, der Begriff des Rausches. In ihm verdichtet sich die ganz eigentümliche Zeiterfahrung, die das Wagner‘sche Musikdrama so signifikant von der thematischen Arbeit der Klassik unterscheidet. Diese zielte, am deutlichsten bei Beethoven, darauf, sich die Zeit zu eigen zu machen: Vorher und Nachher ergeben jeweils musikalischen Sinn. In Wagners Werk aber soll sie untergehen. Dem dienen nahezu alle seiner technischen Innovationen: der riesenhafte Orchesterapparat und dessen spezifische Akustik, die den Zuhörer von allen Seiten zu umspülen scheint; die Aufwertung der Klangfarbe, die als kompositorisches Mittel gleichberechtigt an die Seite von Tonhöhe und -dauer tritt; die Aufweichung der Tonalität durch Chromatik und Enharmonik, welche das traditionelle harmonische Gefälle, den Wechsel von An- und Entspannung unterminieren.2 Während die Musik unablässig in Bewegung bleibt, scheint sie doch zugleich in reiner Präsenz stillzustehen, gefangen in einem Schwebezustand; und eben dadurch dem Subjekt, das der Zeit unterworfen bleibt, entrückt (und umso mehr, als die Leitmotive, die zur Orientierung dienen sollen, ihr zugleich durch ihre Starrheit ganz äußerlich bleiben – sie zu erfassen, braucht es kaum jene gespannte Aufmerksamkeit, die den Zustand ergriffenen Schwelgens unterbräche).
Es ist eben eine sehr spezifische, alles andere als urtümliche Phantasmagorie, die Wagner entfaltet: nicht den Rausch als solchen, sondern den kapitalen. Was Marx als Zeitbewusstsein des Bürgers beschreibt: »Es hat einmal eine Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr«, das gestaltet Wagner musikalisch. Geschichte, den Bruch mit dem, was ist, kennt er nur als Einbruch von außen, der die Alleinheit des Ganzen bedroht: Zeit ist ein Negativum, eine Qual, der in letzter Instanz nur durch eine weitere, die ultimative Negation zu entkommen ist – das Opfer, das einen der Welt ein für alle mal enthebt. Lust und Versagung verschmelzen ununterscheidbar. Wenn daher das Formgesetz der Kulturindustrie, wie Horkheimer und Adorno schreiben, der endlose Aufschub ist – bei der nächsten Ware wird alles anders –, dann findet es sich bei Wagner in Reinform präformiert. Nie dürfen bei ihm die Menschen zu dem ihren kommen, weil Erfüllung die Aussicht darauf eröffnete, ein anderer werden zu können.
Gerade Wagners mythischer Bombast bannt ihn damit in jene Sphäre des Kommerzes, gegen die er sich so wortreich empört. Die Musik, die, als den Subjekten entrückte, sich wie ein Flor verklärend übers bloße Sosein ausbreitet, taugt wie kaum eine andere zur Filmmusik; insbesondere dort, wo der Film selbst das Sosein zugleich zum Symbol für ein Höheres, Ewiges stilisiert, in Western also oder Fantasy. Kaum eine Oper, deren Vorspiel nicht ganz wunderbar zu jenen langen, süchtigen Kamerafahrten über die Weite der Prärie passte; und nicht umsonst basiert der Soundtrack von Lord of the Rings unüberhörbar auf dem Parzival.
Freilich ist es ein ganz anderer Film, der den wohl nachhaltigsten Einsatz von Wagners Werk macht. Wer auch sonst nichts von diesem kennt, kennt doch zumindest jene Ausschnitte aus dem »Walkürenritt«, mit denen Apocalypse Now den Angriff amerikanischer Kampfflieger auf ein vietnamesisches Dorf unterlegt. Meist wird davon ausgegangen, es sei halt der martialische Charakter der Musik, der damit zum Vorschein gebracht wird; aber Richard Klein argumentiert in Richard Wagner und seine Medien sehr überzeugend, dass mit Dynamik allein die Szene nicht funktionierte. Wirksam wird sie erst durch eben ihren Doppelcharakter: die Verklammerung von treibender Fanfare und schwebender Chromatik, von Leichtigkeit und Massivität, die noch in Bandnamen wie Led Zeppelin und Iron Butterfly ihren Widerhall findet. Erst diese Einheit der Gegensätze ermöglicht die Verklärung noch des Mordwerkzeugs zur metaphysischen Erfahrung; denn nur aus der Perspektive der Erhebung nehmen sich die vielen Menschen da unten auf dem Boden so klein und unbedeutend aus, dass es eine Lust erscheint, sie niederzumähen.
Kein Zufall freilich, dass ausgerechnet Kulturindustrie, die Wagners Musik doch soviel verdankt, zugleich deren bislang wohl schlagendste Entstellung zur Kenntlichkeit gelang. In einem nämlich fügt sich Wagner ihren Gesetzen nicht: Statt sich brav mit dem Menschlich-Allzumenschlichen zu bescheiden, dem gesunden Mittelmaß, muss er zwanghaft immer aufs Ganze gehen. Die riesenhaften Dimensionen seiner Dramen, ihre ungeheure Überdeterminiertheit droht stets den kulturindustriellen Rahmen zu sprengen. In ihren besten Momenten gelingt dies auch; etwa in jenem zweiten von Vazsonyi analysierten Werk, dem Tristan. Vazsonyi liest es, wiederum äußerst pointiert, als Apotheose der Entsubjektivierung, von Musik als Konsum: Isolde verschmelze ganz und gar mit den verklärenden Tönen und stürbe »als rundum zufriedene Konsumentin«. Mit rundum zufriedenen Konsumenten aber, das wissen alle, kann Kulturindustrie so wenig anfangen wie jeder andere kapitalistische Geschäftszweig auch.
Literatur
Nicholas Vazsonyi, Richard Wagner. Die Entstehung einer Marke. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012, 239 S., 39,80 Euro
Johanna Dombois u. Richard Klein, Richard Wagner und seine Medien. Für eine kritische Praxis des Musiktheaters. Stuttgart: Klett-Cotta 2012, 512 S., 78,- Euro