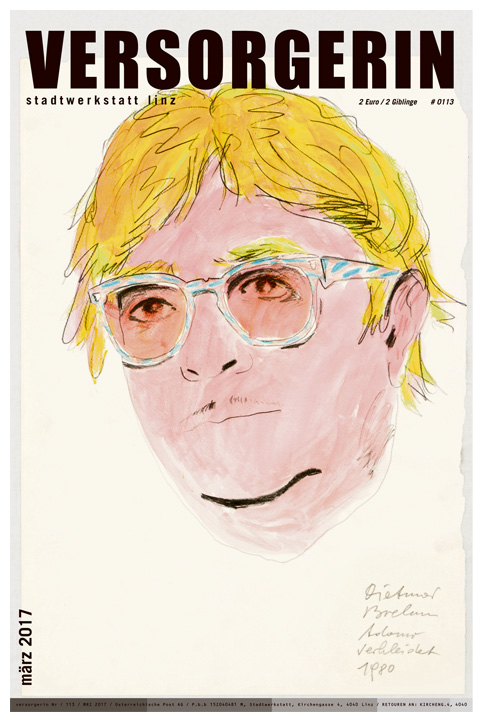Bei allem Respekt für die Kunstschaffenden aller Orte aller Zeiten, für deren wunderliche Werke und mannigfaltige Manifeste, für ihren häufigen Einsatz für Fortschritt und Freiheit! Dieser Text wird ihnen vielleicht Unrecht tun, denn er hat keinerlei Absicht, gefällig zu sein, oder schön im Kant’schen Sinne – nicht das, was »ohne alles Interesse gefalle«. Kontemplativ-moralisierende Theorien des Ästhetischen sind so fade, falsch und fruchtlos wie l’art pour l‘art, denn sie isolieren die Kunst von der Wirklichkeit und tragen kaum zum Verständnis ihrer realen Rolle und ihrer notorischen Überhöhung und Jämmerlichkeit bei. Gerade die Fachmänner der Fantasie, strukturell gefangen in einem künstlichen Paralleluniversum, sollten spätestens jetzt umblättern, bevor sie innerlich zu zürnen beginnen und blasiert abwinken. Denn, wie schon Schopenhauer stichelt, die Geschichte der Wissenschaften und Künste erstattet meist bloß Bericht von den Ausnahmen der vielen »verständigen, geistreichen, genialen Menschen«; die »zahllose übrige Menge verschwindet auch dem Andenken nach«. Betrachtet man jedoch, »zu welcher Zeit es auch sei, in der Nähe«, sprich, im Alltag die neuesten Gemälde, Bücher und Musikalien, »so hat man allemal nichts als Pfuscherei«. Des Philosophen Aussage ist, genau genommen, um keinen Deut garstiger oder elitärer als Cézannes Bonmot, wonach der Geschmack »der beste Richter« und überhaupt »selten« sei: »Der Künstler wendet sich nur an eine äußerst beschränkte Zahl von Individuen.«
Doch, am Kult der Exzellenz klebt da wie dort etwas Verlogenes, mindestens so verlogen wie das Verschweigen der materiellen Vorbedingungen, unter denen sich von »gut« zu »besser« aufsteigen ließe – bis hin zum künstlerischen Optimum. Der Grad der Entfremdung des modernen Menschen, jenes geistig geschichtslosen, halbbewusst konsumierenden Sozialatoms, das sich, für gewöhnlich, nie gänzlich entfaltet und verwirklicht hat, wird wohl darüber entscheiden, wie anziehend dieser kranke Kult individuell ausfällt. Fakt ist: je mickriger das Ich, desto größer sein Idol. Nun, die Feuerprobe der Nachwelt zu bestehen und in den Kanon des Wissens einzugehen, entspringt nicht den »besonderen« Einfällen des Einzelnen, sondern seinem allgemeinen, weltgeschichtlichen Beitrag zum Vorwärtskommen der Menschheit, deren aktiver Teil er ist, sodass das Außerordentliche und Seltene, wie Bourdieu erklärt, darin liegt, »sein Scherflein dazu beizutragen, jene nicht personengebundenen Denkweisen zu entwickeln und durchzusetzen, mit denen die verschiedensten Menschen Gedanken hervorbringen können, die bisher nicht gedacht werden konnten«. Dies gilt für die Wissenschaften gleichermaßen wie für die Künste und zeichnet sie letztlich aus. Mit anderen Worten, beide haben nur dann bleibenden Wert, wenn man nicht unbedingt Bourdieu sein muss, um Bourdieu auch verstehen oder genießen zu können. Zudem ist die knappe Lebenszeit zu kurz und kostbar, um sie zu vergeuden mit allzu besonderen Verrenkungen des Geistes. Oft führen diese nirgendwohin.
Kunst, und sei sie noch so sehr Spiegel ihrer Zeit und Seismograf sozialer Entwicklungen, bleibt stets, wofür sie am meisten taugt: eine Projektionsfläche im geistigen Überbau. Auf sie werden, schlichtweg weil sie, wie Černyševskij sagt, »ein Urteil über die Erscheinungen des Lebens« ist, unentwegt Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen übertragen und hochstilisiert, auch das gemeinhin menschliche, schöpferische Potenzial, dessen Verhinderung in so einem Fall die eigene Person verkörpert. Die Projektion, laut Freud ein »Verfolgen eigener Wünsche in anderen«, spendet dafür nur spärlich Trost. Die Kunst – als ästhetische Aktivität, in der Menschen einem Talent oder einem Hang nachgehen und die Summe ihrer Beziehungen zur Wirklichkeit anschaulich zum Gegenstand allseitiger Aneignung machen, in Form von Literatur, Musik, Malerei, Theater, Film usw. –, hat noch nie die Welt verändert, außer nebenher, eher zufällig, und im Nachhinein, eher langfristig. Der entscheidende Impuls dazu ist immer von außen gekommen. Das und nichts Anderes bietet sich als ihre magere Bilanz an, vorausgesetzt, versteht sich, man schließt aus dem Urteil vorab die vermessene Selbstdarstellung und überzogene Sympathie aus.
Künstler sind nämlich Huren, wenn auch beruflich weniger ehrlich und weniger bescheiden, allzeit bereit, sich an den Bestbieter zu verkaufen, frei in der Wahl und doch unfrei darin, wählen zu müssen, dabei die alte Scheinalternative zwischen Nutzen und Ergötzen auf seltsame Weise in sich vereinend – selbst dann, wenn sie sich, wie Goethe betont, genuin auszeichnen durch Vorwegnahme und »Vorempfindung« der Welt weit über die Nachahmung hinaus. Sie können, hier einmal Hegel‘sch gesprochen, nicht am Pathos des Weltgeschehens und an der Poesie des Lebens teilnehmen aufgrund der platten Prosa des Geldverdienens. Hegel leitet daraus bekanntlich den Untergang der Kunst ab. Der gesellschaftliche Einfluss der Künstler ist, im Lichte der Bedeutsamkeit einiger ihrer Anliegen, bis heute vergleichsweise gering. Wenn also Kunst und Künstler, auch abseits der minimalen Kulturbudgets jedweder Staatlichkeit, im gelebten sozialen Diskurs nur geringfügig von Bedeutung sind, wenn ihre Positionen und Petitionen folgenlos verpuffen und versickern, statt Sand im Getriebe gewesen zu sein, wenn sie in der Öffentlichkeit zunächst als Stimme des Gewissens auftreten und irgendwann trotzdem zu Allerweltshumanisten, Alibischwä-tzern, Kompensationsfiguren und Preisträgerinnen in den Netzen des Establishments werden, kurz, wenn sie erst einmal sozial irrelevant und politisch neutralisiert sind – dann auch darum, weil die Wirkung künstlerisch transportierter Inhalte vom Niveau des gesellschaftlichen Bewusstseins abhängt, in all seinen Nuancen: und wo keine reflektierte, kritische Masse, da kein Effekt der sinnvollen, kritischen Kunstwerke.
An dieser Stelle täte eine Differenzierung von Kunst als geschichtlich kulturelles Produkt auf der einen Seite und als zeitgenössisch kapitalistischer Kulturbetrieb auf der anderen not, doch dazu später mehr... Die Kunst, die als Bedürfnis »produktiv zu werden«, so Goethe, dem Wesen des Menschen entspricht, ist allem voran ein gesellschaftliches Produkt und individuelles Zwischenresultat anhaltender kollektiver Prozesse: je arbeitsteiliger eine Gesellschaft, desto spezialisierter und selbständiger die einzelnen Sphären künstlerischer Praxis, wohlgemerkt – im Rahmen anerkannten Prostituierens der Kreativität, die als solche, nach Marx, den »Klassencharakter« ausdrückt. Derlei Spezialisierung setzt schon recht früh ein, wie die Bildhauerwerkstatt eines Thutmosis von Amarna 1370 v. u. Z. belegt. Ob Arbeitsteilung als Begriff in Bezug auf die damalige Sklaverei überhaupt das passende Wort sein kann, ist fraglich. Parallel dazu jedenfalls entstehen verschiedene Volkskulturen, ihrerseits ästhetisch wirksam in ikonischer Form, kraft ihrer Mythen, Märchen, Lieder, Tänze, Töpfereien, Trachten, Stickereien und dergleichen, also durch Kunstschöpfungen, die unzählige Stationen, Köpfe, Münder und Hände durchlaufen haben und so zu ihrer endgültigen Form gelangt sind. Bemerkenswert sind beispielsweise, anders als beim Nibelungenlied mit seiner derben Heldenromantik und thematischen Palastlastigkeit, die griechische Sage von Prometheus oder das armenische Epos über David von Sassun und seinen Sohn Mger, der, eingeschlossen in einen Felsen, warte, bis die alte, ungerechte Ordnung zerstört werde – und »das Weizenkorn groß wie im Wald die Nuss« sei. Die weltanschaulich-utopische Dimension und ästhetisch-stilistische Vielfalt in der Volkskunst verdienen es, obwohl die Stunde der technologischen Rationalität und postmodernen Individualität geschlagen hat, nichtsdestotrotz, hervorgehoben zu werden, denn sie sind das Beste an ihr.
Mit dem Aufkommen der Manufaktur und bald darauf der Fabrik bzw. mit der Einführung der Massenproduktion und dem Rückgang manueller Arbeit zugunsten des Dienstleistungssektors in den Industrieländern hat sich die Volkskunst nur noch in verzerrter, verstümmelter Form erhalten, und zwar als volkstümlicher Billigschund und Kitsch. Dieser wiederum ist ein Epiphänomen der Kunst, eigens kreiert für moderne Werktätige und entfremdete Büroangestellte, und in jeder Hinsicht passabel für eine entpolitisierte, kommerzialisierte Lebenswelt des uniformierten Geschmacks. Seinen Ausgang nimmt dieser Schund, wie Vlasta Ilišin 1977 hervorhebt, mit dem religiösen Kitsch: Marienstatuen aus minderwertigen Materialien mit liebloser Bemalung, Rosenkränzen mit Perlen aus Plastik usw. Obendrein denke ein dafür empfänglicher, meist kleinbürgerlicher Konsument, dass Kunst »die wohligsten Gefühle hervorrufen« müsse, insoweit als sie ihm als »reines Status-Symbol«, als »Dekoration und Würzung« erscheint – »was in letzter Instanz die Negation des Wesens sowohl der Kunst als auch des Menschen« darstelle. Die Anmerkung sollte nicht bagatellisiert werden. Hierin entblößt sich die ganze private, geistige Sklaverei in der häuslichen Komfortzone, die außer Haus allenfalls dadurch durchbrochen wird, indem dem falschen Neuerertum aus Originalitätssucht und dem neuesten Angebot am Kunstmarkt konsumtiv gehuldigt wird. Wie reizlos! Anstelle von Kunst erhält man Kitsch oder Exzentrik, anstelle von Handwerk das Fließbanderzeugnis, anstelle von Literatur den Buchhandel, anstelle von Kritik den Konsum, anstelle der Kunstaktion den Kulturevent, und so in einem fort. Georg Seeßlen beklagt zu Recht, dass Künstler »als Berufsstand«, angesichts ihres gegenwärtig unermesslichen »Frei- und Spielraums«, noch nie »ein jämmerlicheres Bild abgegeben« hätten. Der kapitalistische Kulturbetrieb macht aus Künstlern autozensierte, untereinander konkurrierende Lieferanten erwünschter, marktkonformer Produkte für die Verlage, Galerien, Konzertbühnen und Theaterdirektionen. Der Rest erinnert an eine Art kultureller Besitzstandswahrung. Wo und wann auch immer Künstlerinnen und Künstlergruppen es verabsäumen, diese Dinge direkt und unverkennbar in ihrem Opus zu verarbeiten, laufen sie Gefahr, sich den Unmut der lohnabhängigen Bevölkerung zuzuziehen, welche sie, wahrscheinlich aus ökonomisch bedingtem Ressentiment heraus, vorschnell und willig des Snobismus, der Realitätsferne und der professionellen Nichtsnutzerei bezichtigt.
Und hat nicht schon Černyševskij verlangt, »auch die Kunst muss irgendeinen Nutzen bringen und darf nicht nur steriles Vergnügen sein«?! Wie viel davon lässt sich gewissenhaft auf die Gegenwart anwenden? Bei näherem Hinsehen – sehr viel, einfach alles! Der Kapitalismus, und insbesondere seine neoliberale Version, in der die vollkommene Virtualisierung der Werte voranschreitet, nicht zuletzt wegen der Unverhältnismäßigkeit und Abkoppelung des Finanzmarkts von der Realwirtschaft, diese sogenannte Ordnung als globales System hat zwei recht divergente Dinge hervorgebracht: einerseits die Bemächtigung aller Formen künstlerischen Schaffens durch die industrielle Produktion, wodurch sie es unter ihre Botmäßigkeit gezwungen hat, siehe »Kulturindustrie«; andererseits den Beitrag zur Entwicklung neuartiger materieller Medien wie Funk, Foto, Film, Fernsehen und Internet, während, ähnlich wie bei der traditionellen Volkskunst, andere künstlerische Aussageformen wie Skluptur, Zeichnung und Gemälde in der Folge zurückweichen. Auffällig ist dabei nicht nur, dass, wie Benjamin bemerkt, das »Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« notgedrungen seine künstlerische »Aura« in einer medialen, kollektiven, möglicherweise konformitätsfördernden und tendenziell totalitären Ästhetik verliere, sondern auch, dass der Kunstkonsum, nach einer kurzen Phase der Verbreitung in den Tagen steigender Kaufkraft, wieder einmal zunehmend den wohlhabenden, gehobenen, gebildeten Schichten vorbehalten ist.
Zur Veranschaulichung: Papier und Bleistift, nunmehr leicht zu haben, die ein Einzelner, begrenzt allein durch sein Talent und Können, in erhabene Zeichnungen verwandelt, reichen in der Regel nicht mehr aus, um das Interesse von großen Galerien und Museen der Moderne zu wecken. Das Zeichnen ist ihnen vielleicht als Akt zu ordinär, zu plebejisch. Die Installationskunst indes, die Unmengen an Zeit, Geld, Raum, Material oder gar Strom erfordert, hätte da bereits höhere Aussichten auf Erfolg, denn sie steht mittlerweile in einem anderen gesamtgesellschaftlichen Kontext als ihre Anfänge bei Mondrian oder El Lisickij, der noch verkündet hat, »die Kunst als etwas an und für sich Existierendes aufgehoben« sehen zu wollen: in einer »neuen Gesellschaftsordnung, in der die Arbeit aufhören soll, Sklaverei zu sein, in der nicht einige kleine Gruppen Luxus für eine begrenzte Gesellschaftsschicht produzieren«, denn »wo alle für alle arbeiten, dort wird die Arbeit frei, und alles, was entsteht, ist Kunst«. Davon kann bei Installationen neuerdings nicht mehr die Rede sein, und es hat auch seine Gründe. Bürgerliche Werte klingen beileibe doppelbödiger. Die Installation und das Event als bevorzugte, effektvolle, präsentable Art der Kunst, eingebettet in den offiziellen, sensationslüsternen Kulturbetrieb, erfüllen – abgesehen vom Konsens über die gängig megalomanische Profitmaxime, der ihn begleitet – eine Eliminationsfunktion innerhalb elitärer Strukturen: Kapital wird plötzlich zur Grundvoraussetzung von Kreativität, die so zum Humankapital mutiert und sich auch entsprechend definiert. Der Wert eines Kunstwerks wird offenbar vom damit umsetzbaren Profit bestimmt. Die unermüdliche Künstlerin Marina Abramovi´c hat eben diese Einstellung »wirklich satt«: Fotografie und Video sind längst zum Mainstream geworden – »übrig geblieben ist die Performance-Kunst als eine Art Unterhaltungs-Gimmick«.
Die moderne Kunst, sich einkapselnd in einem partikulären Wirkkreis, weil sie sich im Zwiespalt zum umgebenden gesellschaftlichen Milieu wiederfindet, neigt demgemäß zu einer Pose des ornamentalen Selbstzwecks, auch dort noch, wo sie sich, wie Adorno es formuliert, »transideologisch« gebärdet und aufgeklärt anmutet. Als solche führt sie zu kontingenten Werken mit absoluten Ansprüchen, zu Betroffenheit ohne Anteilnahme, zu Engagement ohne Konsequenzen, zu einem eitlen Freiheitsverständnis, das sie, wenn überhaupt, selten auf den Rest der Menschheit ausdehnt. Mehr noch: Fast wäre zu hoffen, dass ökonomische Krisen sich häufen würden, da die Künste in solchen Momenten interessanterweise politisch aufbrechen und kreativ aufleben. Selbst die Funktion der Kunst, Lukács zufolge die Kritik als aktive Befreiung von irrationalen Elementen, scheint aus dem zweckoptimistischen Posieren nicht herauszukommen und deshalb ihre spezifisch ästhetische Stellung zu verkennen, weil aus diesem Winkel die Kunstwerke zu Exempeln für mehr oder minder philosophische Haltungen herabgesetzt werden. So wird etwa die bestehende Gesellschaft in diesem oder jenem ihrer Aspekte kritisiert, allerdings ohne ihre tatsächliche Grundlage anzutasten oder je infrage zu stellen: das materielle Privileg. Schließlich hängen davon auch die persönlichen Aussichten auf öffentliches Auftreten, künftige Einladungen, weitere Stipendien, nützliche Kontakte und sonstige Gratifikationen unmittelbar ab. Nicht immer sind die Motive primär finanziell; die Eitelkeit übt eine eigene, organische, stille Motivationskraft aus. Dass gerade die Künstler insofern in gefährliche Nähe zu einem »Konformismus zweiter Ordnung« oder sogar zur Normopathie rücken, einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung im Unterwerfen unter nahezu alle Normen und Erwartungen, stimmt gewiss traurig, sollte hingegen als Feststellung nicht im Psychologisieren bei eigentlich sozialen Sachverhalten münden. Würde nicht jeder beherzte Maler für ein bisschen Leinwand, Farbe und Pinsel notfalls seine Seele an den Teufel verkaufen? Die Überanpassung der Künstler wird in ihrer herrschaftlich harmlosen, aber gesellschaftlich zur Schau getragenen Unangepasstheit manifest.
Umgekehrt weist dieser Umstand auf ein Zeitalter hin, in der nach Marx längst »alles eine Sache des Handels« geworden ist, auch das sogenannte Wahre, Gute und Schöne: »Es ist die Zeit der allgemeinen Korruption, der universellen Käuflichkeit«, eine allzu selbstverständliche Unzeit, »in der jeder Gegenstand, ob physisch oder moralisch, als Handelswert auf den Markt gebracht wird, um auf seinen richtigsten Wert abgeschätzt zu werden«. Die Konformität, die sich unter diesen Bedingungen breitflächig in das Künstlerleben einschleicht, ist indirekt wirksam und darum vermittelter, versteckter Natur. An sich ist das keine großartige Entdeckung. Plechanov, für den Kunst »eines der Mittel des geistigen Verkehrs« ist, fragt gleich im Anschluss daran: »Kann man sich wundern, dass die Kunst in einer Zeit der allgemeinen Käuflichkeit ebenfalls käuflich wird?« Lapidar hat er seine Frage zuvor bereits beantwortet: »Wer mit den Wölfen lebt, muss mit den Wölfen heulen.« Fazit: eine relativ abgeschottete, kirre und konforme Künstlerkaste, die produziert, wofür sie, wie gesagt, staatliche Subventionen, öffentliches Lob und private Aufträge in Aussicht gestellt bekommt, samt einer Kunstkritik in der Klemme, die, sofern nicht selbst schon aus den vornehm elitären, oberen Reihen stammt, nicht sagen darf, was sie denkt, weil sie davon lebt, um ganz zu schweigen von der beredten Gedankenlosigkeit der Selbstdarsteller und intellektuellen Verwässerungsexperten. Als bei der Ausstellungseröffnung im Wiener »mumok« Mladen Miljanović 2010 ein jugoslawisches Automobil einzementiert, bringt er mit einer unbeachteten Steintafel am Rande ironisch die Patsche des Künstlers auf den Punkt: »I am for the freedom of form as long as it remains within the form.« Die Aufschrift ist, anbei erwähnt, nur über einen darüber montierten Rückspiegel lesbar gewesen. »Dennoch muss wirklich vorhanden gewesene Kultur von der epigonal verdinglichten unterschieden werden.«, fordert Bloch, freilich mit utopischem Nachdruck: »Schönheit ohne Lüge, Glaube ohne Blendwerk, Geheimnis ohne Nebel.«
Immerhin ist es fragwürdig, wenn sich künstlerisch vorgebrachte Positionen, in denen auf diverse Missstände der Gesellschaft aufmerksam gemacht wird, ständig auf einer Linie mit den Interessen des Nato-Generalstabs befinden: wenn wieder einmal rechtzeitig vor dem nächsten Militärschlag im Ausland, oder währenddessen, die Frauen- und Minderheitenrechte am Zielort der Zerstörung unverhofft ins künstlerische Rampenlicht rücken. Es handelt sich dabei eindeutig um artifizielle Maskeraden und keineswegs um Aktionismus. In Wirklichkeit werden Interessen bedient, umso mehr, als die Schamlosigkeit sich hier unter einem moralischen Alleinstellungsmerkmal präsentiert. »Alles purer Zufall!«, werden die Verteidiger des Bestehenden erwartungsgemäß einwenden. Die Abgebrühten unter ihnen werden eins nachlegen und behaupten, man bemühe sich doch bloß um das subjektive Aufzeigen objektiver Problematiken, um eine friedlichere Zukunft, um »den besseren Zustand« im Adorno’schen Sinne, gedacht als denjenigen, »in dem man ohne Angst verschieden sein kann«. Und, weiter? Diese egalitäre Differenz ist weitgehend nur noch Euphemismus. Was bringt es den Künstlerinnen und ihrer viel besungenen Verschiedenheit, wenn Staatsgelder für Kulturelles vorzugsweise in die Aufführungen von Seebühnen und Opernhäusern fließen? Nichts. Was hat denn die Menschheit von Kunstauktionen in Millionenhöhe, oder davon, im Namen der Kunstfreiheit Inseln und Gebäude in rosarotes, gelbes oder weißes Polyamidgewebe, Tausende von Quadratmetern groß, zu hüllen? Überhaupt nichts. Die berühmte Theodor-Heuss-Stiftung zum Beispiel erkennt darin eine »subtile Provokation am monumentalen Objekt« – sei es drum! Ob diese Einschätzung den enormen Aufwand auch rechtfertigt? Der Ruhm gebührt, um ehrlich zu sein, eher der logistischen Leistung als der künstlerischen Freiheit. Des Pudels Kern und auch eine Ursache von künstlerischer Konformität liegt im Versuch, die gesellschaftlichen Widersprüche nur scheinbar zu lösen, was Bloch als das »Gegenteil ihrer materiellen Erforschung« festmacht.
Die Entgegnung und äußerst populäre Wiederholung, dass man nun einmal in einer Zeit der Komplexität leben würde, ist läppischer als ein Kaugummi auf der Unterseite einer Schulbank. Sie wird aber nicht durch einen vermeintlichen Verfall der Künste Lügen gestraft, denn diesen gibt es nicht, sondern durch die immer wiederkehrende Seichtheit, die bewusste Vagheit und den Schematismus ihrer Inhalte. Deren glanzvoller »Vorschein« zumindest bleibt libertär, moralisch, integer, kreativ. So kann die beschämende Simplizität der Klassengesellschaft sich gegen Ideologiekritik auf dem Gebiet der Kunst getrost immunisieren, wobei Ideologie sinngemäß anfängt, sobald das Interesse einer Gruppe zum allgemein menschlichen verklärt und das Gegebene, und sei es noch so falsch, zum Notwendigen ernannt wird. Dahinter lugt die wahre Konformität hervor. Im »konkret« kommentiert Berthold Seliger unlängst, die Künstler von heute, ohnehin selten Arbeiterkinder und daher trotz prekärer Verhältnisse neoliberal ideologisiert, würden »mit ihrer auf Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung ausgerichteten Daseinsweise die Entsolidarisierung der Gesellschaft« betreiben und so oder so »gegen Kollektivität und Solidarität« vorgehen. Ein renommierter Künstler mit vollen Taschen und reichen Bekannten demnach – in dieser Eigenschaft durch und durch bürgerliches Subjekt, das sich triumphal in seiner Egozentrik feiert und selbst transzendiert – hat die Welt als eine Objektwelt zur Spielewiese. Für andere ist selbige ihr unabänderlicher Lebensraum. Da klaffen Welten auseinander. Könnte das nicht als Hohn interpretiert werden? Was ist bitte noch Kunst? Welchen Maßstab soll sie denn schon haben!
Jenseits durchaus interessanter Fragen nach ästhetischer Wertaxiomatik und ihrer Objektivität im Allgemeinen oder nach Qualität und Resonanz von Kunstwerken im Besonderen, fragt sich überdies: Wie soll ein Künstlerkollektiv sich weiterentwickeln, wenn nach ersten Erfolgen und anfänglicher Anerkennung fortan vom zahlenden Publikum und unterstützender Mäzenschaft mehr von demselben, immer der gleiche Stil, nur die bewährte Manier begehrt wird? Versteckt sich dahinter nicht ansatzweise eine grundlegend konformistische Stoßrichtung künstlerischer Produktion? Darf die kreative Persönlichkeit nicht evolvieren? Zweifellos wäre zu klären, ob unterm Strich im demokratischen Privatkapitalismus der soziale Schaden für die Kreativität nicht genauso groß ist wie im Fall der staatlichen Auftragskunst, deren Imperativ dereinst die Kunst im realsozialistischen Staatskapitalismus geknechtet hat. Angetan von der sprichwörtlichen Unzufriedenheit unzähliger Musiker, Maler, Bildhauer und Literaten mit der Marktwirtschaft und ihren Zwängen, beschreibt José Carlos Mariátegui 1925, inwieweit diese Unzufriedenheit sich von jener des klassenbewussten Lohnsklaven abhebt: »Der Arbeiter fühlt sich in seiner Arbeit ausgebeutet. Der Künstler aber fühlt sich unterdrückt in seinem Genie, eingeschränkt in seinem Schaffen, betrogen in seinem Anspruch auf Ruhm und Glück.« Seine Diagnose der »unterschätzten Eitelkeit«, die mitunter Protest hervorrufe, auch reaktionären, ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Mehr Bescheidenheit hinsichtlich der Person und mehr Radikalität hinsichtlich der Gesellschaft wären auch heute noch angebracht.
Die klassische Gegenüberstellung in Paaren von Konformismus und Kollektivismus hie und von Nonkonformismus und Individualismus da entpuppt sich zu guter Letzt als bürgerliche Narration und ideologische Konstruktion, mehr nicht. Schon der Bezugsrahmen ist vorneweg individualistisch, um nicht zu sagen, sozialatomistisch beengend. Daraus folgt, dass der geschichtlichen Tatsache, vom Individualismus kommerziell profitiert und ferner eine Rechtfertigung für Egoismus erhalten zu haben, jedwede Erklärung abhandenkommen müsste und man gar nicht mehr begreifen dürfte, wieso er auslöscht, was er verspricht, nämlich, Individualität. Unter seinem Deckmantel hausiert, wie man weiß, wenn man es wissen will, heutzutage die hippe ebenso wie die intellektuelle Konformität, ungeniert wie eh und je. Die Kunst, Abbild ihrer Zeit selbst dann, wenn sie sie künstlerisch nicht einfängt, sondern bloß ideenreich reproduziert, wird dieser Entwicklung nicht gerecht. Die Spanne zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit ist durch die Orientierung am Marktgeschehen in der Tat geschmälert. Rundherum ist es aber recht ruhig geworden. Insbesondere der Berufskünstler dient, ob er will oder nicht, immer auch als narrenfreie Marionette und Maskotte oberer Schichten. Die Illusion seiner Autonomie gilt es daher aufzugeben. Man darf nicht vergessen: Die demokratische Gegenwart tut sich weniger durch den Wegfall einer Logik der Herrschaft als vielmehr durch das Abstreifen allen Raffinements hervor, sodass inzwischen edle Unternehmerworte und Politikeransprachen bewusst wie zynische Phrasen vorgetragen werden und die Kunstschöpfungen aller Art sich absichtlich wie privilegierte, umzäunte Ausbrüche aus dem Reich der Notwendigkeit gestalten. Was unternimmt die Kunst dagegen? Selbstzufrieden besetzt sie eine Nische ihres kleinen Reichs der Freiheit. Dies ist hauptsächlich Anlass und Grund, warum Mario Benedetti mahnend schließt: »Ohne Revolution bleibt Kultur immer Privileg, auf einer Ebene, zu der die Gesellschaft als Gesamtes keinen Zutritt hat.«
Kirre Kunst & versteckte Konformität
Der kapitalistische Kulturbetrieb macht aus Künstlern autozensierte, untereinander konkurrierende Lieferanten erwünschter, marktkonformer Produkte.