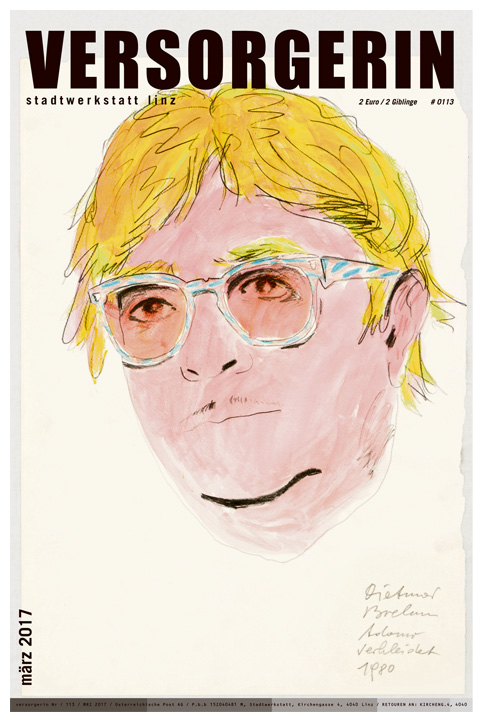Jeder will heute kritischer sein als der Andere. Eine unkritische Haltung ist hingegen wie Mundgeruch: Man bemerkt sie nur am Gegenüber. Der chinesische Starkünstler Ai Wei Wei hat keinen Mundgeruch. Er stellte Anfang 2016 das Bild eines an den Strand gespülten, dreijährigen toten Kindes als Foto nach. Ai Wei Wei hatte sich in den letzten Jahren immer wieder mit humanitären Katastrophen beschäftigt. In Wien schwammen 2016 zu Seerosenmustern arrangierte Schwimmwesten im Teich vor dem Belvedere. In München 2009 waren es 9000 Kinderrucksäcke, die an die tausenden Kinder erinnern sollten, die wegen schlampig gebauter, aber behördlich genehmigter Häuser zu Tode kamen. Der Titel der Einzelausstellung im Münchener Haus der Kunst lautete: »so sorry«.
Ai Wei Wei beansprucht Einfühlung für sich. Er will aufrütteln, sensibilisieren und Empathie für das Leid der Namenlosen wecken – und macht sich damit selbst einen Namen.
Wem hilft Mitleid? Zunächst einmal dem, der es aufbringt und sich besser damit fühlt, als wenn er keines hätte.
Der Dokumentartheatermacher Milo Rau nannte eines seiner letzten Stücke »Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«. Er spricht in Interviews von zynischem Humanismus, nennt die Willkommenskultur eine Wohlfühl-Ethik und fordert statt Einfühlung politisches Handeln und gelebte Solidarität.
Die beiden künstlerischen Positionen könnten kaum konträrer sein, was ihr Verständnis von Gesellschaftskritik betrifft. Und doch finden beide offene Ohren und willige Institutionen. Ai Wei Wei ist eine sichere Bank für fette Kunsttanker, die am liebsten mit als engagiert und kritisch geltenden Blockbustern reüssieren und dem Publikum einen diffusen Gefühlsmehrwert liefern. Rau‘s Ansatz hingegen wendet sich gegen Routinen und Rituale leerlaufender Kritik in den Theaterhäusern – und ist als raffiniert verschärfte Repräsentationskritik immer auch ein Stück Institutionskritik, die international heiß begehrt ist am Theatermarkt.
Institutionskritik wird von Institutionen, die etwas auf ihre Zeitgenossenschaft halten, geliebt und eingefordert – zumindest solange sie in ein spielbares Stück oder eine zeigbare Ausstellung mündet. Sie erscheint immer öfter als embedded critic.
Das führt zu gern beklagten Widersprüchen. Institutionen wollen sich gegen Kritik immunisieren und bestellen sich daher selber eine Kunst mit Biss, die dort zwackt, wo es nicht wirklich weh tut. Der argentinische Künstler Adrian Villar Rojas hat 2014 eine sogenannte lebende Skulptur aus sargartig geschichteten, organischen und anorganischen Materialien nach Frankreich geliefert. Sie heißt »Where the Slaves Live« und findet sich im luftigen Zwischendeck des von Frank O. Gehry entworfenen, schicken Kunsttempels der Foundation Louis Vuitton im noblen Pariser Vorort Neuilly. Das Werk mit kritischem Ökotouch und postkolonialem Flavour wurde von der Stiftung eigens für den Ort in Auftrag gegeben.
»Beziehungsarbeit« hieß eine Ausstellung über das Verhältnis von Kunst und Institutionen. Kritische Kunst und Institutionen können nicht miteinander, aber ohne einander schon gar nicht. Unsichtbar bleibt in dieser Betrachtung freilich sämtliche Kunst, die entweder auf eine Weise kritisch ist, die für eine Institution schlicht nicht professionell genug ist oder aber selbst keinerlei Interesse an institutioneller Teilhabe zeigt. Hier öffnet sich das Feld auch in Richtung Nihilismus, Dilettantismus, Obsession und Outsider Art. Radikale Negation, Kommunikationsabbruch oder selbstgewählter Isolationismus sind Beschreibungsformeln für die grundsätzliche Beziehungsverweigerung zwischen Kunst und Institution.
Die Widersprüche sind unauflösbar. Daher werben Biennalen mit der einen Hand um politisches Wohlwollen und Geld und zählen mit der anderen die Frauenquote auf der KünstlerInnenliste, während von den kritischen Kuratorinnen bevorzugt solche Künstlerinnen eingeladen werden, die sich kritisch mit der Unterrepräsentiertheit von Frauen im Kunstbetrieb beschäftigen. Kommerzielle Galerien leisten sich in ihren aufgeblähten Presseaussendungen poststrukturalistisch-postkolonial-queeren Live-Talk. Kunstmessen laden kritischen TheoretikerInnen ein, um die Flaniermeilen zwischen den Kojen mit kritischem Dekor aufzuputzen. Umgekehrt entern kritische KulturproduzentInnen kurzfristig Museen, um dort Seminare zu Themen wie »Critical Management in Curating« zu veranstalten.
Künstlerische Positionen laden sich heute selbstbewusst mit Diskursen auf und müssen sich zugleich immer öfter diskursiven Herausforder-ungen stellen. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft, die künstlerische Forschung, ist so zu einem eigenen Genre geworden. Gern spricht man heute im Kunstbetrieb vom educational turn, also einer Wende zum Pädagogischen. Der künstlerische Prozess artikuliert sich dabei oft immateriell, als Symposium, Recherche, Lecture, Workshop, internationales Palaver, kurz: Als Erziehung zum Guten. Auffällig ist, dass die Kunst der Kritik dabei meist nicht mehr gegenübersteht, sondern ihrerseits schon als Kritik auftritt. Der Kommentar, die kritische Durchdringung wird selbst zum zentralen Bestandteil der Kunst.
Traditionellerweise, erinnert Helmut Draxler in einer einschlägigen Studie, lief das bürgerliche Muskelspiel zwischen den substanzialisierten Begriffen von Kunst und Kritik so: Kunst muss sich vor einer Kritik bewähren, die sie nobilitiert, kanonisiert und den Öffentlichkeiten und Märkten als kritikgeprüfte Kunst anbietet. Ohne die Kritik wäre Kunst nackt. Und nackt stelle sie nichts dar – weder einen satisfaktionsfähigen Diskurs, noch einen Status. Diese Aufwertung kann die Kritik nur leisten, indem sie dem Werk etwas zuschreibt: Meisterschaft, Könnerschaft, Stil, Raffinement, Imagination, Referenzialität, Komplexität, Relevanz usw. Oder auch, vornehmlich in dem Feld, das als politische Kunst verhandelt wird: Einen kritischen Gehalt.
Heute firmiert der kritische Gehalt im Kunstdiskurs unter dem anglo-amerikanischen Begriff der Criticality. Diese soll den kritischen Gehalt eines Kunstwerks anzeigen wie ein Thermometer die Körpertemperatur. Entsprechend emphatisch wird sie von der avancierten Kunstkritik eingefordert. Doch natürlich lässt sich die Relevanz eines Einspruchs nicht wie Fieber messen. Die Bestimmungsgröße von Kritikalität ist unklar, auch wenn es ein vermehrtes Begehren nach ihrem Nachweis gibt. Kunst und Kritik pflegen, wie alle »Kunst und«-Legierungen, ein notorisch gespanntes Verhältnis. Dieses manifestiert sich auch im, der kritischen Kunst verwandten, oft eingeforderten und viel geschmähten Begriff der politischen Kunst, die sich zur Politik nicht mehr verhält, sondern sich selbst als Politik versteht. Kunst als Politik oder vielleicht sogar statt Politik.
Es mag trivial klingen, aber in Bezug auf Kritik, ist es sinnvoll, nochmals darauf hinzuweisen, dass sich Kunst nicht auf Information reduzieren lässt. Ein Kunstwerk ist immer auch etwas Anderes als das, wofür man es hält. Im Theater kann die Fiktion die Eintrittskarte für das Spiel sein, aus dem Ernst werden soll. Der Glaube an Interpretierbarkeit und Durchsetz-barkeit der Absicht ist dabei Voraussetzung für deren nicht beherrschbare Wirkung: Etwas wird passiert sein, hoffentlich. Aber steuerbar durch eine Kritik, die man durch den TÜV fährt, ist diese Zukunft nicht.
Das Unbehagen an der Inanspruchnahme der Rede von der Kritik im Singular lässt sich abschließend vielleicht so formulieren: Erst die Exit-Option aus den Fesseln des Kritischen eröffnet einen Raum für eine tatsächlich kritische Praxis, die zu frei und zu falsch ist, um sich auf moralische Anliegen und politische Wahrheiten reduzieren zu lassen.
KünstlerInnen verfassen keine Kritik im sauberen soziologischen oder philosophischen Sinn. Sie müssen sich in ihrem Tun nicht um den Ausweis der Normativität der Kritik scheren, sie müssen sich nicht um interne oder externe Maßstäbe der Kritik kümmern oder um die Frage, ob ein ideologiefreier Ausblickspunkt der Kritik überhaupt denkbar ist. Ihre Ansätze entziehen sich der überprüfbaren Eindeutigkeit und vollziehen sich, anders als eine soziologisch fitte Kritik, wenn überhaupt, dann in der metakritischen Verfehlung einer als kritisch durschaubaren und also einhegbaren Absicht. Wenn Kritik aber als moralischer Appell verstehbar und zuordenbar wird und der Stachel der Negativität gezogen ist, dann lauert der Wirkungstreffer der guten Absichten im Saal: Die Betroffenheit. Sie bringt den betroffenen Geist nicht von seinen Gewissheiten ab, solange Ich– und Weltbild nicht produktiv destabilisiert werden.
Betroffenheit allein ist ein anderes Wort für Gesellschaftskritik, die zu nichts führt.
Dieser Text wurde zuerst vom Impulse Theater Festival veröffentlicht. http://www.festivalimpulse.de/de/news/847/thomas-edlinger-ueber-kritik-in-der-kunst
Kritisch-Sein: Immer diese Widersprüche!
Über die »Kunst und«-Legierung Kunst und Kritik schreibt Thomas Edlinger.