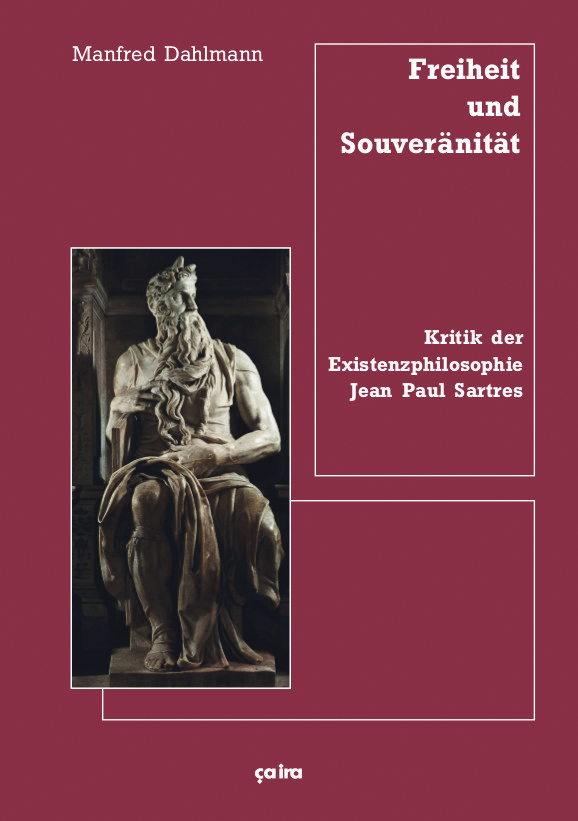Alle Schwierigkeit der Philosophie könnte darin gesehen werden, die conservatio sui oder den conatus, wie Spinoza das Prinzip der Selbsterhaltung nannte, als Subjekt-Objekt-Verhältnis zu begreifen, statt als Substanz oder Sein oder eine andere, wodurch auch immer bezeichnete Einheit (Schicksal, Gott, Struktur etc.), die sich üblicherweise – wie Manfred Dahlmann so akkurat und unermüdlich kritisiert – der Trennung von Subjekt und Objekt vorausgesetzt findet. Auch die Bindung jedes Bewusstseins an den je einzelnen Leib, welche doch unaufhebbar gegeben ist, bietet insofern kein Erstes, als von ihm selbst nur zu sprechen allein durch jene Trennung möglich ist und das Bewusstsein sich bloß durch sie hindurch als an einen Leib Gebundenes erkennt. In der Auflösung des unterstellten Ersten, einer vorgegebenen Identität, liegt die Bedeutung der Polis und ihrer Philosophie für den Wahrheitsbegriff: »Denn auf dem Gebiet der Zusammensetzung und der Trennung hat das Falsche und das Wahre statt«, heißt es im Organon des Aristoteles, und daraus folgt das Urteil als die Einheit, »ursprünglich als Bejahung, dann als Verneinung«. Selbsterhaltung wäre demnach so zu bestimmen, dass sie als selbstverständliche Einheit nicht zugrunde gelegt werden kann, sondern immer nur als etwas Herzustellendes oder zu Gewinnendes betrachtet werden müsste; etwas, das aus dem Mannigfaltigen und Getrennten allererst hervorzubringen ist. Als Probehandeln droht dem Denken, das doch der virtuellen Einheit bedarf, um Mannigfaltigkeit überhaupt zu erfassen, an dieser Stelle stets, was die Logik einen Zirkelschluss nennt. Desto wichtiger, sie umgekehrt als »Synthesis« (Kant) oder »Resultat mit seinem Werden« (Hegel) ins Auge zu fassen, um in der Reflexion Mannigfaltiges und Getrenntes als solches auch weiterhin wahrzunehmen ebenso wie Antinomie und Widerspruch zu formulieren.
So erhalten die Herangehensweisen von Marx und Freud geradezu paradigmatische Bedeutung, insofern sie dieser erkenntniskritischen Problematik sich ziemlich bewusst den physischen Charakter der Reproduktion als Fluchtpunkt setzen: Obwohl alle stofflichen Bestandteile und Vorgänge, die von gesellschaftlicher oder kultureller Kausalität zeugen, der Natur angehören, die sie kraft solcher Kausalität verändern, und sei es nur die elektronische Versendung oder Speicherung einer Information, ergibt sich fürs Bewusstsein der Individuen – ihrerseits Natur bis zur einzelnen Synapse ihrer Nervenzellen, mit denen sie denken – keine wirkliche Synthese aus dieser Natur, was immer sie auch sich dabei vormachen, indem sie ihr Handeln von ihr schlüssig ableiten wollen. (Gesellschaft und Kultur sind darum in bestimmter Hinsicht nur Begriffe für diese Leerstelle.) Den verschlungenen Wegen zu folgen, wie sie dennoch, sei es als Produktionsverhältnis oder als Ich, hergestellt wird, sodass hier Subjekt und Objekt als aufeinander Bezogenes hervortreten, ohne sich aus dem jeweils Anderen schon zu erschließen – unter der Voraussetzung also, dass die Menschen natürliche Triebe haben, deren Gegenstand der Befriedigung von der Natur nicht festgelegt ist –, bildet den inneren Zusammenhang von Kritik der politischen Ökonomie und Psychoanalyse.
Marx schrieb bereits in den Pariser Manuskripten von 1844: »Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozeß bleiben muß, um nicht zu sterben. Daß das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen andren Sinn, als daß die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der Natur.« Durch den Begriff der abstrakten Arbeit als Substanz des Werts kann schließlich mit dem Marx des Kapital nachgewiesen werden, dass von der Arbeit nichts als Moral übrig bleibt, wenn – wie es realiter unterm Kapitalverhältnis geschieht – von jenem Prozess abstrahiert wird. So wie Freud dargelegt hat, dass von der Moral nichts als Arbeit übrig bleibt, wird nicht reflektiert, dass jedes Bewusstsein beständig mit den psychischen Repräsentanten des Leibes konfrontiert ist, also mit den Trieben: den »aus dem Körperinneren stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist«. Nicht zufällig kommen beide Denker aus dem Judentum (wie sehr sie sich auch von seiner Religion abzugrenzen suchten), das mit seiner scharf gezogenen Linie zwischen Gottesbegriff und Menschendasein – neben der Polis – der große Lehrmeister darin ist, die Trennung jeder Einheit voranzustellen.
Demgegenüber erweist sich der in der Tradition Heideggers geprägte und verabschiedete Begriff des Subjekts, der von vornherein einer ohne Objekt war, nur als unmittelbarster Ausdruck davon, dass die Bedingungen der Reproduktion nicht zu Bewusstsein kommen; dass sie gleichsam hinter dem Rücken der Individuen liegen, was jedoch – von dieser Tradition geflissentlich verschwiegen – nur möglich ist, wenn sie selber ihnen den Rücken bewusst zukehren, um desto zwanghafter der Denkform zu folgen, irgendeine Einheit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis vorauszusetzen beziehungsweise an dessen Stelle zu setzen. Wieviel »Unaufrichtigkeit« (»mauvaise foi«) schon in dieser Voraussetzung aller Ideologie liegt, hat hingegen Jean-Paul Sartre in L’être et le néant ausführlich erörtert. Aber es gelang ihm merkwürdigerweise nur soweit, als er seinerseits das Prinzip der Selbsterhaltung zu explizieren vermied. Man könnte vielleicht sagen, er bekommt die Frage des conatus nicht mehr in den Blick, weil er ebenso von Heidegger ausgeht und sein eigenes Denken als eine Art immanente Kritik von Sein und Zeit entwickelt, die allerdings dessen Seinsbegriff vorsätzlich oder unwillkürlich mit der »menschlichen Existenz« des Individuums übersetzt, um den dazu gehörigen Zeitbegriff, das Sein zum Tode, abzuschaffen: Le faux, c’est la mort.1
Die Philosophie vor dem Einbruch der Existentialontologie war noch dadurch geprägt, die Freiheit im Subjekt und die Selbsterhaltung des Individuums, das wiederum als Teil eines Ganzen begriffen wird, in verschiedensten Entwürfen und Systemen zusammenzudenken. Spinoza schreibt, niemand könne sein natürliches Recht oder seine Fähigkeit, frei zu schließen und über alles zu urteilen, auf einen anderen übertragen, noch könne er zu einer solchen Übertragung gezwungen werden; bei Kant heißt es emphatisch: »Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«; und bei Hegel findet sich der prononcierte Satz: »Im Denken bin Ich frei, weil ich nicht in einem Anderen bin … meine Bewegung in Begriffen ist eine Bewegung in mir selbst.« Spricht Spinoza vom Urteilen, Kant vom Verstand und Hegel von Begriffen, dann ist dabei stets, wie versteckt auch immer, die Selbsterhaltung als Inbegriff des Urteilsvermögens mitgedacht. Aufschlussreich an Sartre ist, dass er, wenn er die Freiheit im Fürsichsein festhält, zwar keineswegs leugnet, dass es Unterschiede geben muss in dem, wofür es sich jeweils entscheiden mag (und sie zu konturieren soll der Begriff der Situation leisten), denn das würde auch die Freiheit selbst aufheben. Aber – so der erste Eindruck, den diese Philosophie hinterlässt – die Freiheit festzuhalten beinhaltet, um Wahrheit und Wahrhaftigkeit Genüge zu tun, nicht mehr zugleich, kategorisch zwischen Vernunft und Unverunft, Verstand und Unverstand, richtigen und falschen Begriffen zu unterscheiden. Eben deren Unterscheidung – ohne welche die Wahl, so eine gängige Sartre-Kritik, denn doch nur ein kriterienloser unvermittelter Sprung sei, der überhaupt nicht mehr als Wahl beschrieben werden könne – verweist zweifellos auf die Selbsterhaltung als Synthese. Und bei Spinoza wird das noch am deutlichsten – also als Ethica – ausgesprochen: Im Streben unseres Geistes kann keine Tugend vor der Tugend des Selbsterhaltungsstrebens gedacht werden.
In Wahrheit beharrt L’être et le néant gerade auf dieser »Tugend«. Sartre kann es allerdings nur negativ ausdrücken: Der Tod ist das Sinnlose. Er verweigert einen positiven Bezug (es sei denn im ganz abstrakten Begriff der Zukunft, der aber dadurch bestimmt ist, die Subjekt-Objekt-Trennung nicht aufzuheben), um im direkten Gegensatz zu Heidegger eben kenntlich zu machen, dass es, wie Manfred Dahlmann schreibt, »im Verhältnis der Freiheit zu dem ihr Äußeren – philosophiegeschichtlich im Verhältnis von Seele und Leib – kein Drittes gibt, das ihm logisch oder von Natur aus vorangestellt werden könnte«. Sartre kritisiert solche Hypostasierung, indem er allerdings jeden Versuch der Synthesis zu verwerfen scheint. An deren Stelle findet sich eine »Konfrontation im Subjekt«, und zwar »mit Objekten, denen es dieselbe Reflexionsfähigkeit wie sich selbst zugestehen muß. Im Blick des Anderen auf sich erkennt es sich als Einen, der in derselben Weise wie der Andere auf ihn als dessen Anderen blickt. Es ist dem Menschen unmöglich, die in dieser Konfrontation einsetzende Reflexion auszuschalten, sie begleitet ihn, der Kantschen Ich-Bestimmung analog, ständig, wenn auch anders, als Kant sich das in Bezug auf das Transzendentalsubjekt, das als verallgemeinerte Form des Ich gefaßt werden kann, dachte – oder zumindest nahelegte –, nur im besonderen, an einen Leib gebundenen Individuum, also nicht in einem transzendentalen Allgemeinen.«2 L’être et le néant widersteht dem Bedürfnis, die Einheit von Ich und Reflexion in ein dem Ich äußeres Dritte zu verschieben, sei es Substanz, Transzendentalsubjekt oder Weltgeist.3 Die Kritik, die in dieser phänomenologischen Ontologie zu entdecken ist, zielt somit auf das, was bisherige Philosophie in ihrem Vernunftbegriff wenn nicht verdrängt so im Gegenteil verklärt hat: Sobald die Einheit von Ich und Reflexion in ein Drittes verschoben wird, wird auch die conservatio sui des Ich jederzeit als Mittel betrachtet, sei’s von Gott oder Gemeinschaft, Staat oder Führer, und kann in deren Namen gegen ein Anderes, ihm Entgegengesetztes, ausgetauscht werden: die Bereitschaft zum Opfer.4
Der vollständige Artikel erscheint im kommenden Heft der sans phrase (12/2018) zum Gedächtnis Manfred Dahlmanns, aus dessen Buch Freiheit und Souveränität. Kritik der Existenzphilosophie Jean-Paul Sartres (Freiburg: ça ira 2013) hier zitiert wird.
Die Selbsterhaltung als springender Punkt
[1] So hat es Jean Améry in seiner Sartre-Deutung, des Widerspruchs zu Heidegger sich bewusst, zugespitzt.
[2] Darum ist es vollends absurd, Sartres Philosophie mit der von Max Stirner gleichzusetzen. Dessen »Einziger« starrt sozusagen immer nur in den Spiegel und betrachtet es als sein »Eigentum«, keinerlei Bewusstsein davon zu haben, dass er eben hierin wieder nur den Blick des Anderen zu imitieren sucht. Es ist aber kein Wunder, wenn Hans G [sic!] Helms durch eine Sartre-Polemik, die auf jener Gleichsetzung beruhte, vom überaus begabten Adorno-Schüler zu einem Marxisten im philosophischen Format der DKP regredierte (siehe Hans G Helms: Die Ideologie der anonymen Gesellschaft. Köln 1966).
[3] In diesem Sinn hat jemand wie Charles Taylor Sartre ganz gut begriffen: Er lehnt L’être et le néant ab, weil er dem Subjekt – ganz ähnlich wie Carl Schmitt – immer schon die kollektive Identität vorangestellt wissen will.
[4] Die Misere von Sartres politischem Engagement liegt darin, dass er sich vom Marxismus das Vermögen erwartete, zwischen richtigen und falschen Begriffen zu unterscheiden, was sich als fataler Irrtum oder vielmehr mit Sartre gesprochen als Unaufrichtigkeit herausstellen musste: Denn der Blick des Anderen wird nun durchs Kollektiv der Arbeiterklasse beziehungsweise der kolonisierten Völker abgeblendet. An einigen zentralen Stellen seiner Kritik der dialektischen Vernunft und in wesentlichen Teilen seiner großen Flaubert-Studie Der Idiot der Familie gelang es ihm allerdings, davon sich wieder freizumachen. Umso mehr suchen heutige Marxisten wie Alain Badiou an den politisch engagierten Sartre anzuschließen und L’être et le néant zu desavouieren oder zu verdrängen. »Die Geschichte des politischen Sartre ist die Geschichte eines Scheiterns«, schrieb Jean Améry und fügte indirekt hinzu, dass man darüber nur froh sein kann.
Gerhard Scheit lebt als freier Autor in Wien. Er ist Mitbegründer der ideologiekritischen Zeitschrift sans phrase und veröffentlicht zu zahlreichen Themen aus dem Umkreis der Kritischen Theorie, darunter besonders zur Kritik der politischen Gewalt, der Kritik der politischen Ökonomie und der Kritik des Antisemitismus. Im August 2022 erschien sein neues Buch »Mit Marx. 12 zum Teil scholastische Versuche zur Kritik der politischen Ökonomie« im ça ira-Verlag.