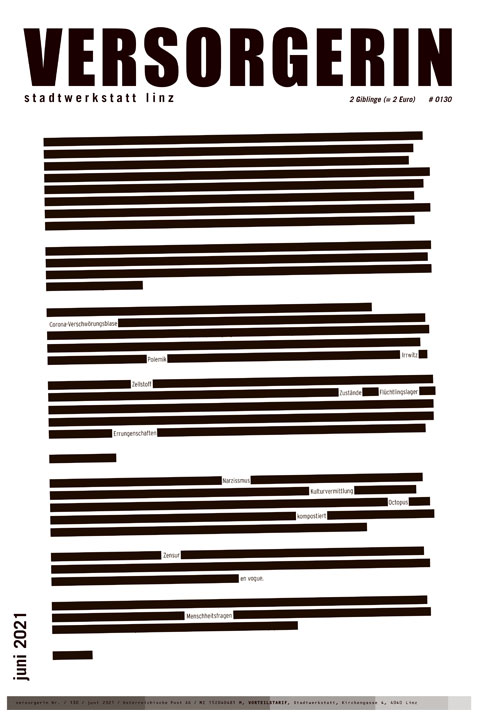Der Schriftsteller Franz Kafka empfand schon die Tatsache, dass Grammophone „in der Welt sind, als Drohung“, wie er 1912 in einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer, bemerkte. Bauer arbeitete damals als Prokuristin bei der Carl Lindström AG, einem Industriebetrieb, der ursprünglich auf die Herstellung von Grammophonen spezialisiert war, zu der Zeit aber bereits Aufnahmestudios betrieb und sich auf dem Weg zum größten Schallplattenproduzenten Europas befand. „Nur in Paris haben sie mir gefallen“, fährt Kafka im Brief an Felice Bauer fort, „dort hat die Firma Pathé auf irgendeinem Boulevard einen Salon mit Pathephons, wo man für kleine Münze ein unendliches Programm (nach Wahl an der Hand eines dicken Programmbuches) sich vorspielen lassen kann. Das solltet ihr auch in Berlin machen, wenn es das nicht schon gibt.“ Kafka würde das „unendliche Programm“ der Musikstreaming-Giganten unserer Tage vermutlich sehr gefallen – der weltweit größte Audio-Streaming-Abonnementdienst Spotify bietet ebenso wie sein Konkurrent Apple Music aktuell über 70 Millionen Musikstücke an, und all diese Tracks sind nur einen Fingertipp entfernt: Hörer:innen können sie im Abonnement für knapp 10 Euro monatlich hören (das „Premium“-Konto) oder sogar ohne Bezahlung, dafür mit Werbeeinspielungen (das sogenannte „Freemium“-Modell).
Streamingdienste wie Spotify, Apple Music, Amazon Prima, Deezer sowie spezialisierte Plattformen wie Idago oder Tidal und nicht zuletzt YouTube haben das Geschäftsmodell der Musikindustrie von den Füßen auf den Kopf gestellt: Wir haben im letzten Jahrzehnt die umfassende Transformation von einem Besitzmodell hin zu einem Zugangsmodell erlebt. Die Musikfans müssen nicht mehr Vinyl-Alben oder gnadenlos überteuerte Billigprodukte wie die weiland von der Tonträgerindustrie durchgesetzten CDs erwerben, um Musik zu hören, sondern sie können Musik hören, ohne sie zu besitzen. Wer sich an die Zeiten erinnern kann, als das Taschengeld oder der Arbeitslohn gerade für den Erwerb einer oder vielleicht von zwei oder drei LPs im Monat ausreichte, wird die dank Musikstreaming zur Verfügung stehende musikalische Vielfalt, eben Kafkas unendliches Musikprogramm, sehr zu schätzen wissen. Gleichzeitig hat das Streaming letztlich entgegen häufig zu hörender anderslautender Behauptungen den Wert der Musik nicht etwa gemindert, sondern gesteigert: Es kommt nicht mehr wie im alten Musikgeschäft darauf an, wie viele Singles oder Alben verkauft werden (die dann ja, ähnlich wie zu Weihnachten verschenkte, ungelesene Buch-Bestseller eventuell ungehört im Archiv verstauben), sondern es kommt darauf an, wie häufig die Musik tatsächlich angehört wird, wie oft die einzelnen Songs oder Musikstücke tatsächlich von den Fans abgespielt werden. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Verkäufen, also dem Besitz, sondern er liegt auf dem Anhören von Musik.
Das müsste den Musiker:innen eigentlich gut gefallen. Dennoch hat das Modell des Musikstreamings just unter den Musiker:innen und Songwriter:innen einen schlechten Ruf. Fast täglich barmen in den Medien Musiker:innen, dass sie heute undank Spotify & Co. nichts mehr verdienen würden und sich weder Miete noch Kaffee leisten könnten. Und zu kaum einem anderen Wirtschaftsbereich sind derart viele Falschbehauptungen, Gerüchte und Unwahrheiten im Umlauf wie beim Streaming, weswegen es sich lohnt, einen Blick auf die Fakten und auf die Ökonomie des Musikstreamings zu werfen.
Zunächst: Immer wieder ist zu lesen oder zu hören, wie wenig Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music an die Musiker:innen auszahlen würden – und die Zahlen, mit denen diese Behauptungen untermauert werden, reichen aktuell von 0,164 Cent (Hessischer Rundfunk) über „durchschnittlich 0,3 Cent“ (der österreichische Musikmanager Hannes Tschürtz) beziehungsweise 0,38 Cent (Der Spiegel), „durchschnittlich 0,397 Cent“ (The Guardian), „aktuell zwischen 0,26 und 0,43 Cent“ (taz) und 0,4 Cent (Neues Deutschland) bis hin zu „rund 0,5 Cent“ (Neue Zürcher Zeitung) pro Stream. Nun: stimmen tun sie alle nicht, diese Zahlen.
Erstens: Es gibt schlichtweg keine festgelegten Beträge, die Spotify (um die Lage anhand der Zahlen des weltgrößten Musikstreamingdienstes zu klären) an die Rechteinhaber (!) auszahlen würde. Einfach, weil es im Abrechnungsmodell grundsätzlich zwei Variablen gibt: Die Zahl der Abonnent:innen und die Höhe der Werbeeinnahmen im betreffenden Monat, woraus sich die gesamten monatlichen Einnahmen des Streamingdienstes ergeben, sowie die Zahl der monatlichen Streams, also der Abrufe pro Musikstück. Beide Variablen ändern sich in jedem Abrechnungsmonat. Alle Einnahmen kommen bei dem „Pool“-Auszahlungsmodell der Streamingdienste in einen großen Topf, und die Rechteinhaber erhalten ihren sich in jedem Abrechnungszeitraum entsprechend verändernden Anteil pro Stream. Es gibt bei Spotify schlicht keine Pro Stream-Rate – es gab sie nie, es gibt sie aktuell nicht, und es wird sie auch in Zukunft nicht geben.
Zweitens: Kein Streamingdienst zahlt Geld direkt an die Musiker:innen oder die Songwriter:innen aus. Wenn Sie also von Musiker:innen hören, die von ihrer „Spotify-Abrechnung“ berichten, ist größtes Misstrauen geboten. Denn keine Musiker:in kann eine Abrechnung eines Streamingdienstes in Händen halten. Never. Die meisten Streamingdienste zahlen knapp 70 Prozent all ihrer jeweiligen Einnahmen im Abrechnungszeitraum (in der Regel monatlich) an die Rechteinhaber der Musikstücke aus – eine gigantische Zahl. Der Musikmanager Hartwig Masuch, Chef von BMG Rights Management, hält das Musikstreaming daher zu Recht für „die lukrativste Vergütung seit Erfindung der Musikindustrie“ – wo sonst werden schon 70 Prozent des gesamten Umsatzes an die Künstler:innen weitergegeben?
Spotify beispielsweise zahlt zwischen 52 und 55 Prozent für die Leistungsschutzrechte an die Inhaber der Aufnahmen (also in aller Regel an die Plattenfirmen) sowie zwischen 11 und 15 Prozent als Tantiemen für die Urheberrechte an die Songwriter:innen. Hier zeigt sich ein grundsätzliches Abrechnungs-, noch mehr aber ein Bewertungsproblem innerhalb der Musikindustrie: Ist die Aufnahme eines Musikstücks wirklich mehr als drei Mal so viel wert wie das Stück selbst, also wie die Komposition oder, im Fall eines Songs, wie dessen Melodie und Text? Hier handelt es sich um ein sozusagen historisches Missverhältnis, das wohl überprüft und zugunsten der Komposition geändert werden sollte.
Laut Spotify erhalten die Rechteinhaber, nämlich in aller Regel die Plattenfirmen sowie die Musikverlage (oder Verwertungsgesellschaften wie die AKM) – also die Musikindustrie, nicht die Künstler:innen! – pro Musikstream zwischen 0,6 und 0,84 Cent US$ (diese Zahlen sind variabel, siehe oben). Klar ist, dass die Musiker:innen, egal, ob sie einen Song geschrieben oder aufgenommen haben, einen deutlich größeren Anteil an diesen Einnahmen erhalten sollten, als es bisher der Fall ist. Der entscheidende Faktor ist jedoch nicht, wieviel Spotify an die Rechteinhaber auszahlt, sondern was passiert, nachdem das Geld auf den Konten der Musikindustrie gelandet ist. Bis heute haben viele Musiker:innen immer noch einen aus analogen Zeiten herrührenden, traditionellen „Royalty Deal“ („royalties“ sind die Lizenzgebühren): Danach werden diese Einnahmen im Verhältnis von 80 zu 20 zugunsten der Plattenfirmen aufgeteilt; die Musiker:innen erhalten hier gerade einmal 10,8 Prozent vom Umsatz eines Musikstreams. Zu Zeiten von Vinyl und CDs hatten diese Deals eine gewisse Berechtigung, weil die Herstellungs-, Lagerungs- und Vertriebskosten der Plattenfirmen beträchtlich waren und irgendwie finanziert werden mussten. Im Streamingzeitalter sind derartige Royalty Deals im Grunde ein Skandal und bestätigen höchstens die fragwürdige Rolle vieler Plattenfirmen, wie sie der legendäre britische Radio-DJ John Peel einmal beschrieben hat, wonach sie „zu nichts anderem da“ seien, „als möglichst viel Geld zu verdienen, von dem sie den Musikern möglichst wenig abgeben“.
Aber selbst im Fall des heute üblichen und von den meisten Indie-Plattenfirmen gepflegten „Joint Venture Deals“, der hälftigen Teilung der Streaming-Einnahmen, erhalten die Musiker:innen nur etwa 27 Prozent von einem Musikstream. Fair wäre es, wenn Musiker:innen statt 20 oder 50 mindestens einen 75 Prozent-Anteil von den Plattenfirmen erhalten würden, wie es Masuchs BMG den Künstler:innen seit geraumer Zeit prinzipiell anbietet. In diesem Fall würde ihr Anteil an jedem Musikstream auf 40,5 Prozent wachsen.
Spotify hat 2018 den Musiker:innen übrigens sogenannte „direct deals“ angeboten: Danach würden sie einen fünfzigprozentigen Anteil der Streamingeinnahmen erhalten, also noch mehr, als wenn die Musiker:innen einen 85%-Deal mit Plattenfirma oder Vertrieb hätten; allerdings würde ihnen in diesem Fall auch keiner der Services zur Verfügung stehen, den Plattenfirmen für gewöhnlich anbieten, wie Marketing, Radiopromotion, Vertrieb „physischer“ Alben (also LPs und CDs) oder die Einstellung ihrer Tracks auf allen verschiedenen Plattformen weltweit.
Die Frage, die sich Musiker:innen also vor allem stellen sollten: Welchen Vertrag habe ich eigentlich mit meiner Plattenfirma (oder mit einem Vertrieb bzw. einer Firma, die den Service anbietet, meine Musik auf Streamingplattformen einzustellen)? Das ist der Schlüssel zu einer fairen Vergütung beim Musikstreaming. It’s the labels and your contract with your label, stupid! Statt jedoch ihre Verträge mit den Plattenfirmen und Musikverlagen zu überprüfen, beklagen sich alle möglichen und unmöglichen Musiker:innen, dass sie undank der Streamingfirmen nichts mehr verdienen würden; manche von ihnen lassen sich zu einer allgemeinen, biederen Technologiefeindlichkeit hinreißen. Zurück zur Postkutsche aus Angst vor dem Verkehr…
Einige Musiker:innen fordern, dass das bestehende „Pro-Rata“-Abrechnungsmodell (bei dem wie beschrieben die Gesamtanzahl aller Streams in einem festgelegten Zeitraum berücksicht wird, alle Einnahmen in einen Topf fließen und nach der Zahl der Klicks abgerechnet wird) durch ein „User-centric“-Modell (das Geld der User wird lediglich unter den Streams aufgeteilt, die die jeweiligen User gehört haben) ersetzt werden sollte. Von diesem Nutzer:innen-zentrierten Modell erhoffen sich seine Verfechter:innen eine Verbesserung der Einnahmen speziell der kleineren Künstler:innen und eine stärkere Relevanz der lokalen Märkte. Zwar würden, so eine französische Studie, durch das „User centric“-Bezahlmodell die Streamingeinnahmen in manchen Nischengenres (Klassik, Jazz) geringfügig steigen – gleichzeitig würden die Auszahlungen im Rap und Hip-Hop allerdings um etwa ein Fünftel geringer ausfallen. Aber: wäre es gerecht, wenn ausgerechnet die vor allem schwarzen Rapper:innen und Hip-Hopper:innen finanziell dafür bestraft würden, dass ihre Musik nun einmal so populär ist und von zig Millionen Menschen gestreamt wird? Was soll fair daran sein, erfolgreiche Musiker:innen, die die durchschnittliche Anzahl von Streams per Nutzer:innen weit übertreffen, zugunsten von weniger erfolgreichen Musiker:innen zu benachteiligen? Und: das User-zentrierte Abrechnungsmodell würde jenseits der 10.000 meistgestreamten Acts in der Abrechnung sowieso nur marginale Veränderungen von bestenfalls ein paar Extra-Euros nach sich ziehen.
Wie auch immer: An Spotify wird ein derartiges „User centric“-Modell, das auch von vielen Indie-Plattenfirmen bevorzugt wird, kaum scheitern, man wird es vermutlich ausprobieren, falls die Musikindustrie zustimmt – denn den Streamingfirmen kann es letztlich völlig egal sein, wie die knapp siebzig Prozent, die sie auszahlen, aufgeteilt werden.
Knapp 26.000 Musiker:innen betreiben die Kampagne „Justice at Spotify“, deren Hauptforderungen lauten, dass erstens die Aufteilung der Spotify-Ausschüttungen „transparent“ gemacht werden solle (sie fordern nicht etwa, was dagegen ja wirklich sinnvoll wäre, die Transparenz der Verträge von Plattenfirmen mit den Streamingdiensten auf der einen und mit den Künstler:innen auf der anderen Seite), und zweitens soll künftig nach ihrem Willen mindestens 1 Cent pro Stream an die Musiker:innen ausgezahlt werden. Man kann es nicht oft genug sagen: Die Streamingdienste zahlen keine Vergütung pro Stream! Vor allem aber: Wie soll das gehen? Wie bereits beschrieben: Die Streamingdienste zahlen knapp 70 Prozent ihrer gesamten Einnahmen an die Rechteinhaber aus. Im Grunde ist dieser ausgezahlte Anteil zu hoch und wider alle wirtschaftliche Vernunft – er ist letztlich dadurch entstanden, dass die Plattenfirmen als Inhaber der Musikaufnahmen in einer extrem starken, ja, man könnte sagen: durchaus erpresserischen Position waren, als die Streamingdienste ihre Arbeit aufnahmen. Was Spotify & Co. seinerzeit benötigten, war Musik, und die konnten sie nur von den Plattenfirmen erwerben. Die Labels konnten daher die Bedingungen diktieren – und das taten sie! Sie sorgten dafür, dass sie nicht nur einen sehr hohen Anteil der Streamingumsätze erhielten, sondern auch beträchtliche Vorauszahlungen (die die Labels natürlich keineswegs an ihre Künstler:innen weitergaben…) sowie nennenswerte Unternehmensanteile: Die damals noch vier Majors und die in ihrer Digitalagentur Merlin zusammengeschlossenen Indies wurden im Jahr 2008 zum Nominalwert von 8.804 Euro mit zusammen 18 Prozent an Spotify beteiligt; nach dem Börsengang von Spotify zehn Jahre später hatten diese Anteile einen Marktwert von rund 2,6 Milliarden US$, die von den Plattenfirmen und von Merlin zu großen Teilen umgehend und mit gigantischen Gewinnen versilbert wurden.
Warner verkaufte seine gesamten Spotify-Anteile im Mai 2018 für mehr als eine halbe Milliarde US$ und beteiligte seine Musiker:innen und Partnerlabels mit 25% an diesen Gewinnen, hat diese aber mit „unrecouped balances“, also noch nicht erstatteten Guthaben verrechnet, sodass das Gros der Künstleranteile letztlich auf den Konten der Warner Music Group (WMG) verblieben sein dürfte. Sony konnte im zweiten Quartal 2018 laut Branchendienst „Music Business Worldwide“ (MBW) für etwa die Hälfte seiner Spotify-Anteile 768 Mio. US$ erzielen und bewertet im gleichen Quartal seine verbleibenden Aktien an dem Streamingkonzern mit 862 Mio. US$; auch Sony erklärte, die Gewinne mit Musiker:innen und Partnerlabels zu teilen – in welchem Verhältnis blieb offen. Und Merlin hat schon am ersten Tag nach dem Spotify-Börsengang seine Anteile an dem Streamingdienst monetarisiert und die erzielten über 130 Mio. US$ komplett an seine mehr als 20.000 Mitgliedsfirmen, also Plattenfirmen und Vertriebsorganisationen, verteilt. Es wäre spannend zu erfahren, welche und wieviele dieser „Indies“ ihre Spotify-Gewinne zumindest zum Teil an ihre Musiker:innen ausgezahlt haben. Von der Beggars Group, einer der kommerziell erfolgreichsten unabhängigen Plattenfirmen weltweit, wissen wir immerhin, dass sie die Hälfte der von Merlin an sie ausgezahlten Anteile aus den Spotify-Erlösen an ihre Musiker:innen ausgezahlt hat (abzüglich der zu verrechnenden Guthaben, siehe WMG, blieben noch 44 Prozent für die Künstler:innen übrig). Da nur wenige der an Merlin beteiligten Indie-Plattenfirmen öffentlich von einer Beteiligung ihrer Künstler:innen an den Spotify-Erlösen berichtet haben, es andrerseits aber einen nicht zu unterschätzenden Werbeeffekt für die eigene Firma gehabt hätte, wenn man die Musiker:innen fair an den letztlich von ihnen erarbeiteten Spotify-Gewinnen beteiligt hätte, darf man getrost davon ausgehen, dass es nicht allzu viele Indie-Plattenfirmen waren, die ihre Musiker:innen entsprechend an den Erlösen aus dem Verkauf von Spotify-Anteilen beteiligt haben. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn all die Musiker:innen in dieser Sache ihre Plattenfirmen mal um Transparenz angehen würden…
Überdies hat Spotify seit der Gründung im Oktober 2006 noch in keinem einzigen Geschäftsjahr Geld verdient! Ganz im Gegenteil, Spotify schreibt Jahr für Jahr teilweise gigantische Verluste: Im letzten Geschäftsjahr, 2020, betrug der Verlust mehr als eine halbe Milliarde Euro. Wenn aber weder die Streamingkonzerne etwas verdienen, noch die Hunderttausenden Musiker:innen, die die Inhalte herstellen, wer profitiert dann eigentlich vom Musikstreaming? Die Antwort ist einfach zu geben: Es sind die Rechteinhaber, allen voran die Plattenfirmen, die dank des Streamings wieder Riesengewinne einstreichen! Allein Weltmarktführer Universal nimmt aktuell mehr als eine Million Dollar pro Stunde ein…
Hoffen wir, dass die Künstler:innen endlich erkennen, dass es unsinnig ist, das „System Spotify“ zu bekämpfen, also gegen Windmühlen in den Kampf zu ziehen, sondern es eher darum gehen muss, das „System Musikindustrie“ zu verändern und die Plattenfirmen zu einer fairen und transparenten Verteilung der Streamingeinnahmen zu zwingen.
It’s the labels, stupid!
Berthold Seliger räumt mit einigen Mythen über die Vergütung in der Musikstreaming-Ökonomie auf.