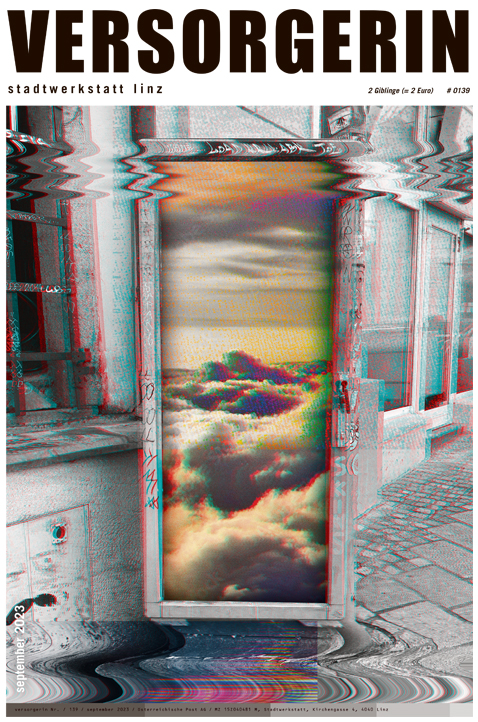Für ein Zoom-Meeting bereitest du gerade eine PowerPoint-Präsentation vor, aber dir fehlen ein paar Punkte in deiner Excel-Tabelle. Du googlest noch schnell die fehlende Information, und dann hast du Zeit, in Google Docs noch einmal nachzulesen, damit du für dein Zoom-Meeting gut vorbereitet bist und dich optimal präsentieren kannst.
Wenn das tatsächlich zutrifft, wenn du das alles wörtlich meinst, wurdest du eingesponnen und dir sollte Folgendes bewusst sein:
Einem multinationalen Konzern kann nichts besseres passieren, als dass sein Markenzeichen als generische Bezeichnung für ähnliche Produkte verwendet wird (Stichwort: Tixo). Für den Konzern ist die volle Marktherrschaft damit gesichert. Selbst, wenn es ein paar kreativen Köpfen gelingt, ein völlig neuartiges, ausgezeichnetes, nachhaltiges Klebeband zu erfinden, wird dieses Klebeband immer in Bezug zu Tixo definiert: Es ist wie Tixo, aber irgendwie besser.
Jedesmal, wenn jemand »googeln« als Verb verwendet, stärkt es die Marktherrschaft des multinationalen Konzerns, zu dem Google gehört, und macht alternative Suchmaschinen unsichtbar. Wenn jede Tabellenkalkulation als »Excel« bezeichnet wird, ob sie mit Microsofts Software oder anderer Software erstellt wurde, existieren scheinbar keine Alternativen mehr. Wenn PowerPoint quasi als Standard für Präsentationen betrachtet wird, wird unsere Vorstellungskraft auf das PowerPoint-Format beschränkt. Dann befinden wir uns im Würgegriff der Big-Tech-Konzerne und können uns Auswege nicht mehr vorstellen. Das ist gewollt.
Seit Jahrzehnten werden wir ständig von technologischen »Innovationen« derart überrollt, dass niemand allein mithalten kann. Gleichzeitig werden wir zunehmend vereinzelt, aufgeteilt in kleinstmögliche Einheiten, damit wir technische Hilfe brauchen, um alle möglichen Aufgaben zu erfüllen. Wie oft musst du im Alltag auf deinem Mobiltelefon nachschauen? Beworben werden diese technischen Hilfen mit dem Versprechen, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, wie sie funktionieren, wozu wir ohnehin keine Zeit haben, weil sie möglichst »user-friendly« gestaltet werden. Damit werden wir zunehmend abhängig von den Konzernen, die uns alle diese technischen Dienste bereitstellen und unsere Handlungsmöglichkeiten dadurch bestimmen.
Diese Abhängigkeit ist ausbeuterisch und kommt uns teuer.
Scheinbar allgegenwärtig hat sich die seltsame Behauptung durchgesetzt, dass sämtliche Online-Angebote – wenn nicht überhaupt das Internet an sich – ausschließlich durch Werbeeinnahmen finanzierbar sind. Gleichzeitig sammeln alle kommerziellen Online-Dienste Unmengen an Daten über uns, angeblich um uns »personalisierte« Werbung anzubieten. Diese Daten werden dann an den Meistbietenden – ob Werbefirmen oder Staatsapparate – verkauft. Rechenschaftspflichten gibt es keine. Und auch, wenn Unmengen an Daten für enorme Geldsummen verkauft werden, sind gerechte Steuerzahlungen in diesen Transaktionen nicht vorgesehen. Wir haben keinen Einblick in die Daten, die über uns gesammelt werden, und wir haben keine Kontrolle darüber, wer welche Schlüsse aus diesen Daten zieht. Penetrante, nicht wirklich passende Werbeeinschaltungen sind das harmloseste Problem dabei. Antiabtreibungsgruppen in den USA, zum Beispiel, haben bereits Verortungsdaten in Bezug auf Abtreibungskliniken kaufen können, was in US-Bundesstaaten, wo Abtreibung kriminalisiert wird, äußerst bedenklich ist.1 Welche Entscheidungen Versicherungsfirmen, Polizei oder potentielle Arbeitgeber*innen oder Vermieter*innen auf Basis solcher Daten treffen könnten, ist nicht schwer auszumalen.
Allein, vereinzelt, isoliert können wir uns nicht dagegen wehren. Doch Big-Tech-Konzerne, die uns ausbeuten, sind nicht alternativlos. Die Suche nach Alternativen beginnt aber schon mit der Sprache. Google ist nicht die einzige Suchmaschine, aber wenn wir immer nur »googeln«, selbst wenn wir DuckDuckGo, Qwant oder eine andere Suchmaschine verwenden, verlieren wir aus dem Blick, dass es verschiedenartige Möglichkeiten gibt, um unterschiedliche Information im Internet zu finden.2 Ebenso verlieren wir aus dem Blick, dass das Internet nicht nur dazu existiert, um Profit zu generieren.
Die Unsichtbarmachung von Alternativen führt schließlich auch dazu, dass wir profitgenerierende Geschäftsmodelle unhinterfragt übernehmen. Es wird selbst in linken, antikapitalistischen Kreisen immer wieder argumentiert, dass kommerzielle Social-Media-Plattformen leider nötig sind, um »Reichweite« zu sichern. Möglichst viele Klicks, Likes, Teilen gelten als Erfolg. Dass die Inhalte dabei völlig beliebig sind, zeigt sich spätestens mit dem derzeitigen langsamen Untergang von Twitter. Da Empörung und Wut mehr »Engagement« fördern, nehmen Beiträge, die Empörung und Wut erzeugen, zunehmend Überhand. Wenn uns unsere Inhalte tatsächlich wichtig sind, sollten wir auch hinterfragen, ob das Geschäftsmodell von kommerziellen Plattformen wirklich dafür geeignet ist. Überzeugungs-arbeit erfordert andere Strategien, als bloß Werbung zu machen.
Ist es umständlicher, »im Internet suchen« statt »googeln« zu sagen?
Ist es holprig, »Tabellenkalkulation«, »Tabellendokument« oder »Spreadsheet« statt Excel zu sagen? Vielleicht. Doch inklusive Sprache erfordert auch mehr Aufmerksamkeit als die Verwendung von nur männlichen Formen, wo Frauen und gender-diverse Personen »mitgemeint« sind. Zum Glück gibt es aber immer mehr Menschen, die bereit sind, diese zusätzliche Denkarbeit auf sich zu nehmen. Ein bewusster, aufmerksamer Sprachgebrauch sagt eben viel über unsere Einstellungen aus.
Kapitalistisch dominierte, profitgetriebene Technologien meinen es nicht gut mit uns. Wenn wir etwas anderes wollen, müssen wir es auch sagen.
Alternativen, die nicht kommerziell, ethisch vertretbar, auf Privatsphäre fokussiert sind, finden sich u.a. bei:
https://book.servus.at/en/toolbox/
https://ethical.net
https://myshadow.org/increase-your-privacy#alternatives