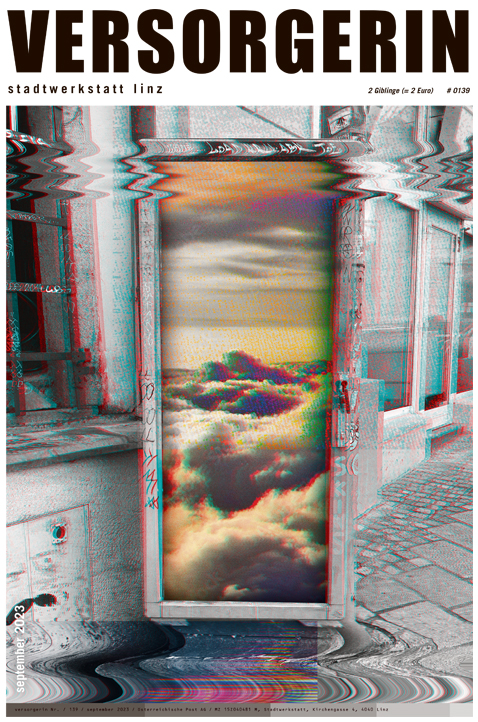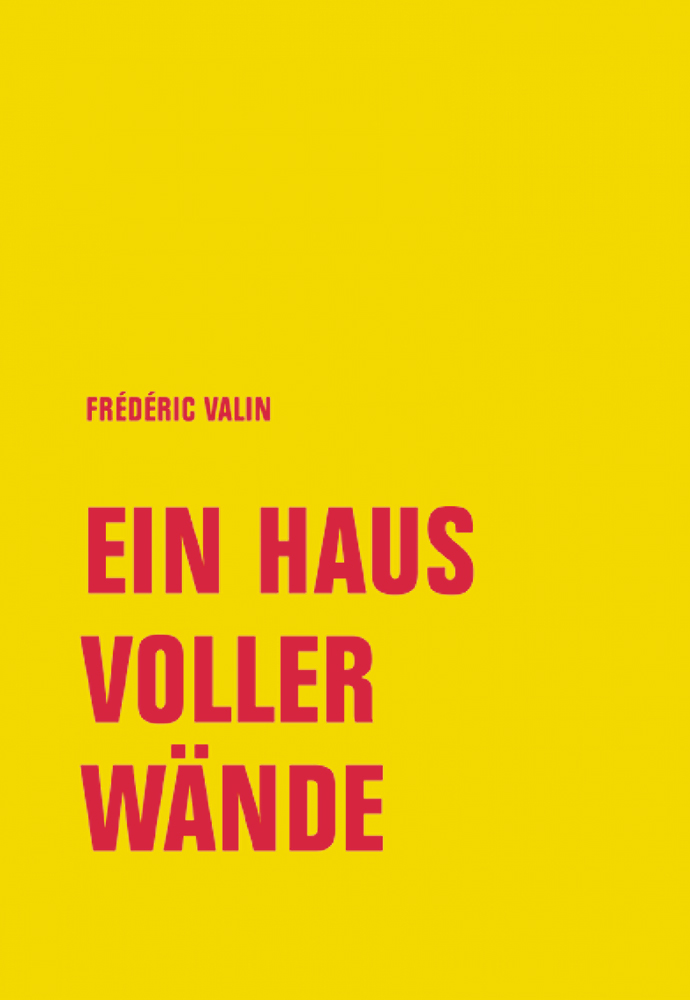Herr Valin, wie wird man behindert?
Das ist ganz leicht, den meisten Menschen gelingt das im Laufe ihres Lebens. Es reicht, alt genug zu werden zum Beispiel. Dann kommen die Behinderungen von selbst.
Das wäre die medizinisch-individualisierende Antwort. Aus einer aktivistischen und gesellschaftskritischen Haltung heraus, müsste es heißen: durch Barrieren. Denn aus dieser Perspektive ist man nicht behindert, sondern man wird es dadurch, dass bestimmte, diagnostizierte Zustände zu gesellschaftlichen Ausschlüssen führen. Die Begrifflichkeiten sind stark geprägt von den Kämpfen der 1980er Jahre, als sich Menschen mit körperlichen Einschränkungen den Zugang zum öffentlichen Raum erkämpften; ein Kampf, der allerdings immer noch nicht abgeschlossen ist, gerade Deutschland tut sich enorm schwer damit, Menschen mit Behinderung teilhaben zu lassen. Also aus meiner Sicht könnte dann auch die Antwort sein: Deutschland behindert.
Sie haben bis 2020 sieben Jahre auf einer Gruppe mit Menschen, die als geistig behindert gelten, gearbeitet. Was bedeutet das, ein „behinderter Geist“?
Tja, gute Frage. Bevor wir auf den philosophischen Aspekt zu sprechen kommen, grasen wir vielleicht erst noch ein paar angrenzende Felder ab.
Pädagogisch gesprochen bezeichnet dieser Terminus Menschen mit verfrüht ausgebildeten Lernplateaus. Es gibt auch Betroffene, die die Bezeichnung „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ verwenden, das Netzwerk Mensch zuerst beispielsweise. Das ist ein Versuch, den Begriff der geistigen Behinderung loszuwerden, der inzwischen auch überkommen ist.
Der Begriff der geistigen Behinderung stammt aus den 1950er Jahren und wurde eingeführt von Eltern betroffener Kinder und Fachärzt*innen, um den stigmatisierenden Begriff „Idiotie“ abzulösen. Die Diagnose „Idiotie“ war ja bis 1945 ein Todesurteil. An der Entwicklung und Etablierung des Begriffs „geistige Behinderung“ waren auch ehemalige Gutachter der Aktion T4 beteiligt, Werner Villinger zum Beispiel, der hauptverantwortlich für die Sterilisierung von hunderten Menschen war und sehr wahrscheinlich von seinem Schreibtisch aus per Federstrich Menschen in den Tod geschickt hat. Die verschiedenen Vernichtungsaktionen sind ja kaum aufgearbeitet worden und auf eine Entnazifizierung der Medizin wurde auch weitestgehend verzichtet.
Aber zurück zu heute: In der diagnostischen Praxis läuft das so, es gibt eine Erstdiagnose, die wird psychiatrisch abgesichert, maßgeblich war da für die Einrichtung, in der ich arbeitete, ein IQ-Test. Im Diagnoseverfahren scheint allerdings gerade Bewegung zu sein.
Die Diagnose ist vierfach abgestuft: Lernbehinderung bei einem IQ von 85–70 , dann leichte, mittelgradige oder schwere geistige Behinderung. Diese Diagnose sollte eigentlich ein Türöffner zu den Hilfesystemen sein, aber gerade in dem Bereich, der sich ironischerweise „Eingliederungshilfe“ nennt, bedeutet das ab einem gewissen Grad die Unterbringung in Wohneinrichtungen oder Heimen. Der alles bestimmende soziologische Marker ist dann jener der geistigen Behinderung, alle anderen Unterschiede werden nivelliert. In den Wohngruppen leben dann fidele Mittzwanziger zusammen mit dementen Mittvierzigerinnen und depressiven 80-Jährigen. Aus Verwaltungssicht ist das alles eine Einheit, was dazu führt, dass Betreuer*innen den einzelnen Bedürfnissen überhaupt nicht mehr gerecht werden können. Das ist sozusagen die soziale Realität des Begriffes.
Was aber ist ein Geist, der behindert wird? Ich bin nun philosophisch nicht so sehr sattelfest, aber meine Antwort wäre: das, was sich in einem Menschen gegen äußere Zumutungen wehrt und Möglichkeiten findet, ihnen wie auch immer zu begegnen. Da würde ich auch wieder den sozialen Aspekt der Behinderung sehen, weil in totalen Institutionen diese Fähigkeit zum Widerstand den Menschen abtrainiert werden.
Würden Sie Institutionen wie Pflegeheime auch als Teil dieser „Infrastruktur der Behinderung“ ansehen? Oder, anders gefragt, was ermöglichen diese Institutionen?
Ja, das kann man so sagen, denke ich. Sie sind, was Bourdieu eine strukturierende und strukturierte Struktur nennt und verwalten nicht nur Behinderung, sondern bringen sie auch hervor. Diese Institutionen ermöglichen eine Verwaltung der Anderen, die im Fall der Pandemie die komplette Abschottung der Bewohner*innen von der sogenannten Normalbevölkerung ermöglicht. Laut UN-Behindertenrechtskonvention sollen sie deswegen auch abgeschafft werden, aber in der deutschen Politik interessiert das kaum jemanden, in der österreichischen übrigens auch nicht. Da hat die Prüfkommission für die Umsetzung der Maßnahmen dieses Jahr festgestellt, dass es mehr Rück- als Fortschritte gibt. Die Prüfung in Deutschland steht noch aus.
Das Problem ist, das alle Alternativen Geld kosten. In Großbritannien hat man die Heiminfrastruktur in den 90ern quasi ersatzlos abgerissen, mit der Konsequenz, dass die Leute jetzt zu Hause nicht versorgt und nicht gesellschaftlich eingebunden werden. Vor dem Hintergrund bekommt freilich die Sterbehilfedebatte nochmal einen ganz anderen Thrill.
Ihr Beispiel mit Großbritannien erinnert mich an die prägnante Formulierung des Professors für Soziale Arbeit Suitbert Cechura, dass Inklusion mitunter als „menschenrechtliches Einsparungsmodell“ willkommen geheißen wird. Sind das die zwei Möglichkeiten in einem ökonomischen System, zu dem Druck, Einteilung von Menschen und Ausschluss notwendig gehören: Ausschluss durch Ignorieren der Inklusionsvorgaben, Ausschluss durch ihre – komplett verdrehte – Umsetzung?
Ich kenne das Buch von Cechura noch nicht, aber ich denke, ich weiß, was er meint. An der Stelle würde ich gern kurz einen Schritt zurücktreten und fragen: Was bedeutet Inklusion, wohin soll eigentlich inkludiert werden? In modernen Gesellschaften wird Teilhabe über Arbeit hergestellt, salopp gesagt: der Sinn von Sein ist malochen, ist hackeln. Die Fähigkeit zu leisten ist das, was das Individuum der Gesellschaft schuldet. Teilhabe bedeutet also polemisch gesagt das Recht, sich ausbeuten zu lassen.
Das ist im Übrigen seit Beginn der Moderne ein Marker. Im Amsterdam des 17. Jahrhunderts gab es Zellen für Arbeitsscheue, die mit Wasser vollliefen, und mit einer Pumpe ausgestattet waren. Wollten die Insassen nicht ersaufen, mussten sie pumpen. Das Ganze war öffentlich zugänglich, eine Art Museum der zurichtenden Grausamkeit. In der NS-Zeit war die Unterscheidung zwischen arbeitsfähig und nicht-arbeitsfähig jene zwischen Sterilisation und Tod. Der Link zwischen Leistungsfähigkeit und Behinderung ist eine Kontinuität, die sich nicht auf ein bestimmtes ideologisches oder politisches System festschreiben lässt, das findet sich in vielen Gesellschaftsformen.
Aber bleiben wir mal in unserem System: Inklusion wird also als Teilhabe verkauft, ist aber in erster Linie ein Druck auf Marginalisierte, sich anzupassen und Vorgaben zu erfüllen. Das geht so weit, dass eine Arbeitswelt simuliert wird für jene, denen man ein Bestehen auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht zutraut: nämlich das Werkstättensystem. Nominell sollen die Leute da auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden, aber es ist allen klar, dass das nur eine Schutzbehauptung ist: Circa ein Prozent der Leute, die in Werkstätten arbeiten, kommen da überhaupt wieder raus. Und da stimmt die Rede vom menschenrechtlichen Einsparungsmodell unbedingt, weil die Menschen, die dort arbeiten, keinen Lohn erhalten, sondern ein Taschengeld, normalerweise unter 200 Euro für eine Vollzeitstelle, je nach Region. Wir reden hier von einer Branche, die in Deutschland 8 Milliarden Euro umsetzt jährlich und in der über 300.000 Menschen tätig sind. Da werden Autoteile gebaut, Fußbodenheizungen und so weiter. Auch dieses System wird regelmäßig gerügt, weil es null komma gar nicht inklusiv ist, und das aber trotzdem weiter wächst, weil jetzt auch immer mehr Leute mit psychischen Erkrankungen da hineingeparkt werden.
Wie würden Sie den Zustand der Pflege beschreiben?
Der Zustand der Pflege ist katastrophal und das weltweit. In Deutschland fehlen aktuell je nach Berechnungen zwischen 120.000 und 500.000 Pflegekräfte, für Österreich dürften es 2030 90.000 sein. Global gesehen schätzt die WHO, dass im Jahr 2030 neun Millionen Pflegekräfte fehlen werden. Die meisten dieser Untersuchungen haben die Auswirkungen der jetzigen Pandemien und der kommenden stärkeren Belastungen noch nicht einmal einberechnet; sie bilden also die gestiegenen Bedarfe durch Long Covid, frühere Parkinson- und Demenzerkrankungen und andere neurologische oder organische Schäden, die Corona mit sich bringt, nicht ab, ebenso wenig wie sie einberechnen, dass unter Pflegekräften die Ansteckungsgefahr besonders hoch ist.
Für die Pflegeprotokolle habe ich mit ungefähr 30 Leuten aus den verschiedensten Bereichen gesprochen und 90 Prozent sind der Meinung, dass es so wie es ist nicht bleiben kann. Es gibt kaum einen Aspekt, der nicht problematisch ist: Arbeitszeiten, Management, Bezahlung, Ausstattung. Die Leute bleiben im Job, weil sie Menschen mögen, weil sie es erfüllend finden, helfen zu können; das aber ist gegen den herrschenden Zeitgeist der Eigenverantwortung und des Individualismus. Dagegen stemmst Du Dich ein bis drei Jahrzehnte, je nachdem wie resilient Du bist; irgendwann kommen dann Burnout und Zynismus. Das ist grob zusammengefasst die Lage.
In dieser Schärfe und Genauigkeit ist selten etwas zum Thema zu hören oder zu lesen. Warum wird über Pflege – abseits davon, sie als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit immer wieder anzuführen – so wenig gesprochen?
Da gibt es ein ganzes Bündel an Gründen. Zunächst einmal ist ja grauenhaft viel im Argen aktuell, der Klimawandel, das Artensterben, der Krieg in der Ukraine, aber auch im Sudan, in Eritrea, im Jemen, die immer noch fortwährende Bedrohung durch das Virus, die Wahrscheinlichkeit weiterer Pandemien, der nicht aufrechtzuerhaltende Wohlstand, die Wohnungsnot, der Aufstieg rechtsextremer Parteien und so weiter. Aufmerksamkeitsökonomisch konkurriert das Thema Pflege mit einem ganzen Strauß an Missständen und Bedrohungen. Und die Leute sind müde, sie wollen sich nicht jeden Tag ein Ohr abkauen lassen.
Kommunikativ und praktisch schwierig ist, dass es nur selten einfache Lösungen gibt. Es gibt Missstände, die wären ohne weiteres behebbar, beispielsweise in Deutschland Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung das Grundrecht auf Gesundheit zuzugestehen. Dazu müsste ein Satz in Paragraf 87 Aufenthaltsgesetz gestrichen werden. Momentan ist es so, dass das Sozialamt die Kosten für Behandlungen nicht Krankenversicherter übernimmt, da holt man sich einen Schein und kann dann zu Ärzt*innen. Die melden aber die Daten an die Ausländerbehörde, und das heißt freilich, dass man von Ausweisung bedroht ist. Würde man den Sozialämtern diese Weitergabe von Daten nicht vorschreiben, wie man es ja auch bei Schulen schon handhabt, könnte man das Leben einer halben Million Menschen in Deutschland deutlich verbessern.
Das ist freilich ein Beispiel für eine systeminhärente Verbesserung, von denen gibt es tatsächlich einige, die sind aber nicht der Gamechanger. Um die Pflege in all ihren Facetten zu retten, bräuchte es einen Umbau des gesamten Systems und das würde sehr viel kosten. Ich würde nicht davon ausgehen, dass diese Mehrkosten politisch und gesellschaftlich vermittelbar sind.
Das liegt natürlich daran, dass Pflege und Care-Arbeit eine private Angelegenheit sind. Das zieht sich ja durch alle Bereiche von Beziehungsarbeit: Dein Kind schreit in der S-Bahn – das nervt, mach, dass das aufhört, wie du das machst, ist dein Problem. Bei alten und behinderten Menschen ist man da ja noch einen ganzen Schritt weiter gegangen und hat so Versorgungseinheiten als Wohnblöcke an den Stadtrand gebaut, um möglichst effizient das Elend wegzuverwalten. In der Pandemie konnte man diese Heime und Einrichtungen dann bequem komplett abriegeln, dann sahen die Sterbestatistiken auch nicht ganz so verheerend aus. Da hat man dann schon gesehen, was Inklusion tatsächlich bedeutet: Leute, die in solchen Zusammenhängen lebten, mussten sich Buchstabe für Buchstabe an alle Maßnahmen halten, während in deutschen Zeitungen Schriftsteller*innen sich darüber beschwerten, dass sie nicht mehr in ihr Ferienhaus am Meer fahren durften, weil das in einem anderen Bundesland lag. Diese Tendenz gerade der oberen Mittelschicht, die eigenen Zipperlein für den großen Weltschmerz zu halten, ist Teil des Klassenkampfes von oben. Während der Pandemie, wenn mir dieser kleine Exkurs erlaubt sei, war das auch schön zu beobachten: Da gab es dann eine ganze Bewegung von Mittelschichtsfeministinnen, die für die Öffnung der Schulen war (freilich ohne zu sagen, was stattdessen zugemacht werden soll). Sie haben es so verkauft, dass sie damit die psychische Gesundheit der Kinder schützen wollen, und für ihre Kinder stimmt das sicherlich auch; das ganze Erziehungsmodell ab Mittelschicht basiert auf Ausbeutung, da ist ja ständig was los: neben der Schule noch Musikunterricht, irgendwelche Vereinsaktivitäten, Ferienfreizeiten, Camps, involvierte Eltern, Tanzkurse, am Wochenende dann auch immer Programm, Zoobesuch oder Museum oder all das Zeug, das nicht für die Unterschicht ist, weil zu teuer. Diese Mittelschichts-Eltern können nicht mit ihren Kindern allein sein, weil beide sind berufstätig und ja, das ist anstrengend, aber sie wissen auch nicht mehr wie es geht, das Kind zu beschäftigen. Da haben sie gesagt: Wenn es uns so geht, muss es allen so gehen, und haben die Kinder in diese Durchseuchungsmaschine Schule gezwungen – übrigens inzwischen auch die vorerkrankten Kinder und die mit vorerkrankten Eltern, weil Schulpflicht geht über Gesundheit. Damit haben sie einer Durchseuchung Tür und Tor geöffnet.
Aber zurück zur Frage: Ein weiteres Problem, warum über Pflege nicht viel gesprochen wird, liegt auf mehreren Ebenen in der Pflege selbst. Da ist zunächst das Management, das es äußerst ungern sieht, wenn Pflegende über Missstände oder auch einfach nur ihre Erfahrungen berichten. Das soll alles schön unterm Deckel bleiben. Leute, die aus der Praxis heraus öffentlich darüber sprechen, wie es in der Pflege aussieht, werden regelmäßig abgestraft. Ich spüre das auch, aktuell allerdings nur indirekt, das heißt Kolleg*innen schreiben mir, wie sie von der Leitung zur Rede gestellt werden, weil sie mein Buch auf Arbeit mit dabei haben.
Sie haben es mit Ihren Antworten schon angedeutet. Ist es also so, dass die Pandemie ein weiteres Hemmnis für die Umsetzung von Inklusion ist?
Ich würde sogar sagen, dass die Pandemie der Sargnagel der Inklusion ist, und zwar auf mehreren Ebenen. Ich beschränke mich mal auf zwei offensichtliche Entwicklungen.
Erstens: Es wird mehr Bedarfe geben und weniger Leute, die abhelfen können. Bei jeder Infektion ist aktuell das Risiko, Long Covid zu bekommen, ungefähr zehn Prozent, also werden immer mehr Menschen zumindest teilweise gesundheitlich eingeschränkt sein. Außerdem verursacht Covid mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit neurologische und organische Schäden, die langfristig zu Erkrankungen führen werden. Und das in einer Situation, in der Betreuungs- und Inklusionsbedarf durch die demografische Situation die nächsten Jahre sowieso schon stark zunehmen wird.
Diese Mehrbedarfe treffen auf einen ohnehin schon ausgelaugten sozialen Bereich, der noch dazu vom Virus besonders gebeutelt sind, weil in solchen Berufen das Infektionsrisiko besonders hoch ist. 200.000 Menschen aus dem Gesundheitswesen haben wegen dieser Pandemie weltweit ihr Leben verloren. Ich habe Interviews geführt mit ungefähr 20 Long Covid-Patient*innen, davon haben drei Viertel im Sozialen gearbeitet und sich auch auf Arbeit angesteckt. Die Krankenkassen-Statistiken geben auch Erzieher*innen und Pfleger*innen als die gefährdetsten Berufsgruppen aus, wenn auch nicht ganz so eindeutig wie in meiner Privatempirie. So oder so: irgendwann wird niemand mehr da sein, um Inklusionsarbeit zu machen. Das ist das eine.
Und zweitens: Inklusion ist gesellschaftlich nicht erwünscht. Was in dieser Pandemie gesellschaftlich tatsächlich passiert ist, ist eine klare Trennung zwischen Risikogruppen und der Normalbevölkerung. „Schutz der Risikogruppen“ war ein Code für Segregation. Das sind viele, viele mitgegangen, auch wenn sie sich vielleicht unwohl damit fühlen. Wer auf seine Freiheiten verzichtet hat, hat das aus moralischen Gründen getan, nicht aus politischen; es gibt schlicht keine politische Organisation, der das wichtig genug gewesen wäre.
Funktioniert denn zumindest der Schutz der sogenannten Risikogruppen, der durch zuerst fremdbestimmten Ausschluss und nun durch „selbstgewählte“ Isolation erreicht werden sollte?
Tja, das kommt stark darauf an, welchen sozioökonomischen Hintergrund man mitbringt. Kurz nachdem das Ende aller Schutzmaßnahmen angekündigt wurde, fand in Davos das Weltwirtschaftsforum statt; auf den Fotos sieht man in jeder Ecke Luftfilter rumstehen, und rein kam man da nur mit negativem PCR-Test. PCR, nicht Schnelltest, wohlgemerkt. Und ich wette, die Luftfilter sind auch alle gewartet, anders als in den Berliner Arztpraxen, die ich besuchen musste. Da sind die Regeln andere, die wissen halt, was Standard sein sollte.
Für die Büro-Mittelschicht funktioniert der Schutz auch leidlich: allein schon die Möglichkeit, Homeoffice zu machen und sich gefährlichen Situationen nur nach Risikoabwägung auszusetzen. Es ist freilich nicht ganz so risikoarm wie bei den ganz Reichen, aber immerhin.
Für zwei Personengruppen funktioniert diese erzwungene Isolation freilich überhaupt nicht: Menschen mit Kindern einerseits, weil die Schulen als Drehkreuze der Pandemie benutzt wurden, und entsprechend die Kinder gezwungen wurden, sich anzustecken und das Virus in die Familien zu tragen. Das sollte dem Aufbau einer Grundimmunisierung in der Bevölkerung dienen, war aber eine Wette, die die psychische und physische Gesundheit der Kinder als Einsatz mitbrachte. Wie viele haben das Virus aus der Schule mitgebracht und zwei Wochen später lagen dann Familienmitglieder auf der Intensiv? Natürlich begreifen Elfjährige, dass sie die Oma oder den Papa umgebracht haben oder umbringen könnten. Trotzdem wird in Deutschland jetzt die Schulpflicht mit aller Härte durchgesetzt, das sind halt lässliche Verluste.
Die zweite Personengruppe sind Menschen in Zwangskontexten wie Heimen oder Sammelunterkünften. Die hat man komplett abgeschottet und bessere Gefängnisse aus diesen Orten gemacht. Nichtsdestotrotz hat man eine Schleuse für das Virus offengelassen: das Personal. Das hat mehr als die Arbeitsbelastung die Pflege zerrissen. In der Pflege, in Alten- und Pflegeheimen, arbeitet man in Kleingruppen, im Schnitt vielleicht so sieben Kolleg*innen. Manchen liegt was an den Leuten, die sie betreuen, anderen eher nicht. Dann kommt der Shutdown und Du weißt, dass manche auf illegale Partys gehen oder als Musiker*innen sich für Konzerte 50 Leute nach Hause einladen oder sonst irgendwie viel zu viele Kontakte haben und das Virus reintragen könnten; was tun? Vor der Impfung war es so, dass Du bis zu 80 Prozent der Bewohner*innen verloren hast, sobald das Virus drin war. Es kommt noch dazu, dass Ersticken einer jener Tode ist, die man niemandem wünscht. Das ist ein grauenhafter, grauenhafter Tod. Also diesen Leuten, die in ihrer Freizeit alle Schutzkonzepte über Bord werfen, sagen, dass sie asoziale Arschlöcher sind? Das sind sie, aber das ist der Bevölkerungsdurchschnitt halt auch. Warum sollen sie verzichten, wenn währenddessen die Kubickis dieser Welt weiterhin im Luxusflug nach New York unter der warmen Dusche ihr halbgares Steak fressen dürfen?
Entschuldigung, ich rede mich in Rage. Also der Schutz funktioniert so, wie er funktionieren soll: Die Reichen ins Töpfchen, die Armen ins Kröpfchen. Dass Teile der Linken das nicht gesehen haben, wirft Fragen auf.
Würden Sie in Bezug auf die Pandemie von Eugenik sprechen?
Ja, das tue ich. Ich denke, Kernmerkmal eugenischer Politik ist ihr Wille, Personen auf ihre Nützlichkeit zu werten und dann die Abschätzung zu treffen, ob es besser ist, sie sterben zu lassen. Und das ist, was passiert. Was ich besonders erstaunlich finde: alle wissen es, ich erzähle hier niemandem was neues, denke ich. Es ist allen klar, wo diese Pandemie besonders gewütet hat. Es ist halt leichter auszublenden, wenn die Leute nix mehr sagen können, weil ihnen ein Schlauch im Schlund steckt.
Im Buch streifen Sie auch die Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus. Angesichts der Tatsachen, dass das Erbgesundheitsgesetz erst 2007 durch den Bundestag geächtet wurde, dass Zwangssterilisierte und Euthanasie-Geschädigte erst seit 2011 anderen Opfern des Nationalsozialismus gleichgestellt sind, darf vielleicht folgende Frage formuliert werden: Bedeutet die „Liberalisierung“ in Fragen der Sterbehilfe eine Entwicklung zurück zu etwas, was schon da war, oder handelt es sich um etwas ganz Neues, davon Unabhängiges?
Ich würde sagen weder noch. Die Liberalisierung der Sterbehilfe, wie wir sie gerade diskutieren, will tatsächlich nicht aktiv schaden: es gibt sozusagen keinen Vernichtungswillen. Das wäre für mich auch der Unterschied von eugenischer zu euthanasischer Politik. Es gibt aber eine große Bereitschaft, sich auf ein konkretes bürgerliches Lebensideal festzulegen, aus dessen Logik die Sterbehilfe durchaus Sinn ergibt. Also: Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, informierte Risikoabwägung, der medizinische Apparat als unterstützende Hilfe und so weiter. Diese Bias gelten für bestimmte Klassen, aber wenn ich arm bin, braucht mir niemand mit Selbstbestimmung zu kommen, die gilt für mich nämlich nicht, und wenn ich behindert bin, ist die Medizin bei weitem nicht so hilfreich, sondern oft genug bevormundend und restriktiv. Aus Kanada kennen wir jetzt einige Fälle, da haben Menschen Sterbehilfe beantragt, weil sie wohnungslos wurden. Sie hätten erklärterweise weiterleben wollen, wenn sie nicht Behörden und der Markt – in dem Fall der Wohnungsmarkt – derart im Stich gelassen und gequält hätten. Es sind auch Fälle bekannt, da wurde Leuten mit Behinderung nahegelegt, assistierten Suizid zu begehen. Diese Gefahr ist real, wird aber sehr oft ausgeblendet, weil die Mittelschicht nicht in der Lage ist, hinter ihr Lebensideal zu sehen.
Nichtsdestotrotz ist das kein Dammbruch, sondern ein weiterer Riss neben vielen anderen, beispielsweise dem Versuch in Deutschland, die Post-Ex-Triage gesetzlich zu regeln. Was aktuell passiert, verläuft entlang der alten neoliberalen Formel: Wer Schwierigkeiten hat, denen werden Schwierigkeiten gemacht. Und diese Menschen, die dann vor lauter Schwierigkeiten stehen, die nerven die „Normal“bevölkerung natürlich, nerven und überfordern ihr Umfeld, die Behörden, die staatlichen Institutionen. Die meisten sind nicht gern genervt, sie wären eigentlich gerne gute Menschen. Der Schriftsteller Jan Kuhlbrodt (dessen Roman Krüppelpassion ich allen ans Herz legen möchte) hat es im Zuge der Pandemie für Risikogruppen so ausgedrückt: „Sie schauen traurig und lassen uns dann zurück. Statt Solidarität gibt es Mitleid.“
Sehen Sie die Rechte von Menschen mit Behinderungen aktuell bei linken Bewegungen vertreten?
Linke Bewegungen sind für Menschen mit Behinderung unzuverlässige Partner, das war schon immer so. Aktuell gilt das insbesondere für Linksliberale, die moralische Integrität anstreben, ohne ihren Lebensentwurf in Frage gestellt sehen zu wollen; das gilt auch für die hedonistische Linke, die überhaupt keinen Begriff von Behinderung zu haben scheint, und das gilt vor allem für jene antiwoke Linke, die immer nur Klassenkampf und Revolution zu predigen vermag und in jedem Kampf für Minderheitenrechte sofort einen Verrat an der Sache wittert, einen Kampf, den sie absurderweise dann oft genug als Befindlichkeiten dekadenter Bürgi-Kinder framen, die von der Realität keine Ahnung haben. Die Geschichte des linken Antihumanismus, wie sie etwa Peter Bierl erst kürzlich aufgeschrieben hat, wird da komplett ausgeblendet, ja weitergestrickt. Mit anderen linken Bewegungen, beispielsweise nicht-intersektionalen Feminist*innen, gibt es große Konfliktpotentiale, zum Beispiel §218 StGB. Die einen wollen in keiner Weise von ihren erstrittenen und dennoch immer gefährdeten Rechten auf Abtreibung ablassen, die anderen sehen in der medizinischen Indikation als Abtreibungsgrund eine ableistische Praxis, und es gibt keine gemeinsame Basis, um zu einer Einigung zu kommen.
Ein großes innerlinkes Problem hat sich während der Pandemie offenbart: der Mangel an Expertise. Das geht los bei dickhodigen Meinungskaspern, die aus einem antistaatlichen Reflex heraus das Gerede von der Gesundheitsdiktatur geglaubt und weitergesponnen haben, und deren nächster erträumter Karriereschritt nicht selten ein Engagement bei der Welt oder der Berliner Zeitung ist. Genau so haben sich die Texte dann auch gelesen. Aber wichtiger noch: bei vielen linken Zeitungen hat da die redaktionelle Kontrolle versagt, vermutlich weil das Budget nicht da ist für Leute, die sich da von Anfang an sauber eingearbeitet hätten und zum Beispiel wissen, wie man medizinische Studien liest. Da stand teilweise ein Unfug in den Texten, unglaublich. Das hat den gesamten Klärungsprozess in der Linken stark verlangsamt.
Für Leute wie mich, die sich viel mit Ableismus auseinandersetzen, bleibt es also dabei: Bei Linken ist ein grundsätzliches Misstrauen angeraten.
Würden Sie uns mögliche Wege aus der Misere skizzieren wollen? Gibt es überhaupt Hoffnung?
Es gibt Hoffnungsschimmer, die sind aber glühwürmchengroß. Zwei essenzielle Verbesserungen haben, was die Pflege anbelangt, stattgefunden meiner Meinung nach: die Vollbezahlung von 24h-Kräften in der häuslichen Pflege und die gewonnenen Streiks in Berlin und NRW. Beide allerdings könnten backfiren.
Verbesserungen beim Gehalt schlagen im aktuellen System finanziell quasi direkt auf die Gepflegten durch. Momentan sieht es nicht so aus, als dass aus der Politik hier substantielle Lösungen angeboten werden, weil Austeritätspolitik dominiert. Also besteht die Gefahr, dass Pflege zu einem Luxus wird, den man sich entweder leisten kann oder nicht. Wer soziales Kapital hat, den fangen dann Familienangehörige eventuell auf, das heißt in aller Regel Töchter oder Ehefrauen. Denen schiebt man diese Versorgungslücken dann zu und überfordert sie noch mehr. Es ist jetzt schon so, dass mit einer der traurigsten Orte des Internets Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige sind, das könnte sich, wenn die Finanzierung von Hilfen nicht komplett umgestellt wird, zu einer Welle des Elends ausweiten.
Was die Streiks anbelangt: die waren erfolgreich, weil sie keine Pflegestreiks waren, sondern Krankenhausstreiks, und fast alle Beschäftigten der Häuser mitgenommen haben (die Ärzt*innen allerdings haben sich vornehm zurückgehalten). Ver.di fährt seit ungefähr zehn, 15 Jahren die Strategie, nur noch da zu streiken, wo man aus einer Position der Stärke heraus agieren kann. Das ist sicher effektiver, meine Befürchtung allerdings ist, dass das die bereits angelegte Spaltung der Pflege weitertreiben wird. In Alten- oder Behindertenwohnheimen oder in ambulanten Betreuungsformen funktioniert das Modell nicht, da holen die Müllwerker*innen die Eisen aus dem Feuer. Nichtsdestotrotz braucht es natürlich ein größeres gewerkschaftliches Engagement bei Pflegenden, das aus historischen Gründen momentan nicht besteht. Die erfolgreichen Streiks jetzt könnten da ein Anfang sein, dass sich da noch mehr tut.
Das wird natürlich Gegenreaktionen hervorrufen. Die Spaltung der Pflege ist auch die Gefahr bei einer in Deutschland angedachten Verkammerung, die nominell zwar die professionelle Pflege stärken soll, aber im Grunde zu einer Alienisierung führen wird zwischen Hilfspflegekräften und professioneller Pflege. In der Sozialen Arbeit ist das übrigens die gleiche Soße mit dem Quatsch, den Staub-Bernasconi1 verzapft hat. Pflege und Soziale Arbeit als entpolitisierte Dienstleister ist aber ein sehr wirkmächtiges Dogma.
Insgesamt muss man konstatieren, dass wir in dem Bereich vor allem Abwehrkämpfe führen. Es gibt nichtsdestotrotz Dinge, die sich verbessern lassen würden, ich würde das mal auf vier Ebenen aufschlüsseln.
Systemimmanente Verbesserungen wären, zum Beispiel, die bereits genannte Abschaffung der Meldepflicht in §87 Aufenthg. Eine andere wäre, dass bei Familien mit diagnostizierten Kindern nicht alle Hilfeangebote auf die Diagnose des Kindes zurückgeführt werden, sondern tatsächlich ein Anspruch auf Familienhilfe besteht statt auf Einzelfallhilfe. Aber das geht jetzt alles zu sehr ins Detail, ich wollte damit nur sagen: da ist Kampagnenmaterial.
Zweitens wären Umstrukturierungen in der Organisation von Pflege hilfreich. Fragt man Pflegende, was es bräuchte, damit sie im Job bleiben, sagen die meisten nicht etwa Geld, sondern sie sagen Arbeitsbedingungen. 30h-Woche als Vollzeitmodell bei vollem Lohnausgleich, das wäre angemessen und ein erster Schritt Richtung 30h-Woche für alle, damit sich auch Vollzeitbeschäftige um die ihnen nahestehenden Menschen kümmern können.
Drittens, die Selbstorganisation der Pflege, habe ich bereits angesprochen. Viertens muss es einen kulturellen Wandel geben, hin zu mehr Empathie und Verantwortungsbewusstsein, hin zu mehr Solidarität. Da bieten sich Räume für pragmatisch-idealistische Linke, das zeigt das Beispiel der KPÖ in Graz ja sehr gut, aber auch anarchistische Gruppen in Marseille und so weiter. Und zuallerletzt oder halt zuallererst: Gepflegte gehören ins Zentrum der Debatte, die müssen sich viel mehr äußern können, viel mehr schimpfen, lamentieren, fordern, anprangern.
Ich habe keinen Masterplan für einen Wandel, aber ich bin überzeugt davon: Entweder wir kriegen das hin oder wir kriegen eine enthemmte inhumane Gesellschaft.
-------
Frédéric Valin, geb am 09.03.1982 in Wangen im Allgäu, ist Autor und Pfleger. Im ersten Jahr der Pandemie veröffentlichte er mit den "Pflegeprotokollen" 21 Berichte aus den sozialen Berufen, anschließend erschien sein autofiktionaler Roman "Ein Haus voller Wände" über seine Tätigkeit in einer Wohngruppe für Menschen mit sog. geistiger Behinderung. Er lebt in Berlin.