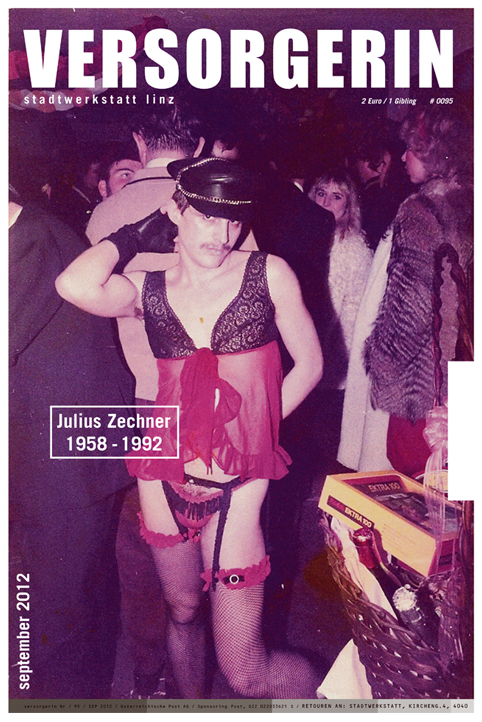Ich beziehe mich auf eines der ersten Kapitel im Buch, Sie schreiben über die Tafeln: Übriggebliebene Lebensmittel werden in Deutschland über die Tafelvereine an Arme verteilt. Was mehrheitlich als gute Idee anerkannt ist, belegen Sie als systemimmanente »Überschussproduktion für die Überflüssigen«, die auf Basis Almosen mit der Währung Dankbarkeit funktioniert. Das System produziert enorme Ungleichheiten, es muss vor allem der Idee des Konsums gut gehen und die, denen es materiell gut geht, dürfen sich noch besser fühlen. Auf Kosten derer, die sich schämen und unter unwürdigen Auflagen den Ämtern ausgeliefert sind. Ein Zynismus, der Armut in Deutschland im großen Stil verschleiert? Frage: Wieso lassen sich die Tafeln nicht politisieren?
Tafeln suggerieren zum einen, dass die Armen nicht wirklich Not leiden müssen, weil sie ja mit Essen versorgt werden. Und zum anderen, dass es pragmatische Lösungen für große Probleme gibt: Fast die Hälfte der weltweit hergestellten Lebensmittel wird entsorgt, während gleichzeitig eine Milliarde Menschen Hunger leidet und die Armut in reichen Ländern wächst. Die meisten empfinden ein Unbehagen angesichts dessen, deswegen kommen die Tafeln so gut an: Den Überschuss an die Armen zu verfüttern, die nichts haben – das erscheint dann als Verteilungsgerechtigkeit. In Wahrheit aber rechtfertigten die Tafeln den Überschuss, er bekommt an den Tafeln einen »Sinn«, obwohl er eine Ursache für die globale Armut ist. Tafeln gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in ganz Europa, den USA und in Schwellenländern – und zwar nicht dort, wo die Armut insgesamt besonders groß ist, sondern die Kluft zwischen arm und reich besonders tief. Ohne Überfluss keine Tafeln. Außerdem sind es oft Wohlhabende, die Tafeln gründen und betreiben – unterstützt von medienwirksamen Spendenaktionen großer Lebensmittel-, Supermarkt- und Autokonzerne. Sie alle profitieren von einer Politik, die ihren Reichtum und ihren Profit sichert – zum Nachteil der Gesellschaft. Sie erscheinen als Gönner, die »etwas zurückgeben« – nämlich Müll. Das ist zynisch. Denn statt einklagbarer Rechte und echter Verteilung werden hier nur Brosamen verteilt. Charity ist das Gegenteil von Politik, deswegen äußern sich wenige Tafeln politisch. Dennoch gibt es auch innerhalb der Tafelszenen mehr und mehr kritische Stimmen: Unlängst hat sich in Deutschland daraus das »Kritische Aktionbündnis 20 Jahre Tafeln« gegründet, das politische Forderungen stellt.
Politik und Wirtschaft finden Lösungen, die wie sogenannte Winwin-Situationen aussehen, wobei alle »wins« auf Seiten der Wohlhabenden stehen. Politik und Medien geben sich in der »Konstruktion der Nutzlosen und in der Kriminalisierung der Armen«, wie sie schreiben, die Hand. Sie schreiben in diesem Zusammenhang von einem Klassenkampf von oben, bei dem sich politische Karrieristen und »normalisierte Intellektuelle« in den großen Medien zuspielen. Das System ist zutiefst verlogen und lediglich sloganüberzogen?
Die Einführung von Hartz IV und der Agenda 2010 wurde begleitet von einer beispiellosen Hetzkampagne. Damals sagte Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder: »Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft.« Und: »Wer zumutbare Arbeit ablehnt, der wird mit Sanktionen rechnen müssen.« Die pauschale Verurteilung Langzeitarbeitloser als »faul« und »selber schuld« ist fast schon zum gesellschaftlichen Konsens geworden. Das belegt auch die Diskriminierungsstudie »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« des Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmayer: Die Hälfte der Deutschen hat eine feindselige Einstellung zu Langzeitarbeitslosen. Nicht nur der klassische »Stammtisch«, sondern auch die Mittelschicht und seriöse Medien treten nach unten. Angesichts der unübersichtlichen Krisen und der Angst, selbst abzusteigen, versichert man sich so seines eigenen Status: Wenn man nur genug leistet, kann
man nicht nach unten rutschen. Also müssen die »unten« selber schuld sein. Das Begriffspaar »Leistungsgerechtigkeit« versus »Sozialschmarotzer« funktioniert genau deshalb so gut: Es legitimiert auch das Vermögen der Reichen, also »Leistungsträger«. In Wahrheit ist es aber andersherum: Die Reichen sind Sozialschmarotzer. Nicht nur, dass sie kaum mehr Steuern bezahlen und unbehelligt Vermögen in Steueroasen schaffen können. Sämtliche politische Entscheidungen der vergangenen 20 Jahre wie der Abbau von Arbeitnehmerrechten, Sozialleistungen und Sozialstaat sowie die zunehmende Privatisierung sind zugunsten der Reichen und Wirtschaftsmächtigen gefallen. Seit 20 Jahren wird von unten nach oben verteilt. Die Finanzkrise ist dafür das schönste Beispiel: Von der Zockerei der Banken haben ausschließlich die Reichen profitiert. Die Kosten der Krise haben aber wir alle bezahlt. Und mit den milliardenschweren Rettungspaketen haben wir nicht allein »gierige Banker« gerettet, denen die allgemeine Empörung gilt, sondern auch das Vermögen der Reichen: Das ist mit der Finanzkrise im weltweiten Schnitt sogar noch um zehn Prozent gestiegen. Es ist mir ein Rätsel, warum nicht ihnen die Empörung gilt, die uns wirklich bestehlen, sondern ausgerechnet den Armen und Ärmsten.
Uns plagt umfassende Statuspanik, wie sie schreiben … Arbeitslose und Zeitarbeiter bezahlen für diese allgemeine Statuspanik jetzt schon mit Leib und Leben – es lassen sich in diesen Gruppen statistisch vermehrt psychische Krankheiten und verkürzte Lebenserwartung belegen?
Dass schlechte Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit und sozialer Ausschluss krank machen, belegen Studien schon seit Jahrzehnten. Im Juli 2011 wurde eine Studie der Techniker-Krankenkasse veröffentlicht, nach der Leiharbeiter im Schnitt 15 Tage pro Jahr krank geschrieben sind. Nicht nur die harte Arbeit geht den Leiharbeitern an die Knochen, sondern auch die psychische Belastung, die durch die beständige Unsicherheit, den häufigen Wechsel der Arbeitsplätze, die miserable Entlohnung und die Entwertung der Leiharbeiter entsteht. Jeder zweite Leiharbeiter meldet sich psychisch bedingt krank. Armut und schlechte Arbeitsverhältnisse machen nicht nur krank und depressiv – sie verringern sogar die Lebenserwartung. Arme in Deutschland leben bis zu sieben Jahre kürzer, mehr als zehn Jahre beträgt der Unterschied zwischen den reichsten und den ärmsten Menschen. Während die Lebenserwartung der deutschen Gesamtbevölkerung leicht steigt, ist sie für Geringverdiener um zwei Jahre gesunken. Ein Skandal, der sich leicht kaschieren lässt, wenn man die Schuld im angeblich lasterhaften Verhalten der Armen sucht: Wenn die rauchen, trinken, keine Sport treiben – ja dann sind sie wohl selbst Schuld. Ein Klischee, das von Politik und Medien ständig bemüht wird.
Auf der anderen Seite der Welt: Mikrokreditnehmerinnen in Asien leben in bittererer Armut und werden unter dem Gesichtspunkt einer Hilfe leistenden »Social Economy« unter Beschlag genommen – für Danone liefen in Bangladesch etwa »selbständige Sales- Ladies« mit einem Danone-Joghurtprodukt von Dorf zu Dorf: Die Frauen nahmen sich teilweise bei Banken Mikrokredite auf, um »selbständiges Unternehmertum« zu lernen. Am Ende haben sich die Frauen verschuldet, die Banken profitiert, die Armen wurden in zynischster Weise in den Konsum- und Kapitalkreislauf eingespeist … und Danone hatte eine Gratis-Markteinführung eines Joghurtproduktes, das in Bangladesch wahrscheinlich niemand braucht, besonders nicht die Armen zur Bekämpfung von Mangelernährung. Hat sich übrigens Danone bei ihnen gemeldet? Warum glauben diese kampagnenüberzogenen Märchen der erfolgreichen Social Economy alle nur zu gerne?
Nein, Danone hat sich nicht bei mir gemeldet. Meiner Erfahrung nach reagieren nur die, die ihre Felle wegschwimmen sehen. Wie kürzlich der WWF, der massiv gegen einen kritischen Buchautor und Filmemacher vorging. Danone hat das nicht nötig, der Konzern ist einer der größten der Welt. Und die Leute glauben solche sentimentalen Erfolgsgeschichten nur zu gern. Denn sie suggerieren, dass kleine Dinge schon etwas ändern können und dass ein bisschen besser besser ist als nichts. Vor allem aber erwecken sie den Eindruck, dass alles so weitergehen kann wie bisher – und dass die Wirtschaft jetzt von selber lieb wird. Damit nimmt einem die Wirtschaft auch noch das Denken ab – und das schlechte Gewissen, weil wir schließlich alle vom Nord-Süd-Gefälle profitieren. »Social Business« und Mikrokredite sind ökonomische Konzepte zur Armutsbekämpfung, heißt: Sowohl Wirtschaft als auch Arme sollen davon profitieren. Aber sowohl von den Mikrokrediten als auch von den »Social Business«-Projekten multinationaler Konzerne profitieren die Reichen. Mikrokredite sind eine besonders perfide Form der Ausbeutung und Unterjochung, die auch noch in einem sozialen Gewand daherkommen. Genauso wie die »Social Business«-Projekte, also der »Joghurt für die Armen« von Danone oder der »One Dollar Trainer« von Adidas, der Arme vor einer Infektion gegen den Hakenwurm schützen soll. Letzteres Projekt ist bereist gescheitert, weil Adidas festgestellt hat, dass man – Riesenüberraschung – keinen Schuh für einen
Dollar herstellen kann. Beim Danone-Joghurt ist es so, dass ihn sich die Armen nicht leisten können und die Frauen deswegen auch nicht davon leben können, den Joghurt von Tür zu Tür zu verkaufen. Viele haben Verlust gemacht. Jetzt wird der Joghurt zum größten Teil in den teuren Supermärkten an die bangladeschische Mittelschicht verkauft. Für Danone ist die Rechnung aufgegangen. Aber nicht für die Armen. Sie brauchen ganz andere Dinge als einen überzuckerten Joghurt oder teure Markenschlappen. Aber damit verdienen die Unternehmen kein Geld. Das perverse an den ökonomischen Lösungen ist: Sie suggerieren ganz genauso, die Armen wären selbst schuld und müssten mehr Eigeninitiative zeigen. »Social Business« ist Privatisierung mit sozialem Anstrich, bleibt aber ordinäre Ausbeutung.
Social Economy und die Privatisierung der Weltrettung:Wenn ich das richtig verstanden habe, soll und wird das System der Mikrokredite nach wie vor ausgeweitet, dieses private und auf die Individuen abgewälzte Unternehmertum, obwohl es nachweislich, in einem politisch relevanten Sinn, total versagt hat?
Für die Profiteure hat das System nicht versagt, im Gegenteil funktioniert es ja ganz prächtig. Wer verdient Geld mit Schulden und Ausbeutung? Banken, Anleger und Wirtschaftsmächtige. Für die Armen aber bedeutet es noch größere Abhängigkeit, Unsicherheit und auch noch größere Armut. Es ist eine konsequente Fortsetzung der Kolonialisierung. Die Zinsen auf einen Mikrokredit betragen im weltweiten Durchschnitt 38 Prozent, während Anleger in Mikrokreditfonds bis zu 9,5 Prozent Rendite einfahren. Die Mikrokreditnehmerinnen können sich aber nicht aus der Armut befreien, ein Drittel von ihnen nimmt Kredite für Essen oder medizinische Versorgung auf. Nur fünf Prozent profitieren von einem Kredit. Die hohen Rückzahlungsquoten von angeblich bis zu 98 Prozent, die die Befürworter immer hochhalten, kommen nur deshalb zustande, weil drei Viertel der Mikrokreditnehmerinnen bei mehreren Instituten gleichzeitig Schulden hat. Und weil die Kredite samt Zinsen auf brutalste Weise eingetrieben werden: Die Banker nehmen den Frauen Kühe, Ziegen und Hausrat weg, zwingen sie, ihr Land, also ihre Lebensgrundlage zu verkaufen, sie demütigen sie vor dem ganzen Dorf und bleiben oft die ganze Nacht in ihren Hütten sitzen. Das sind keine Einzelfälle, das ist die Regel, das haben bereits viele Untersuchungen belegt. In einem Land, in dem Menschen Hunger leiden, in dem sich die Lebensmittelpreise über Nacht verdoppeln können, in dem es schreckliche Krankheiten gibt, die medizinische Versorgung aber unzureichend und teuer ist, in dem jeden Tag eine Naturkatastrophe passieren kann, weil das Land massiv unter der Klimaerwärmung leidet, kann man sich nicht als Unternehmer von der Armut befreien. Kredite sind Schulden – und gerade die Armen in Entwicklungsländern leiden besonders unter der Staatsverschuldung, denn aus diesem Grund kann die Regierung keine überlebenswichtige Infrastruktur schaffen, sondern ist gezwungen, alles der Privatisierung zu öffnen.
Sie schreiben am Ende ihres Buches von der verzweifelten Wut, als Aufschrei gegen Armut und strukturelle Gewalt, die sich etwa in den Londoner Riots letztes Jahr geäußert hat. Auf der anderen Seite wollen sogar normale Bürger aus dem System aussteigen, Stichwort Wutbürger, die von der Politik enttäuscht sind und sich wirtschaftlich eher aggressiv abschotten – und die ihre eigene heile Welt erzeugen. Diese Analyse der Statuspanik scheint mir dabei zentral, weil sie, so oder so, die Menschen trifft – kann in einer derartigen Konkurrenz aber eine Gesellschaft entstehen, die für gerechten Wohlstand eintritt?
Die Politik hat mit der Sozialschmarotzer-Leistungsträger-Lüge die Menschen zu ängstlichen Konkurrenten werden lassen. Das ist tatsächlich keine Grundlage für eine gerechte Gesellschaft, wenn jeder nur noch versucht, letzte Privilegien zu sichern. Das absurde ist ja: Es gibt diesen Mangel ja gar nicht – nur sind Vermögen, Ressourcen und Teilhabe extrem ungerecht verteilt. Der wichtigste Schritt zu einer Veränderung ist, die Strukturen dieser Ungerechtigkeit zu erkennen und in Frage zu stellen. Je größer die Angst vor dem Abstieg, je größer die Konkurrenz, desto schwieriger ist das. Dennoch glaube ich, dass viele Menschen Unmut über die Ungerechtigkeit empfinden. Alternativen ernsthaft zu diskutieren fällt schwer, wenn permanent die Keule der Alternativlosigkeit geschwungen wird. Das lähmt und bringt Menschen dazu, es sich trotz Abstrichen im Kleinen und Privaten wohlig einzurichten. Die Riots in London waren keine politische Bewegung, vielmehr eine gewalttätige Reaktion auf die strukturelle Gewalt, die sozial Benachteiligten über Jahrzehnte mittels neoliberaler Politik angetan wurde. Aber in anderen Ländern, etwa Griechenland, Russland, Spanien und auch in arabischen Ländern gibt es diesen Widerstand bereits.
Sie haben einmal geschrieben: Es gibt kein richtiges Konsumverhalten im falschen Wirtschaftssystem … ist nun eine richtige Protestbewegung im falschen Wirtschaftssystem möglich? Haben nun etwa Occupy oder das Internet als Aktionsort ein tatsächliches Potential, große gesellschaftliche Veränderung in Richtung Wirtschaft und Politik zu generieren? Oder: Wo und wie sehen Sie Potential?
Eine Protestbewegung ist immer möglich – ohne Widerstände lassen sich solche Systeme nicht überwinden. Und es gibt diese politischen Bewegungen ja bereits, etwa Occupy. Es gibt auch eine ganze Menge von Konzepten, etwa solche, die Ressourcen wie Boden, Nahrung, Wasser und Energie jenseits der großen Konzerne der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Aufzustehen, wütend zu werden und erst einmal festzustellen: Ich möchte so nicht leben und es muss auch anders gehen, das ist der allererste Schritt. Erst dann kann man über die vielen Alternativen, die es gibt, ernsthaft diskutieren. Denn je mehr durch solche Bewegungen Ungerechtigkeiten angeprangert werden, desto mehr schließen sich Menschen solchen Ideen an. Das Schönste an solchen Bewegungen ist: Sie sind solidarisch und bringen viele Menschen zusammen. Allein zu merken: Ich bin nicht allein, da sind noch ganz viele, die es anders wollen – das gibt Kraft, Mut und bürgerliches Selbstbewusstsein. Das Internet bietet natürlich die Möglichkeit, sich schnell zu vernetzen und Hintergründe zu recherchieren. Nichts kann mehr so richtig im Verborgenen bleiben – aber selbstverständlich nutzen auch die Konzerne dieses Medium für ihre grüne Propaganda.