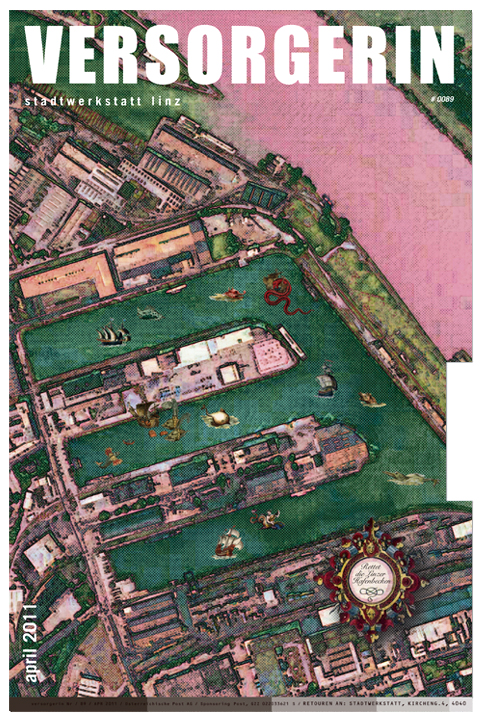Diesen Winter hat der in Linz gebürtige Autor Philip Hautmann im Wiener Trauma Verlag seinen ersten Roman herausgebracht. »Yorick – ein Mensch in Schwierigkeiten« handelt auf den ersten Blick von einem von sich selbst überzeugten eigenbrötlerischen Protagonisten und seinen wunderlichen Abenteuern mit künstlerischen Phantasten, einem Philosophenzirkel und einem geheimnisvollen Milliardär. Möglicherweise spielt sich aber auch alles nur im Kopf einer Psychologin ab. Nach Studien in Linz und Basel lebt Philip Hautmann in Wien. Anna Masoner traf ihn dort zum Gespräch.
Du hast in Linz und Basel Sozial-, Wirtschafts- und Politikwissen-schaften studiert und dich unter anderem in deiner Dissertation mit Politischer Ökonomie beschäftigt. 2010 hast du deinen ersten Roman »Yorick – ein Mensch in Schwierigkeiten herausgebracht«. Definierst du dich als Wissenschaftler, als freier Autor oder ist es schwierig sich zu definieren?
An und für sich bin ich Wissenschaftler von der Ausbildung her. Ich hab Sozialwirtschaft studiert, was mir auf dem Arbeitsmarkt aber nicht so wirklich weitergeholfen hat. Da habe ich mich in Arbeitsverhältnissen wiedergefunden, für die man nicht mal Matura braucht, und an einem bestimmten Punkt habe ich beschlossen, schreibe ich halt eben einen Roman.
Man könnte zum einen sagen, dass das nichts als die nächste Schnapsidee auf dem Weg zu einer gesicherten Existenz sein kann, zum anderen muss man ja irgend etwas machen um nicht geistig zu versauern, also hab ich das probiert.
Wie ist es denn so, das Leben als Autor? Gezeichnet von Schwierigkeiten?
Wenn man keinen Namen hat und einen Verlag sucht oder im Literaturbetrieb unterkommen will, ist es natürlich gezeichnet von Schwierigkeiten. Wenn man weiters an etwas arbeitet, das noch nicht in seinem Wert festgestellt ist – und letztendlich wird dieser Wert ja durch das Qualitätsurteil der Außenwelt definiert – ebenfalls. Da pendelt man in seinem Schaffensprozess und seiner Selbstbeurteilung ständig zwischen Manie und Depression. Natürlich ist es allgemein so, dass, wenn man Kunst macht, man sich quasi in seiner gesamten Persönlichkeit als auf dem Prüfstand erlebt, und in der Regel bringt es wenig Geld. Das heißt, Künstler sein hat ein gewisses dramatisches Potenzial.
Wie kam es eigentlich zur Veröffentlichung? Schickt man das Manuskript an zig Verlage?
Ja schon, außer man kennt jemanden. Oft passiert es ja über Kontakte. Wenn man jetzt kein B-Prominenter ist, der über sein Sexualleben schreibt, ist es schwierig, bei einem Verlag ganz einfach so unterzukommen. Als belletristischer Autor hat man es nicht so leicht, weil sich Belletristik nicht so leicht verkauft. Da ist ja der Markt überschwemmt und es schwer vorherzusehen, wie eine Veröffentlichung beim Publikum ankommt. Bei Sachbüchern ist das anders. Da kann man sagen: Das interessiert so und so viele Leute. Aber eine belletristische Veröffentlichung ist für einen Verlag immer ein Risiko.
Wie hast du eigentlich zum Schreiben gefunden?
Beckett hat mal gesagt, er habe zum Schreiben begonnen, weil alles andere fehlgeschlagen sei. Das kann bei mir nicht eben anders gewesen sein. Ich hab halt keinen anständigen Job bekommen. Meine Idee war ursprünglich, ein Kinderbuch zu schreiben, um meiner Intellektualität eins auszuwischen. Als ich mit dem Roman begonnen habe, war ich ziemlich stark unter dem Einfluss von Alice im Wunderland von Lewis Caroll.
Was hat dich an dem Buch fasziniert?
Es ist ja eines der größten Werke der Weltliteratur. Immerhin wird beschrieben wie ein Kind denkt. Und man kann das Wunderland, in dem sich Alice bewegt, als Satire auf die Erwachsenenwelt ansehen: Die Leute mit ihren komischen Marotten. Oder die Umkehrung der Logik, das Irrationale, das doch in eine zeremonielle, konventionelle Form gebracht und ritualisiert bzw. routinisiert wird.
Wieso hast du aber schlussendlich kein Kinderbuch geschrieben?
Da hat mir die kindliche Kreativität dann doch gefehlt. Auf den Yorick bin ich gekommen, weil ich zu der Zeit Georg Christoph Lichtenbergs Sudelbücher gelesen habe. In denen hat er auch über den Roman Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman und dessen Autor Laurence Sterne geschrieben. Sterne hat sich nämlich Yorick genannt, das war sein literarisches Alter Ego. Den Namen Yorick hatte Sterne wiederum von Shakespeare, der den Hofnarren in Hamlet so genannt hat. Dieses Hofnarrenartige hat Sterne interessiert. Die Figur des Hofnarren ist ja kein Trottel, sondern eigentlich ein Weiser. Er hat eine gewisse Distanz, er beherrscht im menschlichen Chaos und in der Irrationalität den Überblick, deswegen steht er oft auf verlorenen Posten. Was er dem König an Wahrheit erzählt, kommt oft nicht an. Der Yorick ist eine Nebenfigur im Tristram Shandy. Aber ich dachte mir, er wäre ein gutes Sujet für einen eigenen Roman. Eine Figur, die sehr von sich eingenommen ist und in ihrer Überzeugtheit, in ihrer Besonderheit lebt und glaubt, sie ist überall willkommen. Mit diesem Anspruch bewegt sich das Individuum in der Gesellschaft und bemerkt niemals, dass es nicht so ist. Das ist ein großartiges Thema. Es hat etwas Don Quichotteartiges, dass der Mensch in der Täuschung und der Illusion aufgeht...
Yorick, so schreibst du selbst, ist ein witziger Kerl. »Er kommt uneingeladen zum Frühstück und wenn man ausgeht, um ihn los zu werden, so geht er mit aus, in eine andere Gesellschaft, da er glaubt, nirgends unangenehm sein zu können!«
Nervt es dich wenn ich dich frage, wie viel von dir selbst steckt denn eigentlich in deinem unangepassten Protagonisten?
Naja, wenn man ein Buch schreibt, damit an die Öffentlichkeit geht und Interviews gibt, ist es eh klar, dass solche Fragen kommen, insofern hat man nicht genervt zu sein. Der zitierte Satz stammt eigentlich von Lichtenberg, der behauptet, dass entgegen möglicher Erwartungen, die man an seinen edlen Charakter haben könnte, Laurence Sterne selbst so war. Ein eher unausstehlicher Typ, eine Klette und Schmarotzer. Ein Typ der sich überall reingedrängt hat.
Wenngleich mit autobiographischen Elementen versehen, geht es beim Yorick aber um die Beschreibung einer derart veranlagten Kunstfigur. Ein Mensch, der sich für überall willkommen hält, ohne es zu sein, und ohne das jemals zu bemerken. Ein Mensch, der auf der anderen Seite auch seine Qualitäten hat, die von der Gesellschaft missverstanden werden, da sie ja aus Individuen besteht, die letztendlich genauso in ihren Ich-Pathologien gefangen sind.
Das Thema des Buches ist ja, dass der Mensch als Existenz permanent um sich selber kreist. Dass er unachtsam ist. Wenn man bei diesen Lebensratgebern oder Esoterikbüchern, bei den klügeren, nachschaut, kommt das Thema »Achtsamkeit« immer wieder vor. Der Mensch soll gegenüber den Mitmenschen, seiner Umwelt und sich selbst achtsam sein. Das Ganze kommt aus dem Buddhismus, dem ich selber auch positiv gegenüberstehe. Der Yorick ist, wenn man so will, das Buch von der Unachtsamkeit des Menschen.
Neben Yorick bevölkert ein ganzes Kabinett an sonderbaren und schrägen Figuren den Roman. Wie entwirft man denn so ein Personal? Geht man von Bekanntschaften aus, vom eigenen Freundeskreis oder eben gerade nicht?
Natürlich haben Yorick und auch die anderen Figuren etwas mit meinem persönlichen Erleben zu tun, aber vieles ist erfunden. Zum Beispiel kenne ich keinen Milliardär.
Ein paar Bekannte, teilweise sehr entfernte Bekannte, mussten schon als Modelle herhalten, aber im Grunde geht’s darum, bestimmte Charaktertypen darzustellen. In der Regel sind mehrere reale Personen zusammengeschmiedet in die Figuren, die auftreten. Es müssen auch nicht immer Personen sein, es können auch einfach nur Wortmeldungen sein, die ich irgendwo mal von wem aufgeschnappt habe.
Das Buch steckt zwar voller Aktualitätsbezüge, trotzdem hat man beim Lesen das Gefühl, dass die Handlung ebensogut im 19. Jahrhundert stattfinden könnte...
Eigentlich ist es egal wann es spielt. Daher gibt es auch keine konkreten Orts- und Zeitangaben. Und auch keine übertrieben detaillierten Beschreibungen der Figuren. Im ersten Teil könnte man die Personen ja genauso gut für Kinder halten. Und vielleicht sind sie es ja auch. Das hat wahrscheinlich auch etwas mit dem Stil vor allem im ersten Teil zu tun, der teilweise etwas barock ist. Und auch ein wenig kindlich. Es ist ein absichtlicher Verfremdungseffekt. Dass etwas Märchenhaftes dargestellt wird. Dass erkennbar ist, dass da Literatur gemacht wird, aber eben nicht in einer heute üblichen literarischen Sprache. Außerdem hat man im 19. Jahrhundert besser geschrieben als heute.
Findest du? Wieso?
Man hat eine schönere Sprache gehabt. Und schönere Ziele und Ideale, denn diese sind ja auch Teil unserer Existenz, auch wenn sie immer wieder an der Realität scheitern. Das fehlt halt irgendwie in der heutigen Literatur, finde ich. Da beschreiben Autoren oft ihr vegetatives, jämmerliches Leben ganz so wie es ist, bzw. ins Negative verfremdet und freuen sich auch noch drüber. Natürlich geht es in der Kunst darum, dass man das Leben beschreibt, aber die allgemeine menschliche Situation. Ich halte es da eher mit Goethe: Kunst dient der Veredelung des Menschen. Wenn man ein Buch aufschlägt und auf den ersten Seiten schon diverse Kraftausdrücke vorkommen, habe ich das Gefühl, dass heutzutage so ein gewisser Manierismus herrscht, dass man das Leben banaler beschreibt als es eigentlich ist.