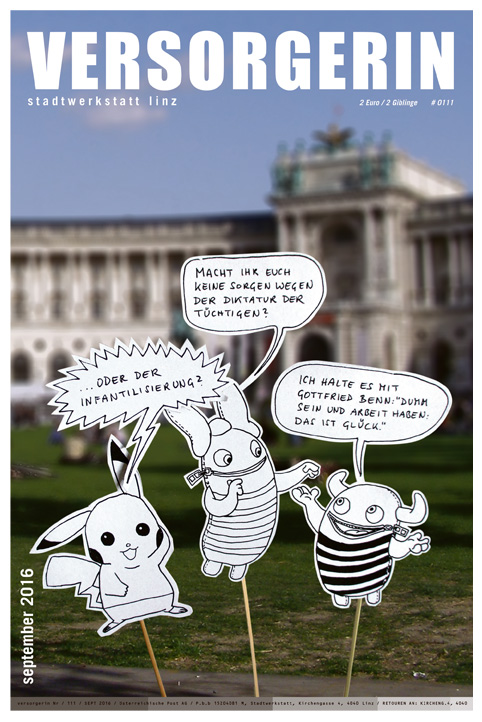Wenn Du siehst, dass ein Stern fällt,
dann musst du ihm zurufen:
»Ich erinnere mich, ich erinnere mich«,
sonst verlierst du dein Gedächtnis.
Tabu aus dem georgischen Volksglauben
Wahrscheinlich überwinden wir die viel beklagte Bilder- und Kinomüdigkeit Europas am ehesten durch einen offenen Blick auf seine Ränder. Das georgische Kino, das seit den 60er Jahren die Aufmerksamkeit westeuropäischer Regisseure auf sich zog (besonders Federico Fellini schätzte den poetischen Surrealismus Sergej Paradshanovs und Tengiz Abuladses perestroikaentfachende »Reue« (1984)), dieses seit jeher eigenständige Kino hat sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts eindrucksvoll neuorientiert. Wie um die alten Beziehungen zwischen Tiflis und Paris wieder lebendig werden zu lassen, sprechen Cineasten inzwischen von der Neuen Welle/Nouvelle Vague des georgischen Films. (Unterdes subsumierten Marktforscher seinen filmwirtschaftlichen Aufschwung als resurrection und Soziologen einigten sich auf die Formel erfolgreicher postsowjetischer Transformation.) Auf zahlreichen internationalen Festivals u.a. in Cottbus, Karlovy Vary, Wiesbaden, Rotterdam, Berlin und Amsterdam haben junge georgische Regisseure entsprechende Anerkennung gefunden.1 »Die langen hellen Tage« (Nana Ekvtimishvili/Simon Groß, 2014), die Chronik einer georgischen Jugend während der Kriegswirren nach der Unabhngigkeitserklärung von 1991, kann nicht nur im eigenen Land (wo schon in den ersten Wochen mehr als 27.000 Zuschauern gezählt wurden), sondern international als einer der bekanntesten Filme der Neuen Welle gelten.
Gleichzeitig haben mehrere Retrospektiven und Georgien-Programme ein kleines, aber aufmerksames Publikum angesprochen: So kamen 2012 die Georgische Kulturwoche in Regensburg zustande, eine Hommage an Otar Iosseliani in Berlin und Basel (2012 und 2015), die New Yorker Retrospektive Discovering Georgian Cinema des Museum of Modern Art (MoMa)/Berkeley´s Pacific Film Archive (2014/5) mit einem Querschnitt von 50 georgischen Filmen, gefolgt vom Veranstaltungszyklus des Hamburger Elbsalons (2016), und die kürzlich beendete, von Lily Fürstenow-Khositashvili organisierte und kuratierte Schau in der Berliner Werkstatt der Kulturen We shall survive in the memories of others (der Veranstaltungstitel war zugleich Zitat eines georgischen Trinkspruchs2), die im Zeichen des verstorbenen Medientheoretikers Vilém Flusser erfolgreich versuchte, den Dialog zwischen neuem georgischem Film und den übrigen Gegenwartskünsten zu eröffnen. Verdienstvoll war auch die Vorführung des Dokumentar-/Gesprächsfilms »Wenn die Welt leicht wird« (S. Machaidze, T. Karumidze, D. Meskhi; Zazarfilm, m. engl. UT, 2015) auf dem Linzer Filmfestival Crossing Europe 2016.
Georgien ist eine geographisch kleinkammerige, historisch und kulturell seit der Antike äußerst dichte Region am südöstlichen Rand Europas (seiner Fläche nach der Größe Bayerns entsprechend). Nicht erst die Erfindung des Kinos, sondern schon im 19. Jahrhundert entstand im Medium der Fotografie ein visuelles Archiv von hohem historischem Wert, auf das an anderer Stelle ausführlicher einzugehen wäre. Betrachten wir allein das Segment unmittelbarer Gegenwart, so ist um so bemerkenswerter, wie vielgestaltig die georgische Kinematographie seit einigen Jahren polyphon die »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« aufgezeigt hat. Es sind Impressionen aus drei postsowjetisch-georgischen Filmen, an denen ich dies verdeutlichen möchte. Beginnen wir mit dem in Linz gezeigten Film. »Wenn die Welt leicht wird« nimmt das Thema subkultureller Selbstfindung der heutigen Tifliser Skateboarder auf: Kids und Musiker proben in einer weiten leeren Landschaft die Überwindung der Schwerkraft, das Schweben in der Luft durch kunstvoll variierte Springtricks. Ihre beiläufig erzählten Geschichten oszillieren zwischen den üblichen hedonistischen Wünschen ihrer Altersgenossen, Sehnsüchten nach irgendeinem noch undefinierten Ort in der Gesellschaft, Videogamehelden und Nostalgie angesichts der ruinösen Wohnquartiere der Sowjetzeit. So wird ihnen der improvisierte Mikrokosmos kreativer Wohngemeinschaften Zufluchtsort angesichts der Endlosschleife fernsehübertragener Demonstrationen von Arbeitsuchenden und Berichten über gesellschaftliche Zerwürfnisse in Politik oder Kirche, die für sie jeglichen Bezugspunkt verloren haben. Während dieser Film – in der Magie fotografischer Aufnahmetechnik verwandt mit Gus van Sants »Paranoid Park« (2007) – die in Bewegung geratene Lebensweise der Teens und Twens zeigt, erhalten wir im zweiten Beispiel, Salomé Jashis »Bakhmaro« (2011), Einblick in die zeitvernichtende Perspektivlosigkeit der Gestrandeten der Transformationsjahre. In ihrem im Südkaukasus entstandenen Dokufilm über ein vormals glamouröses Hotel am Stadtrand zeigt Jashi dessen Realtransformation zu einer dauerhaften Sammelstelle für die obdachlos Gewordenen. Es sind alle Gesellschaftsschichten, auch Akademiker darunter, die hier in lähmender Atmosphäre ihre minimale Existenz gefunden haben. Ein hauseigenes Restaurant versucht trotz anhaltenden Drucks von Mietforderun-gen mit einem widerständigen Rest seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist die Geduld, mit der Jashi sich diesen Menschen vor dem Nichts widmet, die beeindruckt – eine depressive postsowjetische Variante von Gorkis präsowjetischem »Nachtasyl«.
Wieder ein anderer Zeitbegriff begegnet uns in Alexander Rekhiashvilis Film »The Lasts« (georg. mit engl. UT 2006, Musik: Niaz Diasamidse) über die subsistenzwirtschaftliche Lebensweise einer Gebirgsregion in Racha: Schon in den 20er Jahren galt das harten klimatischen Bedingungen ausgesetzte Kaukasusmassiv georgischen Avantgardisten wie Nikoloz Shengelaia und Nutsa Ghoghoberidze als romantische, für propagandistische »Kulturfilme« geeignete Region. Gerade sie schien geeignet, sich zu einem völkerverbindenden Symbol fortschritts- und friedliebender sowjetischer Zivilisation zu wandeln3. Was wir in Rekhiashvilis Dokufilm von 2006 in ungenannter Anspielung auf diesen Mythos sehen, sind zwei Dorfgemeinschaften des Hochkaukasus, die – so der Vorspann – wegen ihrer unzugänglichen Lage vom Eingriff durch politische Autoritäten unbehelligt blieben.
Der Film begleitet das Leben dieser betagten Dorfbewohner (»The Lasts«) in den Formen ihrer bis heute tradierten zyklischen Zeit ländlicher Arbeit. Man kann, wenn man mag, diese von der modernen Idee gleichbleibender Zeit wegführende Form des Erzählens, in die der Betrachter hineingezogen wird, weil sich ihm im Rhythmus der Zeit (also beginnend vom langandauernden Winter über die Schneeschmelze im Mai bis zum kommenden Frühjahr) ein Ort allmählich erschließt, mit Michail Bachtin als chronotopische Erzählweise4 verstehen.
Das jahreszeitlich Zyklische im Leben der beiden benachbarten Bergdörfer zeigt sich zugleich in der Theatralität der Emotionen, die sie in volkstümlich-religiösen Alltagspraktiken zum Ausdruck bringen: Wir sehen keine kirchlichen Amtsträger, aber dunkelgekleidete Greisinnen, Gebete murmelnd ihre Kirche umkreisen, wir sehen sie, wie sie sich betend einmal um die eigene Achse drehen, wir sehen den Rundtanz eines alten Paares im Kreise einiger musizierender Nachbarn. »Das Gebet rettet, vereint und schützt uns«, sagt eine von ihnen.
Besonders eindrucksvoll zeugt ein Trauerritual von der lebhaften Kommunikation, die die Lebenden mit den höheren Mächten aufnehmen, um damit die Vergebung der Sünden des Verstorbenen zu erbitten: Innerhalb einer Trauerprozession, die die Träger des offenen Sarges aus dem Hause begleitet, erkennen wir eine verschleierte Klagefrau, die ihr Lamentoritual mit den anwesenden Nachbarn und Trauergästen dialogisch so kunstvoll beginnt, dass sie Männer und Frauen zu lautem Wehklagen bringt, die Angehörigen des Dahingeschiedenen (hier) ausgenommen.
Was eine Reihe georgischer Filme der letzten Jahre über ihr Zeitverständnis hinaus zu einer Generationsaussage verbindet, ist ihre Auseinandersetzung mit der jüngsten georgischen Geschichte seit den 90er Jahren. Waffenschmuggel, Wirtschaftskrise, Partisanenkämpfe, Ausfall der Elektrizität, Nahrungs- und Heizmittelknappheit, Arbeitslosigkeit, Flüchtlingscamps und seit 2008 die Abtrennung von den russisch besetzten stacheldrahtumzäunten Gebieten Südossetiens durchzogen den georgischen Alltag. Doch die Ereignisse und Kampfhandlungen aus dem Tifliser Partisanenkrieg, den Kämpfen in Abchasien (1992/3) und dem Kaukasuskrieg (2008) sind nicht zum Stoff von Kriegsfilmen geworden – derart wie sie das Hintergrundgeschehen von Filmhandlungen gewöhnlich bestimmen. Es ist die innere Reflexion der kriegsbedingten Prozesse und Transformationen, die eine genuine Neuerung der kinematographischen Konvention begründet hat. Selten sind Filme so dicht an ihr Publikum herangerückt, um kollektiv erinnerte Alltagsroutinen im Umgang mit Extremerfahrungen zu zeigen. Es sind traumatische autobiographische Erinnerungen an die eigene Jugend, in der immer wieder der Vertrauensverlust gegenüber Schule und Eltern thematisiert und die Frage ausgelotet wird, wodurch und wie die »unsichtbaren Räume der Gewalt« in der georgischen Gesellschaft zustandekamen und wie Gewalt ausgeübt und erlitten wurde. So in »The New Berlin Wall« (Toma Chagelishvili 2015) , »Conflict Zone« (Vano Burduli 2009), »Die langen hellen Tage« (Ekvitimishvili / Groß 2014), »Brother« (Mghvdeladze-Grenade / Grenade 2014), »Tangerine« (Urushadze 2013) etc.
Ein Teil der georgischen Filmszene setzt sich kritisch mit der Frage der patriarchalen Dominanz innerhalb der Geschlechterverhältnisse auseinander. Bewegung kam in diese Frage insbesondere durch die zufällige Wiederentdeckung von Dokumenten, die 2010 Lasha Bakradze, Philologe für Germanistik und Direktor des Georgischen Staatsmuseums für Literatur, im Nationalarchiv aufgefunden und in seinem Artikel Nutsa Ghoghoberidze (1902-1966), die erste georgische Filmregisseurin im Hot Chocolate Magazin veröffentlicht hatte: Brisant war nicht nur das Licht, das auf die Repression von Frauen in der Stalinzeit fiel, sondern auch das verordnete bzw. den chaotischen Umständen geschuldete Vergessen danach: Die 1902 in dem georgischen Dorf Kakhi in Sainglo (Aserbeidjan) geborene Nutsa Ghoghoberidze hatte in ihrer Jugend in Tiflis eine ausgezeichnete Erziehung genossen, russisch, deutsch und französisch erlernt und nachdem sie die philosophische Fakultät der Staatsuniversität von Tiflis aufgesucht hatte, ihre Studien in Jena fortgesetzt. Über Berlin kehrte sie nach Tiflis zurück und wurde mit 25 Jahren die erste und zugleich einzige weibliche Dokumentarfilmerin an der Staatlichen Filmproduktionsgesellschaft Georgiens. Nur drei Filme konnte Nutsa Ghoghoberidze in ihrem Leben realisieren: Zunächst produzierte sie mit Michail Kalatosishvili den Dokumentarfilm »Mati«, wobei u.a. S. Eisenstein und A. Dovshenko am Schreiben des Szenarios beteiligt waren; für den zweiten Film »Buba« (1930), einen propagandistisch getönten erzieherischen »Kulturfilm« konnte sie den zeitweise in Paris lebenden avantgardistischen Künstler David Kakabadze5 gewinnen; ihr dritter Film »Der Sumpf« (1934) wurde trotz seiner ideologischen Umstrittenheit gerade noch auf die Leinwand gebracht. Danach setzten Repressionsmaßnahmen des Geheimdienstes NKWD gegen Nutsa Ghoghoberidze ein. Der Grund dafür lag bei ihrem Mann, dem im Jahre 1937 erschossenen Parteifunktionär Levan Ghoghoberidze. Für sie hatte seine Hinrichtung die Folge, dass sie aus der Filmproduktion hinausgedrängt und für 10 Jahre als Ehefrau eines »Mitglieds des Volksfeindes« verbannt wurde; trotz Trennung seinerseits hatte sie sich mit ihrem Mann solidarisch erklärt. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat arbeitete Nutsa für den Rest ihres Lebens als Lexikographin am Tifliser Institut für Sprachwissenschaft.
Ihr Name fehlt in sämtlichen Sowjetischen Enzyklopädien und Nachschlage-werken zum Film. »Buba« blieb noch in den 80er Jahren in Moskauer Archiven, wurde nach Georgien geholt und zweimal in kleinen Zirkeln gezeigt, um dann erneut verschlossen zu werden. Paradox genug wurde Nutsa Ghoghoberidze die Begründerin einer Dynastie von Filmemacherinnen: Ihre Tochter Lana Ghoghoberidze (geb. 1928), der die Mutter ihre Vergangenheit verschwiegen hatte, zählt mit Otar Iosseliani zur großen georgischen Filmemachergeneration der poststalinistischen Ära6. Als Schriftstellerin, Übersetzerin und Repräsentantin vertrat sie zwischen 1999 und 2006 Georgien im Europa-Rat. Von ihrer 1966 geborenen, heute in Deutschland lebenden Enkelin Salomé Alexi wurde nach ihrem ersten der Massenmigration georgischer Frauen gewidmeten neorealistischen Kurzfilm »Felicità« (2009) der abendfüllende Spielfilm »Line of Credit« 2014 auf dem Venedig Film Festival ausgezeichnet.
Abschließend sei auf die Bedeutung der georgischen Filmgeschichtsschreibung und Filmkritik hingewiesen, die sich dieser lebendigen cineastischen Tradition widmet und die ihrerseits vor einem Neuanfang steht. Als größter Kenner der georgischen Filmgeschichte gilt der an der Staatlichen Ilia Universität in Tiflis lehrende Kritiker und renommierte Journalist Giorgi Gvarkharia. 2009 hat bereits die Monographie Birgit Beumers »A History of Russian Cinema« neue Einblicke, insbesondere in die Frühgeschichte des russischen Films eröffnet. Sollte es nicht möglich sein, dass wir anlässlich des bevorstehenden 120. Geburtstages der ersten Film-Séance in Tiflis am 16. November 1896 – Anfänge, die also bis knapp ein Jahr nach der Pariser Film-Premiere der Brüder Lumière zurückreichen! – weitere Einblicke in die georgische Filmgeschichte erhalten?
[1] Erwähnt seien hier beispielhaft: Teona Mghvdeladze-Grenade und Thierry Grenade »Brother« (2013); Giorgi Ovashvili »The other Side« (2009) und »Corn Island« (2014); Zaza Urushadze: »The Tangerines« (2013); Zaza Rusadze: »A Fold in my Blanket« (2013).
[2] Er deckte sich zudem mit dem Titel einer DVD von Interviews mit Flusser hg. von Miklós Peternák für das Center for Communication and Culture, Budapest, sowie von Marcel Marburger und Siegfried Zielinski für das Vilém Flusser Archiv.
[3] Giorgi Maisuradze/Franziska Thun-Hohenstein: »Sonniges Georgien«. Figurationen des Nationalen im Sowjetimperium, Kulturverlag Kadmos Berlin 2015
[4] Michail Bachtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, in: Untersuchungen zur Poetik und Theorie des Romans, hrsg. v. Ewald Kowalski u. Michael Wegner, Berlin Weimar 1986.
[5] Über den Künstler David Kakabadze und seine Arbeiten als Filmpionier s. Katalog Tbilisi 1983 und Ketevan Kintsurashvili: David Kakabadze. Georgian Modern Artist and Inventor, New York 2013
[6] Berühmt wurde insbes. ihr Film: »Some Interviews on personal matters« (1978)
-Ghoghoberidze.jpg)
Nutsa Ghoghoberidze - aus »Family Archive – Project 50 Women of Georgia«. Bildrechte eingeholt mit freundlicher Unterstützung des Heinrich Böll Institutes, South Caucasus.