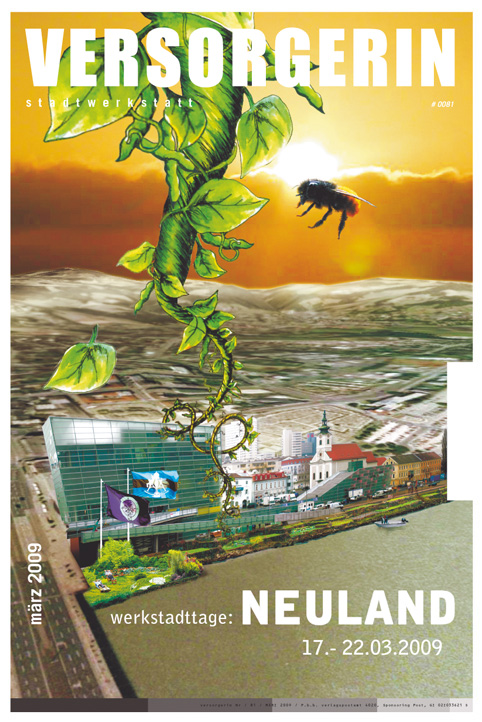Die »African Communities« weltweit hätten nie zu träumen gewagt, dass dieser Tag so bald eintreffen würde, der Tag, an dem einem Afroamerikaner das Vertrauen zugesprochen wurde, das höchste Amt der Vereinigten Staaten zu bekleiden.
Knapp 55 Jahre nach der Verhaftung Rosa Parks wegen der Verweigerung einem Euroamerikaner den Sitzplatz frei zu machen, entschieden sich 53 % der AmerikanerInnen, Barack Hussein Obama zu ihrem Präsidenten zu wählen.
Nach vierhundert Jahren der Sklaverei, Unterdrückung, Diskriminierung, Ethnientrennung, Verschleppung und Ausbeutung hat das amerikanische Volk durch diese Wahl der afrikanischen Bevölkerung rund um den Globus Hoffnung auf eine gleichberechtigte Existenz auf dieser Erde gespendet.
Have we overcome?
Die Wahl Obamas zum neuen US-Präsidenten wird wie ein Sieg über den jahrelangen unbegründeten Rassismus gegen AfrikanerInnen angesehen.
Sie erweckt auch hier die Hoffnung, dass in 20 Jahren die Hautfarbe keine Rolle mehr spielen wird.
Aus einer Umfrage des Human Institute in Klagenfurt geht hervor, dass nur 28% der Befragten (720 P.) glauben, dass ein »farbiger« Kandidat eine Chance auf ein hohes Amt in Österreich hätte. 41% hingegen glauben nicht, dass eine Chance für eineN FarbigeN bestünde. Interessanterweise hätte die überwiegende Mehrheit (70%) Obama zum Präsidenten gewählt, wenn sie in den USA stimmberechtigt gewesen wäre.
Mensch bekommt den Eindruck, als hätten die AmerikanerInnen in den letzen 50 Jahren die Ethnien–»Problematik« überwunden.
Wird jedoch ein Blick hinter die Kulissen geworfen, so wird mensch seit Beginn der Präsidentschaftswahlen verstärkt mit rassistischen Äußerungen und rassistischem Verhalten gegenüber AfroamerikanerInnen – wie es in den 1960er Jahren üblich war – konfrontiert.
Welche Schlüsse ziehen die AfroösterreicherInnen in Bezug auf den Wandel der gesellschaftlichen Stellung der AfrikanerInnen in Österreich?
Vertretern diverser Gemeinschaften der BLACK Communities konstatieren viel Verbesserungsbedarf in fast allen Lebenslagen. Genannt werden ein wirksames Anti-Diskriminierungsgesetz, Eigendarstellung und Medienpräsenz von AfrikanerInnen, ein Ende von Rassismen in der Sprache, härtere Bestrafungen für
rassistische Diskriminierungen, sowie einen geförderten Aufbau von »autonomen Strukturen« für eine »Vernetzungsarbeit« und politische Vertretung von AfrikanerInnen in Österreich.
Wie in den USA haben AfrikanerInnen im Durchschnitt ein geringeres Einkommen, eine kürzere Lebenserwartung, eine schlechte Ausbildung und in der Kriminalstatistik sind sie überdurchschnittlich
stark repräsentiert. Letzteres ist in Österreich relativ zu bewerten, denke mensch an »Operation spring« oder einfach nur an unsere menschenrechtsverachtende, kriminalisierende Asylpolitik. Zudem sind AfrikanerInnen in den heimischen Statistiken schwer erfassbar, weil sie nicht einmal 0,5 % der
Bevölkerung ausmachen.
Die Zahl der rassistischen Beschmierungen und Diskriminierungen gegenüber AfrikanerInnen im
öffentlichen Raum erhöht sich stetig.
Nichtsdestotrotz nehmen einige NGOs der African Communities diesen historischen Moment zum Anlass, die Notwendigkeit der Partizipation von ImmigrantInnen in Österreich zu thematisieren.
Obama hat den AfrikanerInnen auch hier die Hoffnung geschenkt, dass folgende Aussagen über Staatsbedienstete bald der Vergangenheit angehören:
»Ein Mann stürzte sich auf mich, schlug auf mich ein, ich bin rückwärts auf den Boden gefallen, der Unbekannte setzte sich auf mich, hielt mich am Boden fest und schlug mit den Fäusten auf mich ein«.
Dies ist die Aussage des jüngsten Polizeibrutalitätsopfers Mike B., ein afroamerikanischer Lehrer der Vienna International School. Am 11. Februar dieses Jahres wurde er von zwei Zivilpolizisten mit einem Drogendealer verwechselt. (Hätten die Beamten den »Richtigen« »erwischt«, so wäre dieser Vorfall höchstwahrscheinlich nie an die Öffentlichkeit gelangt). Dieser hingenommene Rassismus durch die Exekutive wird bestärkt durch Erklärungsversuche wie die des Landespolizeikommandanten, dass Mike B. seiner »Mitwirkungspflicht« an der Klärung des Sachverhalts nicht nachgekommen wäre. Mike B. hat das Glück im Unglück, Afroamerikaner zu sein, die amerikanische Botschaft wird Taten folgen lassen – so viel Glück hatten andere Opfer des
institutionellen Rassismus nicht.
Wir erinnern uns an den ersten medial bekannt gewordenen Vorfall der »salonfähigen« und üblich
gewordenen Polizeibrutalität gegenüber AfrikanerInnen, an Marcus Omofuma.
Er starb am 1. Mai 1999 bei der gewaltsamen Abschiebung durch die Handlung der Sicherheitsbeamten
J. Binger, J. Rosner und A. Kreuzberger. Zu ihrer Verteidigung sagten sie aus, sein Anblick sei nicht schön gewesen,… Abschiebungen werde nicht gerne gemacht,… Mundverkleben sei eine übliche und von allen angewandte Praxis bei Abschiebungen. Nach dem Prozess offenbarte der Verteidiger der drei Beamten: »Hätte Omofuma überlebt, wäre er wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung zur Verantwortung zu ziehen gewesen.«
Tausende Menschen verschwinden Jahr für Jahr in der Schubhaft. Sozialen, rechtlichen sowie karikativen Einrichtungen wird der Zutritt verwehrt. Einzig und allein die Beamten des Innenministeriums sind
eingeweiht. Das Bundesministerium für Inneres hält auch die Zahlen der in Schubhaft Verstorbenen – zur Verhinderung von Nachahmungen – unter Verschluss.
Einen grausamen Höhepunkt im Umgang mit Afrikanern erreichte die Ermordung von Seibane Wague
durch StaatsdienerInnen und Sanitäter. Der Vorfall mit dem in Mauretanien geborenen Physiker wurde am
15. Juli 2003 von einem Zeugen mit der Kamera festgehalten. Darauf ist zu erkennen, dass S. W. vor dem Eintreffen von Polizei und Rettung auf dem Boden der Einfahrt zum Stadtpark liegt. Bei der Ankunft der Exekutive springt er auf und macht einen verwirrten Eindruck. Er wird von den Beamten gezwungen sich
auf offener Straße auszuziehen, er lässt es friedlich über sich ergehen und leistet keinen Widerstand als ihm die Beamten Handschellen anlegen, bevor sie ihn in den Rettungswagen legen. Erst als die Polizisten S.W.’s Beine mit einem Sicherheitsgurt fesseln wollen, springt Wague aus dem Rettungsauto – zuvor hatte er
einen Bekannten gebeten ihn zu begleiten, da er Angst hätte. Seibane Wague wird von einem Polizisten mindestens zweimal mit geballter Faust auf den Hinterkopf geschlagen, ein Kollege boxt mindestens
fünfmal auf den oberen Rückenbereich hin, er wird zu Boden geworfen. Wague erhält vom Notarzt ein Beruhigungsmittel gespritzt. Auf den Aufnahmen sieht mensch ihn mit Handschellen am Rücken mit dem Gesicht am Boden von 9 Personen umringt liegen. Ein Sanitäter steht mit beiden Beinen auf seinem Torso, ein Polizist mit einem Bein, ein weiterer Sanitäter und eine Polizistin stehen jeweils mit einem Fuß auf seinen Beinen. Ein Polizist fesselt Wagues Beine und der Oberarzt hat währenddessen die Hände in der Hosentasche. Einige Minuten vergehen, die Beteiligten beobachten S. W. am Boden liegen, schließlich können sie sich doch motivieren, Wague auf die Tragbahre zu legen. Wie in einem schlechten Film fällt S.W. von der Bahre. Er wird hoch gehoben, wieder mit dem Gesicht nach unten hingelegt und nach einer Weile in den Rettungswagen geschoben. Seibane Wague überlebte diese Prozedur nicht.
Die Liste der in staatlicher Obhut verstorbenen Afrikaner ist ungewiss lange, mit Gewissheit starben am 22. Februar 2005 der Algerier Ben Habra Saharaoui im PAZ Hernalser Gürtel und auch am 4. Oktober 2005 der Gambier Yankuba Ceesay im PAZ Linz. In beiden Fällen gab es keine Konsequenzen für die Beteiligten – dieser strukturelle Rassismus muss ein Ende nehmen. Auch in den bekannt gewordenen Folter-Fällen wie die Misshandlung des Sudanesischen Diplomaten am 12. März 1996 im Kommissariat des 10. Wiener Bezirks oder die Folterung Bakary’s J. wurden die beteiligten Beamten wenig bis gar nicht für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen. Es ist nicht nur die Exekutive, die sich am strukturellen Rassismus beteiligt, auch die Justiz ist nicht so unvoreingenommen wie sie zu sein scheint bzw. sein sollte.
Am 28. Juni 2006 ereignete sich in Linz ein ganz ähnlicher Verwechslungsfall wie der in Wien. Trotz der offensichtlichen Verwechslung wurde Anklage wegen 1. »Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz«, 2. »Widerstand gegen die Staatsgewalt« und 3. »Verleumdung« erhoben. Ersteres wurde fallen gelassen, da es zu offensichtlich war, dass es sich bei der observierten Person um eine andere handelte als die Person, die misshandelt und verhaftet wurde. Trotz zwei voneinander unabhängigen medizinischen Gutachten, die die Misshandlung untermauerten, wurde den sechs Zeugen, die den Tatvorgang des Opfers bestätigten, auch der Prozess wegen Verleumdung gemacht. Yusuf K., ein Musterbeispiel an Korrektheit, wurde in Punkt 2) und 3) für schuldig gesprochen.
Durch die Ernennung Obamas zum Präsidenten ist die Hoffnung gewachsen, im Land der Berge und Seen als gleichwertigeR MitbürgerIn mit Respekt behandelt zu werden.
Ein sichtbares Zeichen zu setzen wünschen sich viele Mitglieder der African Communities von den Politikern, der Kirche, den Arbeitgebern, den Sozialleistungsträgern und den öffentlichen Einrichtungen.
Sie brauchen eine Vertrauensbasis, da sonst keine Partizipation seitens der AfrikanerInnen möglich ist.
Es muss das Bewusstsein geschaffen werden, AfrikanerInnen als weiteren kulturellen »Input« zu betrachten und nicht als Bedrohung. Vielfalt müsste weiter gefördert werden und wir sollten uns die Diversität zu Nutze machen. Interkulturelle Begegnungen sollten ausgebaut und die Kommunikation mit den Urheimischen gefördert werden.
Obamamania in Österreich!
Marie Edwige Hartig über die Bedeutung von Obamas Sieg für die Black Communities in Österreich.
Marie Edwige Hartig sieht sich als Austro-Bamileke, eine gebürtige Bafoussam Bamileke mit österreichischer Sozialisierung.
Von 2005 bis 2007 war sie im Vorstand der Black Community Oberösterreich tätig und arbeitet seither laufend in diversen Arbeitskreisen im Bereich Integration/Migration mit. Zurzeit befasst sie sich in ihrer Diplomarbeit (Psychologie) mit den Akkulturationsstrategien der ImmigrantInnen afrikanischer Herkunft.