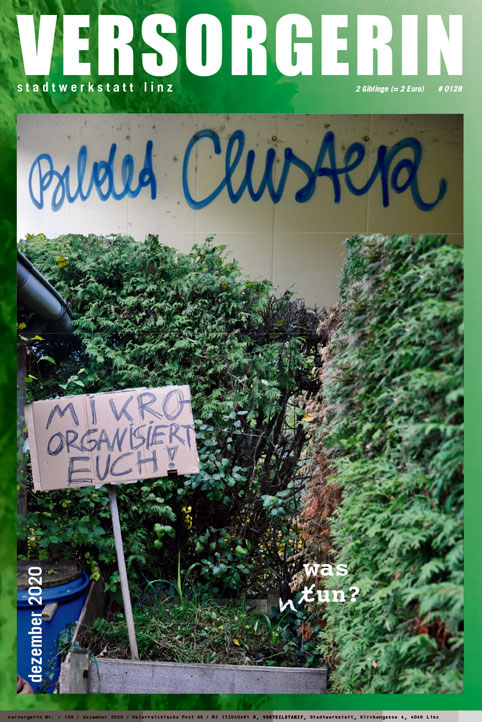Am 21. April 2020 aß Winston Ragos, wie gewohnt, bei seiner Tante zu Mittag. Es war die vierte Woche des coronabedingten Lockdowns. Mit gerade einmal 33 Jahren war Ragos bereits von seinem Beruf als Soldat gezeichnet. Eine psychische Erkrankung zwang ihn zum Ruhestand. Nach dem Essen verließ Ragos das Haus und kam nie wieder. Um 6 Uhr abends wurde er offiziell für tot erklärt. Sein Tod wurde mit einer Handykamera gefilmt und in den Sozialen Medien geteilt: Auf dem Video sind vier Polizisten in schusssicheren Westen zu sehen. Breitbeinig und angespannt stehen sie auf der Straße und zielen auf einen Mann, der sich auf dem Gehsteig befindet. Als dieser in seine Tasche greift, fallen zwei Schüsse. Ragos bricht nieder.
Sein gewaltsamer Tod ist kein Einzelfall. Wie bei den vielen Morden davor, argumentierte die Polizei auch hier mit Selbstverteidigung. Laut Augenzeug*innen ging von Ramos jedoch keine Gefahr aus – er war unbewaffnet. Als Staatspräsident Rodrigo Duterte im März 2020 den Lockdown verkündete, rief er das Militär und die Polizei dazu auf, jene zu erschießen, die sich nicht daran hielten. Ragos musste also sterben, weil er vermutlich gegen die Regeln verstoßen hatte. In der Hauptstadt Manila galten in den vergangenen Monaten besonders strenge Maßnahmen: Ausgangssperren, Kontaktverbote, die Schließung von Unternehmen sowie Schulen. Das Militär und die Polizei richteten Checkpoints ein, um die Bewegungen der Menschen zu kontrollieren. Für Teile der Bevölkerung bedeutet der Covid-19-Lockdown einen Grund mehr, in Angst zu leben.
Dutertes Anti-Drogen-Krieg
Seit Juni 2016 regiert Rodrigo Duterte die Philippinen. 16,6 Millionen Wahlberechtigte, 39 Prozent, stimmten damals für ihn – für jemanden, der politische Härte symbolisiert, für jemanden, der nicht mit frauenverachtenden Sprüchen spart und kein Geheimnis daraus macht, wie wenig er von Menschenrechten und Pressefreiheit hält. Es gibt einige Erklärungsversuche, warum Duterte in der Bevölkerung dennoch gut ankommt. Zum einen sind die Philippinen von starker sozialer Ungleichheit geprägt. Der Besitz von Land und Ressourcen konzentriert sich in den Händen weniger Eliten, die nicht nur wirtschaftlich einflussreich sind, sondern oft auch politische Ämter innehaben. Formell sind die Philippinen seit dem Sturz des Diktators Ferdinand Marcos im Jahr 1986 eine präsidentielle Demokratie. Große soziale Reformen, wie sie damals versprochen wurden, gab es allerdings nie. Zu sehr würden sie den Interessen der Herrschenden zuwiderlaufen. Politikwissenschafter*innen sprechen daher in Bezug auf die Philippinen von einer Elitendemokratie. So wirkte Duterte, in einem Land, in dem man kein Vertrauen in das bürgerliche, korrupte politische Establishment hat, für viele als Hoffnungsträger. So schenkten die Bürger*innen jenem Mann ihr Vertrauen, der so sprach »wie sie«. In der Politik war er nicht unbekannt. Bereits als Bürgermeister von Davao, der zweitgrößten Stadt der Philippinen, sicherte er sich den Ruf, hart durchzugreifen und damit für »Ordnung« zu sorgen. Im Präsidentschaftswahlkampf erklärte er nicht nur der Korruption, sondern vor allem der Drogenkriminalität den Krieg. Drogenabhängige würde er am liebsten »abschlachten«, kündigte er an. Ein Wahlversprechen, das er einhielt.
Rund 30.000 Menschen wurden seither im Zuge von Dutertes »Anti-Drogen-Krieg« getötet, schätzen Menschenrechtsorganisationen. Sie sprechen von einem Krieg gegen die Armen, denn die meisten Morde finden in den Slums der Hauptstadt Manila statt. Die Menschen sterben entweder im Zuge von Polizeirazzien oder durch Todesschwadronen, die stets nach demselben Muster vorgehen: Zwei vermummte Personen nähern sich auf einem Motorrad, sie geben ihre tödlichen Schüsse ab und fliehen. Mittlerweile finden solche extralegalen Tötungen nicht einmal mehr im Schutz der Dunkelheit, sondern bei Tageslicht statt. Denn der Straffreiheit können sich die Täter*innen so gut wie sicher sein.
Die »neue Normalität« im Lockdown
Mit den Covid-19-Maßnahmen befürchten philippinische Aktivist*innen nun eine »neue Normalität«, die Bürger*innen-Rechte sowie Handlungsräume der Zivilgesellschaft weiter einschränkt. Auf den Philippinen herrscht mittlerweile einer der weltweit längsten und härtesten Lockdowns. Dieser trifft vor allem die arme Bevölkerung, die aufgrund der Ausgangssperren von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen dastand und auf Lebensmittelhilfen angewiesen war. »Die Menschen haben mehr Angst zu verhungern, als an Covid-19 zu erkranken«, sagt Veronica Cabe, eine Umweltaktivistin, die mit anderen Freiwilligen Lebensmittelhilfen auf die Beine stellte. Eines können die Menschen auf den Philippinen gut: sich selbst und einander helfen. Denn auch nach Naturkatastrophen wie Taifunen oder Überschwemmungen hatte sich immer wieder gezeigt, dass man auf staatliche Hilfe vergeblich wartete. Das Pandemiegesetz auf den Philippinen beinhaltet zwar finanzielle Unterstützung für ärmere Bevölkerungsgruppen, allerdings sah nur ein Bruchteil von ihnen tatsächlich Geld.
Auf Proteste der Menschen reagierte die Behörde mit Repressionen. Zwischen März und Mai verhaftete die Polizei nach eigenen Angaben bereits über 40.000 Menschen. Basis der Festnahmen ist ein Gesetz vom März 2020, mit dem Rodrigo Duterte den nationalen Notstand erklärte, um die Pandemie einzudämmen. Das Gesetz beinhaltet einerseits Sonderzahlungen fürs Gesundheitspersonal. Auf der anderen Seite erweiterte es die alleinigen Befugnisse des Präsidenten. Bei Verstößen gegen das Gesetz drohen zwei Monate Haft oder eine Geldstrafe von 10.000 bis 1 Million Pesos (ca. 180 bis 18.000 Euro).
Angriff auf die Pressefreiheit
Unter Strafe steht auch die Verbreitung von »Falschmeldungen« über die Pandemie. Was als »Falschmeldung« gilt und was nicht, entscheiden die Behörden. Meist trifft es regierungskritische Medienberichte, wie im Fall zweier Journalist*innen aus Cavite, einer Provinz südlich von Manila. Bei einer Verurteilung drohen ihnen zwei Monate Haft oder eine Geldstrafe von umgerechnet 17.500 Euro. In der Rangliste der Pressefreiheit belegen die Philippinen laut Reporter ohne Grenzen (ROG) Platz 136 von 180. Das Pandemie-Gesetz ist nur ein weiterer Einschnitt in die Pressefreiheit. Für Nonoy Espina, den Vorsitzenden der Journalistengewerkschaft NUJP, gehören Morddrohungen zu seinem beruflichen Alltag. »Für mich ist es Hintergrundlärm«, sagt er. Dennoch muss er jede Drohung ernst nehmen: »Auch, wenn es wie ein Scherz wirkt, muss es ernst genommen und öffentlich gemacht werden«, rät er. Denn die meisten der 186 Journalist*innen, die seit dem Jahr 1986 ermordet wurden, hatten zuvor Drohungen erhalten.
Keine Regierung zuvor hat die Presse so direkt und öffentlich angegriffen, wie es jetzt der Fall ist. Bekanntestes Beispiel ist etwa der Prozess gegen Maria Ressa wegen Verleumdung, der auch international Aufmerksamkeit erhielt. Ressa ist die Chefredakteurin des regierungskritischen Nachrichtenportals Rappler. Oder die Abschaltung des größten Fernsehsenders des Landes, ABS-CBN: Offiziell wurde schlicht die Sendelizenz nicht verlängert, doch Duterte hat ABS-CBN immer wieder spüren lassen, dass ihm die Berichterstattung ein Dorn im Auge war.
Ständiger Kampf der Zivilgesellschaft
Angesichts dieser Herausforderungen ist die aktive Zivilgesellschaft auf den Philippinen ein Lichtblick. Menschenrechtsgruppen setzen sich unermüdlich für die Einhaltung von nationalem und internationalem Recht ein. Organisationen sind themenspezifisch in vielen gesellschaftlichen Sektoren aktiv: Bäuerinnen und Bauern kämpfen für die Umsetzung der Landreform, Indigene wehren sich gegen Bergbauprojekte in ihren angestammten Gebieten, in den informellen Armenvierteln organisiert sich Widerstand gegen Vertreibungen durch die Stadtverwaltung. Auch Anwält*innen und Journalist*innen formieren sich und setzen sich für die marginalisierte Bevölkerung ein. Die scharfen Pandemie-Gesetze schränken die Aktivitäten der Zivilgesellschaft ein. Dennoch versammelte sie sich zur traditionellen Demonstration anlässlich der jährlichen Rede an die Nation des Präsidenten. Weitere Kundgebungen fanden in Form von Auto-Demos statt.
Ihr Einsatz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit bringt Aktivist*innen immer mehr ins Visier der staatlichen Aufstandsbekämpfung. Vor allem, wenn ihnen nachgesagt wird, mit der kommunistischen Untergrundbewegung Communist Party of the Philippines (CPP) und ihrer Guerillaeinheit New People‘s Army (NPA) zu sympathisieren oder gar selbst Mitglied zu sein. 1969 gegründet, führt die CPP einen der weltweit längsten Guerilla-Aufstände an. Alle bisherigen Friedensverhandlungen führten zu keiner dauerhaften Lösung des Konflikts. Zu Beginn seiner Amtszeit liebäugelte Rodrigo Duterte noch mit einer Zusammenarbeit mit der radikalen Linken, erklärte sie jedoch zum Feind, als Waffenstillstände immer wieder gebrochen wurden.
Auch wenn Aktivist*innen nicht mit der NPA in Verbindung stehen, kursieren Listen, auf denen sie als Aufständische gebrandmarkt werden. »Red tagging« nennen es die Menschenrechtsorganisationen. Ins kommunistische Eck gestellt zu werden, führt zu Verhaftungen der Aktivist*innen oder zur Ermordung durch Todesschwadronen.
Autoritäre Bestrebungen
Die Regierung nutzt die Pandemie, um autoritäre Bestrebungen voranzutreiben, schreibt der Verein philippinenbuero aus Köln. Ein Beispiel ist das Anti-Terrorgesetz vom Juli 2020, das eine neue Härte in der Aufstandsbekämpfung demonstrieren soll. Laut Rechtsexpert*innen bedenklich ist die breite Definition dessen, was als Terrorakt gilt und was nicht, sowie die Möglichkeit, Verdächtige bis zu 24 Tage ohne richterlichen Beschluss zu inhaftieren. Das sei verfassungswidrig, sagen philippinische Jurist*innen, die das Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof beeinspruchen. Rund 30 Beschwerden gegen das Anti-Terrorgesetz liegen vor. Auch wenn Handlungsräume schrumpfen, Fenster für aktiven Widerstand hat die philippinische Zivilgesellschaft bisher immer gefunden. »Wir überlebten bereits eine Diktatur«, sagt ein Journalist. »Das können wir wieder schaffen.«
Einer der härtesten Lockdowns der Welt
Marina Wetzlmaier, Journalistin und Autorin. Als Tochter einer philippinischen Mutter fühlt sie sich dem Land seit jeher persönlich verbunden. Urlaubsreisen dorthin nutzt sie nicht nur für Verwandtenbesuche, sondern auch Recherchen. Ihr Buch »Die Linke auf den Philippinen. Eine Einführung« erschien kürzlich im Mandelbaum Verlag. wetzlmaier.wordpress.com
Von Marina Wetzmaier ist aktuell erschienen:
Die Linke auf den Philippinen – Eine Einführung
Die Entwicklung der philippinischen Linken hängt eng mit der Geschichte der kommunistischen Revolutionsbewegung und ihrer blutigen Unterdrückung zusammen. Von dieser einst stärksten Gegnerin des damaligen Diktators Ferdinand Marcos in den 1970er und 1980er Jahren, sind heute nur wenige Bastionen der Guerilla geblieben. Die philippinische Linke der Gegenwart zeichnet sich durch Heterogenität und ein breites Spektrum an Zugängen und Positionen aus. An Stelle ideologischer Motive trat stärker themenbezogenes Engagement zu Menschenrechten, Feminismus, dem Recht auf Land bis hin zu ökologischen Kämpfen. Die wichtigsten -Akteur*innen, Positionen und Auseinandersetzungen der neuen Linken werden in dieser Einführung vorgestellt. Historisch greift sie etwas weiter zurück, beginnend mit den Widerstandsbewegungen der 1930er und 1950er-Jahre. Im gegenwärtigen politischen Klima werden nach wie vor Aktivist*innen ermordet und stehen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. All dies im Namen des vom autoritären Präsidenten Duterte ausgerufenen Anti-Drogenkriegs. (Verlagstext)
Mandelbaum Verlag, November 2020
182 Seiten, EUR 12.00
ISBN: 978385476-697-1