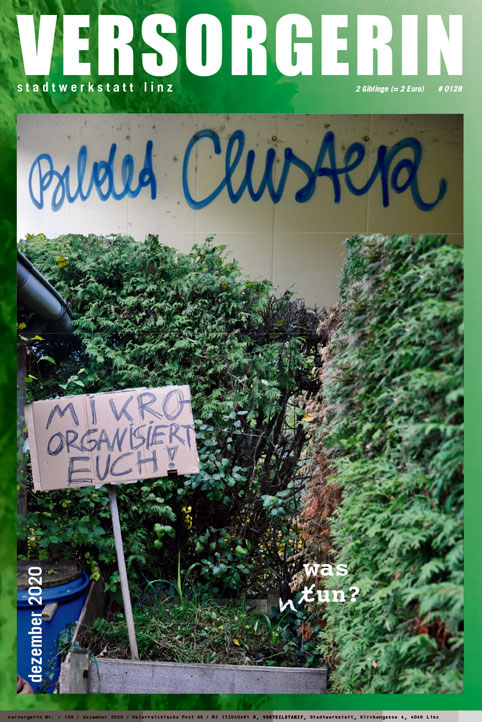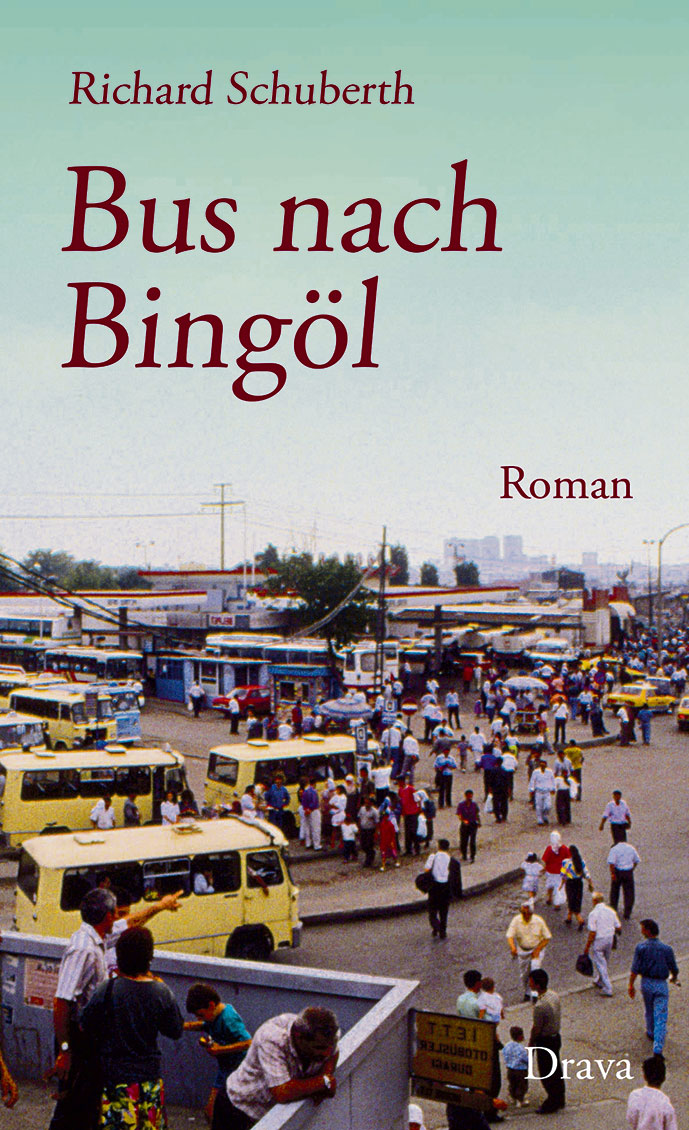Kennst du die Geschichte von den zwei Japanern in Yayladere?, fragte Kerim seinen Bruder, als sie am Abend bei Schnaps und Tee in der Küche saßen.
Nein, kenn ich nicht. Ahmet schenkte sich Tee nach.
Zwei Japaner in Holland sind verrückt nach kurdischer Kultur und wollen unbedingt Kurden werden. In Holland nehmen sie Kurmandschi-Unterricht und sprechen bald besser Kurmandschi, als nur irgendein Japaner, Holländer oder Eskimo je Kurmandschi sprach. Und dann treten sie ihre Reise in das Land ihrer Träume an. Man bringt sie zu einer alten Frau, der man nie richtig Türkisch einprügeln konnte. Sie kennt nur eine Sprache richtig. Ehrfürchtig beginnen die Japaner ein Gespräch mit ihr. Sie ist völlig unbeeindruckt, zieht die Stirn in Falten und sagt dann zu ihrem Sohn: Deine Freunde sind sehr sympathisch, aber reden können sie nicht gut.
Bevor Kerim in Gelächter ausbrach, wiederholte er den letzten Satz und ließ die Handflächen dabei mit einer Reibbewegung energisch aneinanderklatschen.
Ja, sagte Ahmet, eine wunderbare Geschichte. Die armen Japaner. Sie wollten ihre Bemühungen von einer echten Indianerin abgesegnet wissen, und dann das.
Genau, bekräftigte Kerim, die Jungs hatten eine klarere Vorstellung von Kurden als die Alte, weil sie nichts anderes kannte. Für sie, die noch nie weiter als bis Karakocan gekommen war, gab es nur zwei Arten von Leuten: die, die nicht reden können, also Türken und Holländer, und die es können. Die Japaner konnten reden, bloß nicht so gut. Die Antwort hätte eins zu eins von unserer Mutter kommen können.
Wieder verfiel Kerim in schadenfrohes Gelächter.
Ja, sprach Achmet, das gibt es oft. Es ist sehr lustig, wenn sich die Bauern von den kulturellen Annäherungsversuchen der Romantiker unbeeindruckt zeigen.
Ahmet hatte Kerim bloß beipflichten wollen, doch wie zu erwarten, nahm dieser sofort eine Gegenposition ein, vermutlich, weil ihn die ungewohnten Begriffe störten, mit denen Ahmet seiner Auffassung nach Überlegenheit bekunden wollte.
Ich finde es großartig, wie viele Menschen sich für uns interessieren, sagte er. Japaner werden Kurden. Deutsche verwandeln sich in Griechen und Italiener. Und wir? Was ist mit uns, wenn wir in die Fremde gehen? Wir bleiben immer Kurden, und sind auch noch stolz darauf, dass wir immer die gleichen Bauern bleiben. Du und ich, wir wissen, dass wir Bauern sind, aber deine intellektuellen Freunde in Wien machen nur auf Kurde, damit alle Welt glaubt, ihre Ungeschicklichkeit sei kurdische Kultur, und wenn sie aus Sehnsucht nach ihren Lieblingsziegen jaulen, wollen sie das den Almanlar als unsere Volkslieder verkaufen.
Wasch dir die Zunge, du Schandmaul, fuhr Ahmet seinen Bruder vergnüglich an, wenn du boshaft bist, ist dein Scharfsinn unübertrefflich. Du vertrittst also die These, dass die unterschiedlichen Lokalkulturen nur Euphemismen für die jeweilige Zurückgebliebenheit sind?
Euphe… was?, äffte ihn Kerim nach, du sprichst mit einem Bauern, du Japaner du. Reden kannst du gar nicht gut.
Schon gut, Kerim, es ist erstaunlich, wie sehr du bei deinen Sticheleien außer Acht lässt, was man uns angetan hat. Wie kannst du bloß so leichtfertig Menschen verspotten, die es geschafft haben, sich nicht zu Türken machen zu lassen? Kann man jemandem verdenken, der sich stolz das wiedererobert, was man ihm genommen hat?
Ja, ja, ja, was würden wir ohne unsere Verfolgung machen? – Haben Sie mir soeben auf den Hintern gegriffen? – Ja, aber Sie müssen wissen, ich bin Kurde. Ich kann Ihnen mein ärztliches Attest zeigen. – Ach entschuldigen Sie vielmals. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Da, langen Sie ruhig nochmals hin.
Ahmet tat Kerim nicht den Gefallen zu lachen, obwohl alles in ihm nach dieser Befreiung drängte. Er konnte seinem Bruder nichts vormachen. Die ernste Miene nahm ihm der nicht ab, und so spielte Kerim das Spiel mit ihm, bei dem er schon als Kind stets als Sieger hervorgegangen war. Wer lacht zuerst? Mit listigen Augen fixierte er den Bruder, um dessen gravitätischen Gesichtsausdruck zum Bersten zu bringen, was mit gravitätischen Gesichtsausdrucken
besonders leicht geht.
Was schaust du so dumm?, fuhr ihn Ahmet an.
Diese milde Aggression zeigte Kerim, wie sehr sich der Bruder gegen das Lachen wehrte. Der aber verfiel auf eine List und flüchtete sich in Gedanken. Und Kerim erkannte, wie Ahmets Augen zwar geradeaus starrten, aber sein Blick allmählich nach innen driftete.
Ahmet hätte ein Bestimmungsbuch über die Dummheiten, Irrtümer und Rassismen der wohlmeinenden Antirassisten und Indianerliebhaber in Wien schreiben können. Immer wieder hatte er sich dazu an den Schreibtisch gesetzt. Und das Geschriebene am nächsten Tag meistens gelöscht. Irgendwann ließ er es sein, weil es völlig sinnlos war, weil er der Szene, in der er verkehrte, nicht in den Rücken fallen wollte, die so trunken von der selbstgerechten Solidarität mit allen Fremden war, dass sie nie und nimmer eingesehen hätte, was alles faul an ihren Vorstellungen war. Wie sehr sie doch Teil des Problems war, gegen das sie aufzutreten glaubte. All die Bürgerkinder, die ihren rassistischen Eltern eins auswischen wollten, indem sie die Zugewanderten zu ihren Ethnoteddybären machten, ihnen, wie Mädchen es bei ihren Puppen taten, die Haare kämmten und sich vom eigenen Individualismus, der lediglich darin bestand, so viele Lebensentwürfe, Dinge und Menschen wie möglich auszuprobieren, dadurch kurierten, dass sie an solchen wie Ahmet ihre Sehnsucht nach Stamm und Tradition auslebten und sie ihrem kulturellen Artenschutzprogramm unterwarfen. Zu so einer Projektion gehören aber immer zwei. Denn er und die anderen Indianer ließen es sich gefallen, weil diese wohlmeinende Fremdbe-stimmung von erpresserischer Süße war. Mit sanftem Spott beobachtete er, wie mancher Kurde langsam zu einem Kurden wurde, wie es ihn daheim nicht gab, sondern eher das Wunschbild seiner weißen Bewunderer befriedigte. Ahmet war sich des Widerspruchs schmerzlich bewusst, dass er sich zwar geistreich darüber ärgerte, permanent von den solidarischen Bleichgesichtern auf seinen Stamm reduziert zu werden, aber dennoch nicht darauf verzichten konnte, weil ihm diese Rolle so viele Vorteile und kleine soziale Erfolge brachte und er – Kerim hatte verdammt noch mal recht – ohne diese edle Verkleidung in den Augen der Österreicher vielleicht wirklich nichts als ein Bauer wäre.
Die weißen Idioten wollten ihm eine Stimme geben, aber die seine nicht hören. Indianer, die nicht sagten, was diese hören wollten, bekamen das Megaphon gleich gar nicht. Die Bleichgesichter züchteten sich aus einem Pool von Migranten ihre passgenauen farbigen Plüschrebellen heran, gemeinsam mit den verwöhntesten und privilegiertesten der zugewanderten Bürgerkinder, die als die zornigen Stimmen der Benachteiligten posierten und so sich ihre Jobs und Positionen sicherten. Diese Primarstöchter und Architektensöhne traten dann als die nie gewählten Repräsentanten der Gastarbeiter und der Bauern auf, und begannen auf wild und radikal zu machen und auf Ghettokind, doch wenn sie wütend die Faust erhoben, hing die immer durch, genau so, wie ihre Stimmen durchhingen, wenn sie versuchten, wütende Slogans ins Mikro zu rappen, in diesem kindlichen Zahnspangenton – Stimmen, die nicht taugten, zur Tat aufzurufen, sondern bloß, zu jammern, wie arg alles sei.
Bei Diskussionsveranstaltungen wusste er, dass er nie als Ahmet Arslan eingeladen war, sondern als Stammessprecher, und er sich die eine oder andere Provokation ihrer Gemeinplätze nur wegen seiner Authentizität, den eingebildeten Tränen in seinen Augen und der Feder, die man ihm in der Maske zuvor ins Haar gesteckt hatte, leisten durfte, während ein weißer Kollege für dieselben Aussagen am Marterpfahl gelandet wäre.
Was ist los mit dir, Bruder, träumst du wieder von den alten Tagen, fragte Kerim.
Ach nichts, sprach Ahmet. Ich habe eine ähnliche Geschichte aus Wien. Ein kurdische Freundin nahm ihre Mutter eines Tages mit zu einer Feier, eine Alevitin aus Dersim. Auch ein irakischer Kurde aus Erbil, ein Maler, war anwesend. Der hatte als hauptberuflicher Kurde Probleme mit den Aleviten und Linken und allen, die nicht nur Kurden sein wollten. Meine Freundin fragte ihre Mutter im Scherz, ob sie sich Mahmut, so hieß der Künstler, als Schwiegersohn vorstellen könne, obwohl er Sunnit und aus dem Irak sei. Daraufhin sagte die Mutter: Ja, warum nicht? Ist doch auch ein Mensch.
Einmütig lachten die Brüder.
Ich brauch nicht dazusagen, Bruder, was für saures Gesicht dieser Mahmut machte und wie sehr ihn die Antwort in seinen Vorurteilen gegenüber den Aleviten bestätigte. Für die Frau war es völlig egal, ob er Kurde oder Japaner war, solange er ein Mensch war. Und er war sauer, weil sie ihn nur als Menschen und nicht als Kurden …
Lass gut sein, du Japaner, ich hab schon verstanden.
In solchen Momenten war Ahmet in dieser Einöde dankbar, seinen frechen Bruder zu haben. Mit Izzet hätte er über diese Geschichte niemals so lachen können.
Mit freundlicher Genehmigung des Drava Verlags
Das Buch
Richard Schuberth: Bus nach Bingöl, Klagenfurt/Celovec 2020, 280 Seiten, 21 Euro