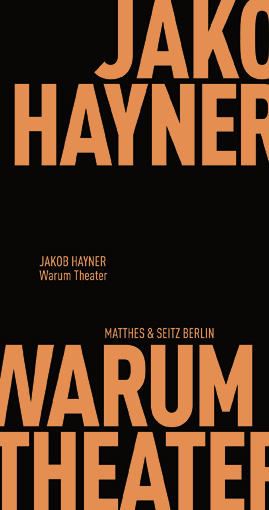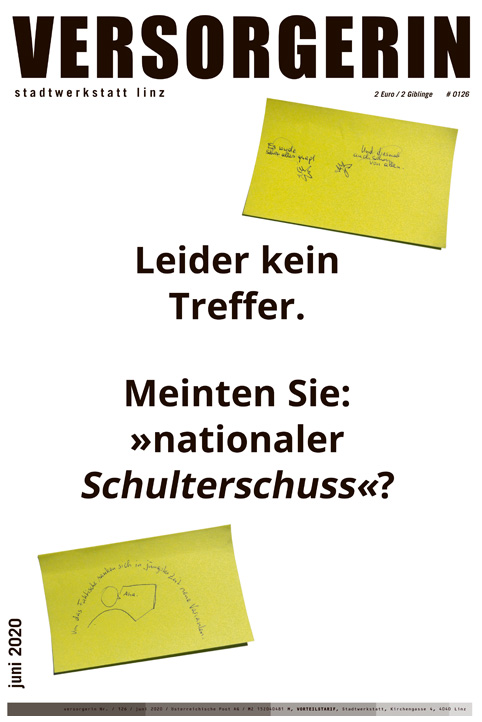Das Theater der Gegenwart zeichnet sich durch eine eminente Politizität sowie einen expliziten und engen Bezug zur Gesellschaft aus. Es versteht sich selbst als Form der Kritik an ihr. Auch in deinem Buch »Warum Theater. Krise und Erneuerung« ist vorrangig das Verhältnis von Theater und Gesellschaft Thema. Du zeichnest eine Krise des zeitgenössischen Theaters nach, die Ausdruck der Krisenhaftigkeit des Spätkapitalismus und des Neoliberalismus als seiner Vergesellschaftungsform ist. Worin besteht die ästhetische Symptomatik dieser Krise?
Das hat mit der Entwicklung der Kunst zu tun – vom Kunstwerk zur Ware. Nachdem die Avantgarden den Schock und die Provokation eingeführt hatten, wurden diese zum aufmerksamkeitserzeugenden PR-Mittel auf einem hart umkämpften Markt. Und nachdem man von der Kunst in bester Absicht unmittelbare Wirkungen im politischen Kampf erhoffte, ist diese nun zu einer Art Kummerkasten und allgemeiner Beschwerdestelle geworden – bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Wirkungslosigkeit. In der Postdemokratie wird widerständiges Verhalten ein rein ästhetisches Phänomen. Blöderweise können damit alle gut leben, weil es ein gutes Gefühl macht und niemandem weh tut. Unter diesen Umständen kann alles Künstlerische sich als politisch verstehen, ohne politische Wirkungen zu haben. Alexander García Düttmann hat das einmal sehr treffend als »politische Ideologie« der Gegenwartskunst bezeichnet, also ein tiefes Einverstandensein mit der Gesellschaft hinter einer politischen Fassade.
Mein Buch knüpft an Beobachtungen der jüngeren Zeit an, dass die neoliberale Herrschaft mit einer Ästhetisierung von Politik nicht nur wunderbar leben kann, sondern diese gar hervorbringt. Kunst wird selbst Teil des Herrschaftszusammenhangs, anstatt über ihn aufzuklären und darüber hinauszuweisen. Bei Adorno und Horkheimer heißt das Kulturindustrie und Mark Fisher nennt es kapitalistischen Realismus. Das ist die Folge dessen, dass sich die kapitalistische Produktion in der Kunst durchgesetzt hat. Und der Niederlage einer proletarischen Alternative, die sich immer wiederholt. Der wahre Kern all der kruden Debatten über »kulturelle Aneignung« ist, dass es eine reale Enteignung der Produzenten gibt. Nur ist das keine Frage der Herkunft oder vermeintlicher Eigentumstitel an fein säuberlich getrennten Kulturen.
Meine zentrale These lautet, dass das Wichtigste vergessen wurde: Warum eigentlich Theater? Was will man mit der Verwandlung, dem Spiel und dem Schein? Doch wenn man sich den unangenehmen Fragen nicht stellen will, flüchtet man in Ersatzhandlungen. Das theatrale Handwerk hat viele Anwendungsmöglichkeiten und so wurde das sogenannte »Angewandte Theater« das neue Ideal. Jedes Vergessen der Zwecke und jede Fetischisierung der Mittel jedoch ist eine Niederlage des aufklärerischen Denkens und ein Erfolg der Gegenaufklärung. Dementsprechend kritisch sehe ich den Jargon der Performativität, der sich durch die Theater und schlimmer noch durch die Theaterwissenschaften zieht. Ohne Frage gibt es ein performatives Vermögen des menschlichen Körpers, aber das ist nicht das ganze Theater.
Die politische Ideologie des Theaters koinzidiert also gewissermaßen mit einer Verdrängung der eigenen Krise, die auch den Zweck des Theaters als einer gesellschaftlichen Praxis berührt. Wie erklärst du dir die mangelnde Reflexion über die Frage: Warum Theater?
Reflexion hat soziale Voraussetzungen. Nun konkurrieren viele Künstler um knappe Güter wie Geld und Aufmerksamkeit. Jeder produziert für sich. Und das Bewusstsein, dass Theater eine gesellschaftliche Praxis ist, schwindet. Im Kapitalismus soll der Markt vermittelt über die individuelle Konkurrenz die einzige Möglichkeit sein, zur Wahrheit zu kommen, weil die sich dann durchsetzt. Wenn man diese Idee, die ja noch nicht einmal bei Glühbirnen funktioniert, dann auf Bereiche wie Wissenschaft oder Kunst überträgt, wird’s absurd. Denn Wissenschaft und Kunst interessieren sich auf je verschiedene Weise für die Frage der Zwecke, was aber hinderlich ist. Und dann ordnet man sich beliebigen Zwecken unter. Dann kann man nur noch Performances und Prozesse optimieren – wie immer auf dem Markt. Erreichbarkeit der Zielgruppen oder digitale Distribution, wofür sich halt der herrschende Managementgeist so interessiert. Und so entsteht ein betriebseigener Zynismus, vor allem bei den Schauspielern, die am meisten ackern müssen und am wenigsten verdienen. In immer kürzerer Zeit müssen immer mehr Produktionen gemacht werden, das wird sich trotz der Zwangspause auch künftig kaum ändern. Das Theater leidet an einer Überproduktionskrise. Man weiß weder warum, noch wie weiter. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das nicht nur dem Theater so geht, sondern der Ausdruck einer Gesellschaft ist, der jede historische oder sittliche Vision abhanden gekommen ist.
In deinem Buch charakterisierst du vier Verfahren des politischen Theaters der Gegenwart: symbolische Aktionen, Politik der ersten Person, Auseinandersetzung mit der Identität einer Gruppe, Wiederholung traumatischer Situationen. An diesen Erscheinungen ästhetischen Engagements verdeutlichst du, dass die politischen Anliegen, die hier zum Ausdruck kommen sollen, die bestehenden Verhältnisse letztlich bloß wiederholen. Woran liegt das?
Wenn man es herunterbricht, liegt das an dem unbewussten Konformieren. Entweder mit der spektakulären Medienwelt, der liberalen Anerkennungspolitik oder der Ideologie des Katastrophismus, also zentralen Aspekten neoliberaler Wirklichkeit. Mein Einwand setzt aber auf der Ebene der libidinösen Ökonomie an. Der marxistische Kunsttheoretiker Terry Eagleton meinte einmal, dass es in der Moderne drei wichtige Fragen gibt. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Und wozu fühlen wir uns hingezogen? Die dritte Frage ist die des Ästhetischen. Das bedeutet aber auch, dass es ein Problem gibt, wenn sich die künstlerische Kritik quasi hypnotisch an das bestehende Schlechte kettet oder sich maximal an Vorzeichenwechseln versucht, also an symbolischer Umdeutung. Mit dem Vokabular der Psychoanalyse könnte man das ein perverses Genießen nennen, das in der Form der Klage die fremde Macht und die eigene Ohnmacht lustvoll erfährt. Es ist daher kein Zufall, dass diese von mir analysierten Spielarten politischen Theaters in der Regel kaum Wert auf künstlerische Form legen. Denn in der poetischen Form artikuliert sich ein anderer Zustand, zu dem wir uns hingezogen fühlen können. Bleibt das aus, so kommt es zu einem Verlust der utopischen Dimension. Und das raubt der Kunst die Kraft. Das politische Theater, das dann bleibt, hat zwar Einwände vorzubringen, die aber kaum über den Kreis der sowieso Überzeugten hinaus Wirkungen entfalten. Weltveränderung ist dann kein Thema mehr. Auch das ist kein Zufall: Schlechte Kunst schlägt schlechte Politik vor.
Das Verhältnis von Kunst und Politik betreffend betonst du in deinen Überlegungen immer wieder die Bedeutung der Form und des ästhetischen Scheins, auch bezüglich des zeitgenössischen Theaters, dem du jedoch Formlosigkeit und damit Nähe zur Warenform vorwirfst.
Mir geht es um einen emphatischen Begriff von Form, denn etwas wirklich Formloses gibt es natürlich nicht. Adorno sagte einmal, dass das Ästhetische eine eigene Logik habe, die eines in sich motivierten Sinnzusammenhangs. Da artikuliert sich also etwas Anderes im Kunstwerk – im Schein und im Spiel. Ästhetischer Schein ist keine Beschränkung von Wirkung, er garantiert die der Kunst überhaupt erst. Denn Kunst ist nun einmal kein Werkzeug zur Bearbeitung der Wirklichkeit, sondern ein Medium der Reflexion – durch das in sich Reflektierte der künstlerischen Form. Und meine skeptische Vermutung ist, dass jede Laxheit in formalen Fragen zur Anpassung führt. Und die Warenform ist einfach die gesellschaftlich vorherrschende Form, die alles unterwirft. Ästhetische Form ist selbst ein widerständiges Verhalten gegen diese Vorherrschaft.
Welche Möglichkeiten stehen der darstellenden Kunst – auch in ihrem Verhältnis zu anderen Künsten – im Besonderen zur Verfügung, soziale Kritik durch Form zu artikulieren?
Darstellende Kunst heißt Schauspiel, also jemand spielt etwas vor anderen. Verkörperung von Nichtseiendem, wenn man es theoretischer fassen will, auch ungedeckte Behauptung oder erlaubte, weil nicht-schädliche Lüge. Nun hat sich Theater über die Jahrhunderte als Kulturtechnik entwickelt, allerdings nicht so stark, weil es viel weniger von Technik abhängig ist als andere Künste. Beckett und Brecht sind wichtig oder auch Shakespeare. Dessen Dramen kritisieren in unübertroffener Komplexität die Herrschaft und das Ressentiment zugleich. Was es in der Wirklichkeit nicht gibt, stellt die Kunst vor: eine Partei der Vernunft innerhalb eines Geflechts falscher Gegensätze. So kommen wir zu einem weiteren Punkt: Die Darstellung von Widersprüchen mittels Handlung, Kollision, Konflikt, Rede und Gegenrede – und das gewissermaßen von einem höheren Standpunkt aus. Das gibt es in Grundzügen schon seit der Antike. Aber ganz bescheiden würde ich sagen, dass darin noch immer eine der entscheidenden Möglichkeiten des Theaters liegt: der vor Publikum ausgetragene Dissens. Die Kunst muss ihn nicht lösen, aber sie kann vielleicht mit ästhetischer Phantasie den Weg der Lösbarkeit antizipieren.
Dieses antizipatorische Vermögen benennst du auch als eine »Wiedergewinnung des elementaren Sinns« des Theaters: »der gespielten Welt als eines anderen Weltentwurfs«. Verweise auf zeitgenössische Inszenierungen hinsichtlich dieser Erneuerung der Idee des Theaters bleiben in deinem Buch gleichwohl singulär.
Ich wollte in meinem Buch den Eindruck einer Top-oder-Flop-Liste vermeiden. Und zwar nicht nur, weil ich das unangemessen fände, sondern auch, weil meine Überlegungen nicht bloß auf bessere Theaterabende zielen – wogegen nichts einzuwenden wäre –, sondern die Frage nach dem Gebrauch des Theaters berühren. Es geht um das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Und damit auch um die Frage, ob wir überhaupt in einer Gesellschaft leben, die mit Kunst etwas anfangen kann – außer sie als ein weiteres Mittel zum Geldvermehren neben Schnellfeuergewehren und Kartoffelchips zu nutzen. Das funktioniert freilich dann am besten, wenn man diese Welt zugleich vergessen kann, sich also betäuben lässt. Das sind Dinge, an denen kann kein einzelner Theaterabend unmittelbar etwas ändern. Was aber selbst ein einzelner Abend könnte, wäre die Vorahnung eines anderen Weltverhältnisses zu wecken. Und vielleicht eine deutlichere Ahnung der Dinge, die dem momentan im Wege stehen. Ich glaube, das kann auf vielen Wegen geschehen – mit komischen oder tragischen Mitteln, mit alten oder neuen Texten, mit großem technischen Aufwand oder mit ganz geringem. Man muss nur ans Theater und seine Mittel glauben. Was aber auch bedeutet, deren Grenzen zu kennen. Denn das Entscheidende passiert nicht im Theater, aber dort lässt es sich begreifen und erfühlen.
»Das Theater leidet an einer Überproduktionskrise«
Von Jakob Hayner ist gerade das Buch »Warum Theater. Krise und Erneuerung« erschienen. Robin Becker hat mit ihm im Interview über Krisen und mögliche Bedeutung des Theaters heute und dessen Verhältnis zu Politik und Gesellschaft gesprochen.
Jakob Hayner: Warum Theater. Krise und Erneuerung.
Matthes & Seitz, Berlin 2020. 172 Seiten, 15 Euro.