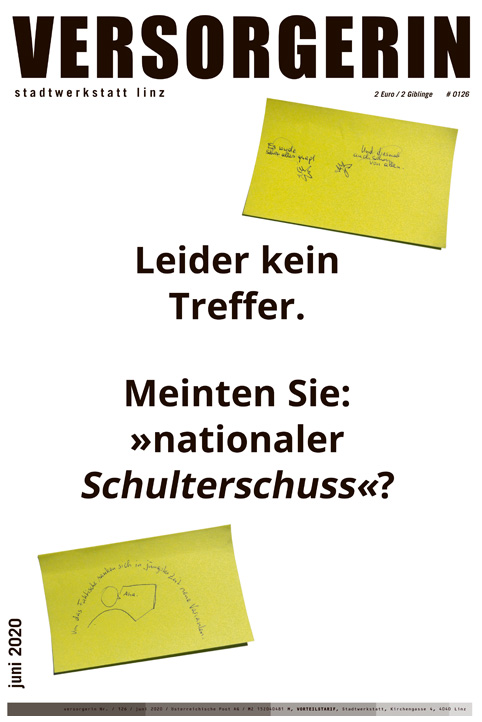Irgendwo in einem kleinen Klub, irgendwo in New York: Rauchschwaden wabern um den nicht mehr jungen Mann auf der Bühne. Sein Gesicht ist hinter einem merkwürdigen Mop-artigen Vorhang an seinem Stahlhelm verborgen. Im Flecktarn der Waffen-SS sitzt er auf der Bühne und entlockt seiner ochsenblutfarbenen Akustikgitarre getragene Klänge. Hinter der Gesichtsgardine, die sich als Tarnmaske deutscher Scharfschützen aus dem zweiten Weltkrieg entpuppen sollte, raunt er mit dunklem Timbre ins Mikrofon: »I want you to live by the justice code, I want you to burn down freedom’s road«.
Douglas Pearce, Mastermind der Band Death In June, ist ein alter Hase im Provokationsgeschäft. Der bekennende Homosexuelle schrie sich in den späten Siebzigern als Mitglied der britischen Punkband Crisis auf Rock Against Racism Veranstaltungen noch die Seele aus dem Leib. Wenige Jahre später frönte er bereits einem düsteren, kryptofaschistischen Lagerfeuerindustrial und wurde zum Pionier des sogenannten Neofolk.
Und damit sind wir auch schon mittendrin in den schmerzhaften Fragen: Zeckt rechts heute wieder mehr als links? Werden Autorität und Gehorsam in Zeiten von Hyperindividualismus, abschmelzenden Sozialsystemen und sich granularisierenden Gesellschaften wieder sexy?
Death In June sind zwar ein alter Hut aus den Abbruchkanten des Pop-Undergrounds der Achtziger- und Neunzigerjahre, dennoch erfreut sich ihr semiotischer Flirt mit dem Verbannten und Verbotenen wieder einer wachsenden Anziehungskraft bei jungen Menschen. Ein Blick in die durchkuratierten Social-Media-Accounts der medial hochgejazzten Heimathipster von den Identitären genügt. Wir sehen dort sorgsam frisierte Jungs und Mädel Apfelstrudel backen, auf Instagram-befilterten Waldlichtungen Ernst Jünger und Carl Schmitt lesen oder im dräuenden Fackelschein den Befreiungen Wiens von diversen Türkenbelagerungen gedenken. Die Rechts-Millenials bespielen die Social-Media-Klaviatur mit eingeborener Leichtigkeit und schwelgen sich dort tief in einen nostalgischen Narrativ hinein. Sie wollen zurück in eine Erzählung, die sie sich als Gegenthese zur asymmetrischen Postmoderne aus dem Fundus der Geschichte zurechtgezimmert haben. Ebenso besorgniserregend, aber mit ihrem robusten bodycount bisher um Einiges gefährlicher als die Träumer der IB und die von ihnen angestrebte Werthers Echte Welt, sind die vielen jungen Europäer, die vor ein paar Jahren nach Syrien und in den Irak aufgebrochen sind, um für die Menschen – und allen zivilisatorischen Standards – die Hälse abschneidende Todesguerilla des Islamischen Staates zu töten und zu sterben. Wie ist es möglich, dass eine wachsende Zahl junger Skandinavier, Belgier, Holländer, Franzosen, Deutscher oder Österreicher – mit und ohne Migrationshintergrund – ideologisch dermaßen aufrüsten und ihr Heil wieder in hyperautoritären Systemen, wie einem fanatischen Islamismus suchen, statt es in den liberalen Freiheiten zu finden, von denen sich ihre Altersgenossen aus dem globalen Süden auf seeuntüchtige Schlauchboote locken lassen? Ist die Welt nach dem Wegbrechen des Kalten Kriegs-Dualismus, der sie zumindest an der Oberfläche geordnet hatte, nach 9/11, Afghanistan- und Irakkrieg, Finanz- und Flüchtlingskrise wieder ein ernsterer Ort geworden? Rückblickend muss man Peter Scholl-Latour zumindest teilweise recht geben, als er etwas vom Ende der Spaßgesellschaft murmelte, nachdem 2001 die Twin-Towers in sich zusammenbrachen.
Spießer schockt man heute von rechts
Kann es sein, dass das liberale Konzept von »Jeder kann es schaffen« in Zeiten globaler Unsicherheit, schwindenden sozialen Gewissheiten, zunehmender digitaler Überwachung und einer hochgradig unübersichtlich gewordenen Welt an Strahlkraft eingebüßt hat, weil es vom Neoliberalismus und dessen nicht eingelösten Versprechungen längst ausgehöhlt wurde?
Wer heute seine linksliberalen DIE ZEIT-Abo-Eltern schocken will, schwänzt nicht freitags mit Greta die Schule für’s Klima, sondern macht, je nach Gusto, mit bei den Identitären oder konvertiert gleich zum Islam. In Michel Houellebecqs romangewordenem Gedankenexperiment Unterwerfung, lösen sich Erstere übrigens in letzterem auf, da sie erkennen mussten, dass sie im Großen und Ganzen dieselben Ziele verfolgen und eine Welt aus Gehorsam, Glauben, Zucht und Ordnung errichten wollen. Beide autoritäre Strömungen sind hochgradige Nostalgiker und möchten zurück in ein selbstkonstruiertes Früher, das es so nie gab.
Der Blick in eine Richtung, die von sich behauptet Links zu sein, stimmt auch nicht besonders optimistisch: Dogmatisch durchgepeitschte Sprachregelungen, infantilisierende Triggerwarnings und intellektuelle Safespaces, sind heute der traurige Standard an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der westlichen Welt. Auch dort ist ein brutaler Kompetivismus auf dem Vormarsch, der nicht etwa Erkenntnisgewinn, Pluralität und das Hinterfragen aller Position befördert, sondern dessen Wert einzig und allein im Sieg der eigenen Haltung liegt. Haltung – mittlerweile auch ein Begriff, bei dem inzwischen Vorsicht geboten ist, denn was sind in seinem Schatten schon noch Fakten? Im besten Fall nach Belieben formbare Verfügungsmasse für die eigene Weltauslegung. Manch Lehrende an Universitäten, die nicht auf politischer Linie mit den Studentenvertretungen sind, werden ausgebuht, bevor sie auch nur einen Mucks machen konnten. Man möchte ja nicht kontaminiert werden mit anderen Zugängen. Huldigt man also auch in der einst so emanzipatorischen und diskursoffenen Linken längst einer neuen Lust an Linientreue und Gehorsam?
Gut ablesen kann man jene Degradation auch an der Entwicklung des VICE-Magazins. Vor gut zwei Jahren hatte ich bei dem Agenturableger namens VIRTUE in Wien als Texter gearbeitet und sah mich bald schon selbst Beiträge für das Magazin schreiben. Doch mein im Berlin der späten Zweitausender aufgenommenes Bild der VICE-Welt, die ich immer als ziemlich edgy wahrgenommen hatte, erwies sich bald als schwer veraltet. Hatte sich das Magazin in den späten Neunzigern und den Nullerjahren einen Ruf als journalistische Manifestation von Rebellion, Jugend- und Popkultur; als rotzfrecher Kratzfinger auf dem globalen Gesellschaftsschorf erarbeitet, ist es heute zum Zentralorgan einer zwar aufmüpfig verbrämten, ideologisch aber lupenreinen und sehr US-amerikanischen Political Correctness geworden. VICE erwies sich bald nur noch als Marken-Feigenblatt und Nachlassverwalter ehemaliger Coolness für das aus ihm gewucherte Werbe- und Mediennetzwerk, welches es sich mit seinen vielen Industriekunden nicht mehr verscherzen möchte. Zugespitzt könnte man sagen, es hat eine Entwicklung von, sagen wir, Michail Gorbatschow zu einem sehr erfolgreichen Onlinehändler von gefälschten Berliner-Mauer-Stückchen durchlaufen. Der einstige VICE-Mitbegründer Gavin McInnes – einst Godfather of Hipsterism – ist hingegen der Provokation treu geblieben und somit aus heutiger VICE-Sicht eine absolute Hassfigur. Mit seinem Proud Boys Club ist er inzwischen zu einem Top-Player innerhalb der amerikanischen Alt-Right-Bewegung avanciert. »Ich bin noch immer derselbe Punk, der ich vor 20 Jahren war, nur dass meine Zielscheibe nicht mehr die bourgeoisen Spießer aus den Suburbs sind, sondern die politisch korrekte linke Elite«, gefällt sich der Provokateur der ehemaligen Provokateure und nach wie vor unsympathische McInnes in einem Interview und erhärtet damit die These, dass das Element der Rebellion derzeit leider von links nach rechts wandert. Übrigens wurde die VICE-Chefredaktion hierzulande inzwischen, wie in globalen Corporates üblich, einfach wegstrukturiert. Führende Ex-Kader haben nach der Implosion von VICE in Österreich entweder in den hauseigenen Agenturableger rübergemacht, oder davor schon eigene Werbe- oder Content-Agenturen gegründet, um mit dem dort produzierten Trashflow, den Cashflow für spätere und wohl härtere Zeiten nicht versiegen zu lassen. Journalismus? War da was?
My identity is my castle
Von links, aber auch von rechts bläst es seit Jahren immer stärker in die Segel der Identitätspolitik. Dieses sozialpolitische Konzept aus den USA – ursprünglich angetreten, um für die Gleichberechtigung marginalisierter Gruppen einzustehen – hat sich heute komplett verselbstständigt. Anstatt Unterschiede zu überwinden, werden immer mehr davon identifiziert, fixiert und zelebriert, was die Gesellschaft in Communities von immer kleineren und immer lauteren Minderheiten zersetzt. Menschen werden darin auf Merkmale wie Geschlecht, Rasse, Religion oder sexuelle Orientierung reduziert und ermutigt, sich über die in diesen Kategorien gebetteten Viktimisierungspotentiale Geltung zu verschaffen. Anstatt einer Gesellschaft, die in ihrer Diversität die richtigen Fragen an ein System stellt, dass Differenz erst vertikalisiert hat, werden so die Unterschiede zur Munition in den algorithmisierten Schlachten um Aufmerksamkeit. I’m offended, therefore I’m right! lautet die narzisstische Formel im Stellvertreterkrieg der Pseudoidentitäten. Der Philosoph Robert Pfaller schreibt darüber in seinem Buch Erwachsenensprache: »Wenn man Menschen keine Zukunftsperspektive mehr zu geben vermag, lenkt man ihren Blick eben auf ihre Vergangenheit, ihre Herkunft oder auf den Punkt an dem sie stehen.«
Diese von zahllosen Mikroaggressionen getriggerten Snowflakes machen sich mit ihrer an den Universitäten und auf Social-Media antrainierten Überempfindlichkeit zur dankbaren Zielscheine für rechte Zyniker und leben doch in einer symbiotischen Beziehung mit ihnen. Und auch die Rechte ist nicht davor gefeit, über Fremd- und Selbstzuschreibungen wie Alte weiße Männer, Proud Boys, Trad Wives oder was auch immer in den Märtyrerchor der Identitätspolitik einzustimmen. Der Name Identitäre Bewegung sagt hier eigentlich schon alles.
So stehen sich heute eine wachsende Zahl an Filterblasen aus Panzerglas unversöhnlich gegenüber. Ihre Insassen fordern für die eigenen Wahrheiten ungeteilte Akzeptanz und begreifen sich dabei doch als die einzig fähigen Ärzte für eine als krank empfundene Welt.
Ist Gehorsam der Ungehorsam von heute?
Schon vor dem Corona-Notstand wurde deutlich: Ob in der Politik, Debatten- oder Popkultur – Autorität und die Lust am Regeln und Strafen sind wieder auf dem Vormarsch. Formiert sich im toten Winkel (neo-)liberaler Freiheitsversprechen, die sich für immer mehr Menschen immer weniger einlösen, wieder die Sehnsucht nach der starken Hand, die die Welt ordnet? Von Alexander Keppel.
Alexander Keppel, geboren 1982 in Berlin. Studierte Kommunikationsdesign und Freie Kunst in Potsdam und Posen. Lebt seit 2015 in Wien.
Betreibt den Blog »Der Luftraum« auf derstandard.at. Sein 2022 veröffentlichter Debütroman »Der Zweite Kontinent« erscheint dieses Frühjahr in durchgesehener Neuausgabe bei Drava/Wieser.