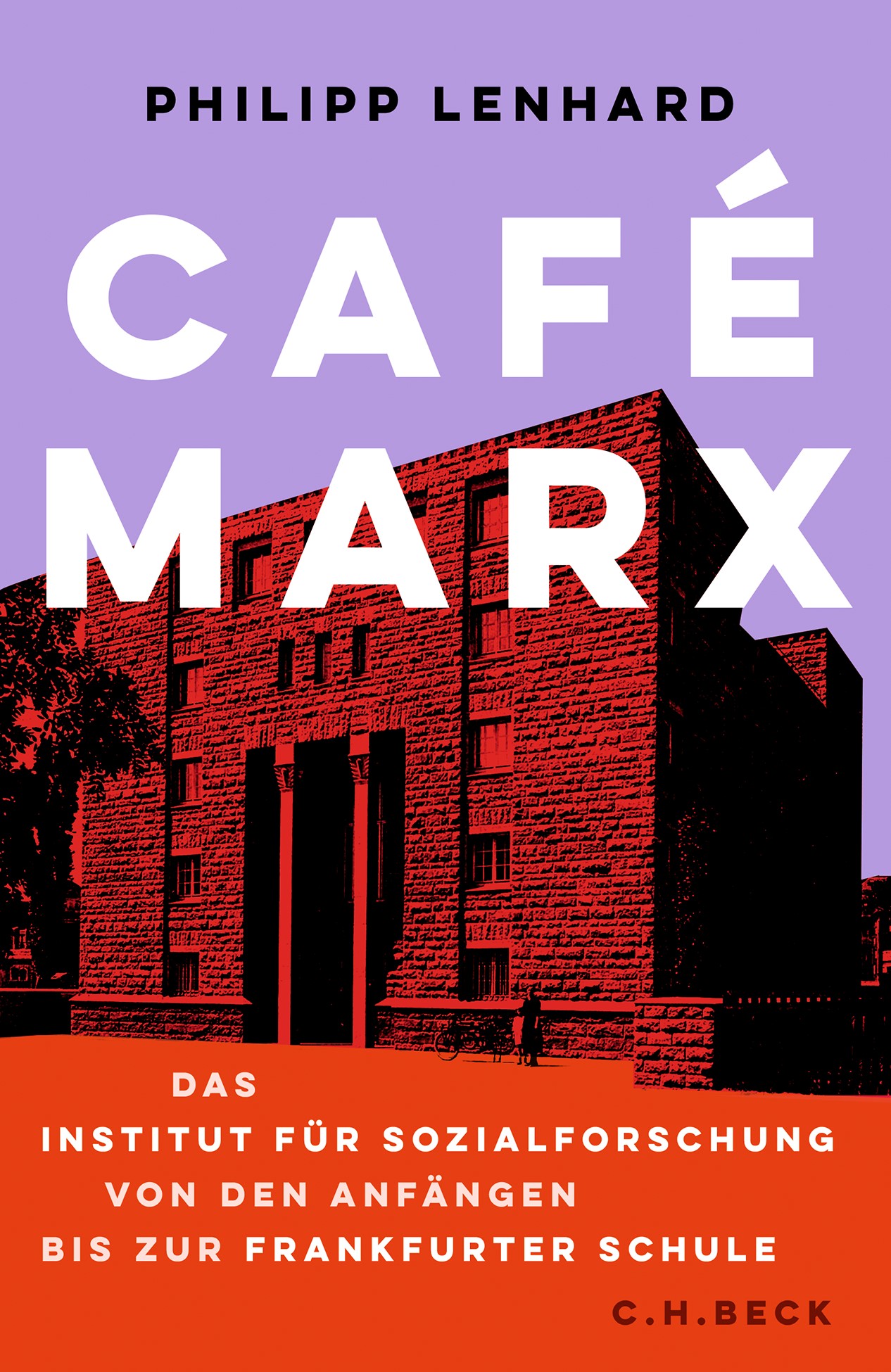Einer der programmatischsten Texte der Kritischen Theorie entstand in einem Moment höchster Ungewissheit. Max Horkheimers »Traditionelle und kritische Theorie« wurde 1937 im zweiten Heft der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht, als sich der Autor und das 1923 gegründete Institut bereits im Exil in New York befanden. Ob und wie das Institut weiter existieren würde, war keineswegs ausgemacht. Im Schatten dieser Ungewissheit griff Horkheimer in seinem Aufsatz nicht zufällig die Frage nach dem Weiterleben der Kritischen Theorie und den Bedingungen ihres »geschichtlichen Erfolg[es]« auf. Zum einen müsse die Theorie das »Interesse an einer Umwandlung« der Gesellschaft, das sich »mit der herrschenden Ungerechtigkeit notwendig reproduziert«, leiten und formen, während dieses Interesse zugleich auf die Theorie zurückwirke. Damit wird allerdings die zweite Bedingung, die Horkheimer nannte, durchaus problematisch, nämlich »die möglichst strenge Weitergabe der kritischen Theorie«. Bis zu ihrer »Bestätigung durch den Sieg«, so heißt es, wäre das der »Kampf um ihre richtige Fassung und Anwendung«.1
Diese Denkfigur, mit der Horkheimer programmatische Tradierung und historische Offenheit vermitteln möchte, affiziert in besonderem Maße die Geschichtsschreibung der Kritischen Theorie. Ideengeschichtliche Rekonstruktionen – man denke an Martin Jays Dialectical Imagination (1973) oder Rolf Wiggershaus Die Frankfurter Schule (1986) – sahen sich nicht selten der Kritik ausgesetzt, den ‚wahren Geist‘ der Kritischen Theorie verfehlt zu haben oder in unangemessener Weise akademisch, historisierend oder unparteisch zu verfahren. Dies ist nicht allein durch für Denkschulen typische Gralshüter-Streitigkeiten zu erklären. Vielmehr besteht eine zentrale Prämisse der Kritischen Theorie, wie Horkheimer ausführt, gerade darin, Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt als vermittelt zu begreifen. Muss also, so ließe sich zugespitzt fragen, eine Geschichtsschreibung der Kritischen Theorie, die ihrem Gegenstand gerecht werden möchte, selbst Kritische Theorie sein – und wenn ja, wie?
Die Studie Café Marx. Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule von dem derzeit in Berkeley lehrenden Historiker Philipp Lenhard ist der bis dato sicherlich umfassendste und materialreichste Versuch, die Kritische Theorie nicht nur als Ideenkonstellation, sondern auch als konkrete Praxis zur Darstellung zu bringen. Ganz dezidiert stellt er »das Institut« und sein Umfeld in der Zeit zwischen 1918 und 1973 in den Mittelpunkt des Interesses; ein letztes Kapitel widmet sich dem »Nachleben« der Kritischen Theorie von 1973 bis 2024. Damit ist der Gravitationspunkt letztlich eine Institutionen- und Netzwerkgeschichte, die allerdings auf der Überzeugung beruht – und darin ist sie der Kritischen Theorie nahe –, dass sich die Theorie von ihrer Praxis nicht ablösen lässt. Das meint freilich nicht nur dem marxistischen Sinne nach eine revolutionäre Praxis, aus deren Krise die Kritische Theorie hervorging, sondern um die Art und Weise, wie das Institut gegründet, geleitet, organisiert, gestaltet und finanziert wurde. So verstanden, gehörten zum Institut und seinem Umfeld weit mehr Personen als prominente und intensiv erforschte Denker wie Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse und Jürgen Habermas. Gerade den in der Geschichtsschreibung der Frankfurter Tradition häufig unterbelichtet oder ungenannt gebliebenen Figuren widmet Lenhard seine Aufmerksamkeit. Dies reicht von – im Kontext der Kritischen Theorie weniger bekannten – Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen wie Andries Sternheim und Helge Pross, über Studierende und Stipendiaten bis hin zu Angestellten der sogenannten Verwaltungsebene wie Juliette Favez, die als »Office Manager« die Außenstelle des Instituts in Genf leitete oder Max Horkheimers Sekretärin Margot von Mendelssohn. Mit großer Akribie rekonstruiert Lenhard die zentralen Werke und Ideen, die im Kontext der Kritischen Theorie entstanden sind sowie die theoretischen Differenzen, die es im Umfeld des Instituts gab. Vor allem erhellt der Autor, was auch von leidenschaftlichen Fans und Adepten zumeist ausgeklammert wird: In welcher wissenschaftlichen Arbeitsstruktur die kanonischen Texte entstanden, und was es in praktischer Hinsicht bedeutete, ein Institut im Exil zu führen und seine zahlreichen, verstreuten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Kräften zu unterstützen. (Dieses Desinteresse, dem Lenhards Buch entgegenwirkt, ließe sich durchaus auch gegenwärtig kritisch befragen, ermöglicht doch die Kritische Theorie eine Art ideellen Radikalismus, der mit dem Absehen von den eigenen Arbeits- und Produktionsbe-dingungen Hand in Hand gehen kann.) Außerdem zeigt das Buch – und auch das ignoriert eine allzu idealisierte Sicht auf die Kritische Theorie –, dass es sich beim Institut um einen Arbeitszusam-menhang handelte, in dem es wie in jedem Betrieb Streit, Hierarchien, Animositäten, Missgunst und Konkurrenzgebaren gab.
Das Leitmotiv, nach dem Lenhard die insgesamt 22 Kapitel strukturiert, ist das der »physischen und symbolischen Räume (…), in denen sich das Institut materialisiert hat« (8). »In der Bibliothek«, »Im Kaffeehaus«, »Im Büro« »Im Seminarraum«, so lauten einige der Kapitelüber-schriften, andere zielen darauf ab, eine dem Institut eigene Ortlosigkeit zu benennen, wie »Zwischen Atlantik und Pazifik«, »Zwischen den Ruinen« oder »Unter Beobachtung«. Jedes Kapitel beginnt mit einer »literarisch gestaltetet[en]« (10) Eröffnungsszene, in denen Lenhard sich bisweilen etwas zu hineinfühlend in die jeweilige Situation begibt. Auch an einigen anderen Stellen rückt der Autor seinem Gegenstand eigentümlich nahe: Adornos »[w]ache braune Augen strahlten vor Lebendigkeit und Neugier« (175), an anderer Stelle heißt es ebenfalls über Adorno, er wolle seiner Frau Gretel Karplus »ständig beweisen, dass er einzigartig und besser war als alle anderen« (187), und Hermann Weil hatte es den »Spöttern von einst gezeigt, da war er sich sicher« (17).
Derartige Passagen fallen umso mehr auf, als der überwiegende Gestus einer der entmystifizierenden Sachlichkeit ist. Dabei vermeidet der Autor das gängige Narrativ, eine ‚frühe‘ Kritische Theorie gegen eine ‚späte‘, ‚pessimistisch‘ gewordene auszuspielen. Insbesondere die Bedeutung des Antisemitismus für die Gesellschaftstheorie stellt Lenhard heraus. Die »Negativität der Kritischen Theorie, die sich aus dem Schock über das Grauen des Ersten Weltkriegs über die Erfahrung des Stalinismus bis hin zu Nationalsozialismus und Holocaust an der historischen Wirklichkeit gebildet hatte« (533) und die sich im Beharren auf dem Marx’schen wie dem Adorno’schen kategorischen Imperativ äußert, ist für Lenhard nach wie vor aktuell. So sehr dem zuzustimmen ist, wäre aber zu fragen, ob der richtige Hinweis auf Unabgegoltenes und das Konstatieren von Veränderungen bereits die »möglichst strenge Weitergabe« im Sinne Horkheimers darstellt, ob sie dasselbe ist wie eine historische Reflexion auf das Verschwin-dende, als die sich die Kritische Theorie beschreiben lässt. So gibt es zum einen in Lenhards zweifellos lesenswertem Buch immer wieder Momente, in denen es sich angeboten hätte, die beschriebenen Prozesse einer Deutung zweiter Ordnung zu unterziehen und die Kritische Theorie gewissermaßen auf sich zurückzuwenden. Etwa, wenn Lenhard die vielfach vergessenen Frauen am und im Umfeld des Instituts hervorhebt und in diesem Zusammenhang den historisch noch einigermaßen neuen Beruf der Bibliothekarin diskutiert. So arbeiteten u.a. Christiane Sorge (die Ehefrau von Richard Sorge), Rose Wittfogel (die Ehefrau von Karl August Wittfogel) und Elisabeth Ehrenreich (die spätere Ehefrau Siegried Kracauers) vor dem Zweiten Weltkrieg in der Bibliothek des Frankfurter Instituts, das in seiner Einstellungs-politik damit durchaus fortschrittlich war. Der Beruf der Bibliothekarin – Lenhard kritisiert die bis heute andauernde Geringschätzung des Bibliothekarswesens zu Recht (110) – steht dabei im Kontext nicht nur des zunehmenden Eintritts von Frauen mit Hochschulabschluss in den Universitätsbetrieb, sondern ist auch ein Beispiel für die Entstehung des Typus des Angestellten. Dieser wird allerdings erst der chronologischen Reihung und räumlichen Differenzierung entsprechend mehrere Kapitel später diskutiert. Der spezifische Charakter der Figur der Bibliothekarin, die, um das Wissen zu verwalten, eine Art des Sachwissens haben muss, die dem, der die Bücher ausleiht, nicht eigen ist – Ähnliches diskutiert Adorno in dem Aufsatz »Kultur und Verwaltung« (1960) –, das Verhältnis zwischen ökonomisch-politisch ermöglichter Emanzipation und sich wandelnden Herrschaftsverhält-nissen, sowie die Implikationen für den im Institut materialisierten Begriff von Arbeitsteilung hätten sich gerade mit den Mitteln der Kritischen Theorie paradigmatisch herausarbeiten lassen. Von einer solchen Rückwendung aus, die nicht nur benennt, was zu retten wäre, sondern auch, was vielleicht verschwunden ist, ließe sich auch stärker ermessen, was in Lenhards Studie aufgrund ihrer Anlage – 18 der 22 Kapitel beschäftigen sich mit der Zeit bis 1949 – verhältnismäßig wenig Raum einnehmen kann: die Differenzen zwischen Kritischer Theorie und Frankfurter Schule (und mit Blick auf die Gegenwart: Critical Theory als deutlich weiter gefasstem Lehnbegriff) sowohl im Hinblick auf die Theorie, als auch auf die wissenschaftliche, kritische und publizistische Praxis, kurz: zwischen moderner, bürgerlicher und spätmoderner, postbürgerlicher Erfahrung.
Das Buch
Philipp Lenhard: Café Marx. Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule, C.H. Beck Verlag, München 2024, Gebunden, 624 Seiten, 34 EUR