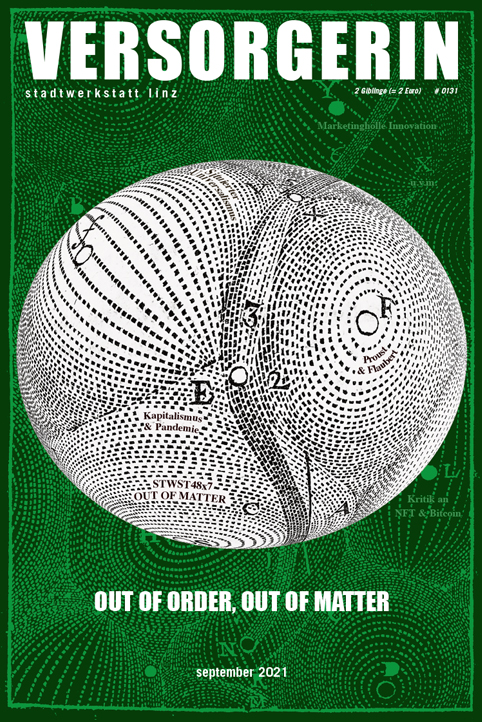Walter Benjamin überlieferte die Beobachtung, dass der Begriff des Fortschritts sich einzig in der Idee der Katastrophe begründe: »Dass es ‚so weiter‘ geht, ist die Katastrophe«. Es sei die ewige Wiederkehr des sich fortschrittlich gebärdenden Unheils, bei dem keiner mehr frage, was denn da als Fortschritt akzeptiert wird; und ob das, was im Sinne des Gegebenen da sei, gleich als ein Positives bejahrt werden müsse. Wollte man jene erkenntnistheoretische Einsicht in literarischer Form verwirklicht sehen, kämen wohl die zögernden Sonderlinge in Markus Werners insgesamt sieben Romanen infrage.
Werners Romane erzählen von Menschen in der Krise, verzweifelten Denkern, enttäuschten Linken und stummen Rebellen, die dem Ruf des falschen Bewusstseins in einer falsch eingerichteten Welt zu widerstehen versuchen und sich den immer dreisteren Zumutungen des tristen Alltags so ausgeliefert fühlen, dass sie als die einzig Normalen erscheinen. Hohn, Präpotenz und Vulgarität findet man bei Werner gleichwohl kaum, der öffentlichkeitsscheue Romancier legte Wert auf Manieren. Sein erster Roman »Zündels Abgang« von 1984 wurde Gerüchten zufolge fast schon in geheimbündlerischer Manier besprochen: Da sei etwas, was uns alle betreffe, aber nur die Wenigsten verstünden.
Bis heute ist Markus Werner ein Autor der Wenigen geblieben. Obwohl er von Marcel Reich-Ranicki als einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner Zeit geadelt wurde, sind seine Romane einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt. Das mag auch daran liegen, dass die begabteren Schweizer Literaten wie Hermann Burger oder Franz Böni schon immer einen Hang zur Abschottung hatten. Nicht der geringste Anlass, Markus Werner aus dem Vergessen zu holen, ist seine widersprüchlich anmutende Fähigkeit, ohne Larmoyanz zu jammern. Zu einer Kritik, die ob ihrer Dringlichkeit nicht zum Selbstzweck avanciert, wie etwa bei Thomas Bernhard, der weder die Versöhnung noch die Liebe kennt, sich aber einen ungeschönten Blick auf die Verhältnisse bewahrte. Werners Figuren hingegen stehen emblematisch für das sympathische Gegenteil der allgegenwärtigen Haltungsgesellschaft: keine Position, nur eine negative, an der alles ohne Selbstzweck abprallt. Man könnte sie auch als nivelliertes Dandytum bezeichnen, an dem Oscar Wilde seine Freude gehabt hätte. Seine forschen Anklagen drücken sich aus in dem Wunsch nach einer besser eingerichteten Welt, nach mehr Schönheit, Tiefsinn und Freundlichkeit. Sein Werk ist ein Lob der Genüsse fernab der psychischen Aufmöbelungsindustrie. Leistung verwehren in Werners Romanen am ehesten noch jene, die sich angesichts der Wahl zwischen Karriere, Promiskuität oder Weltverbesserungs-Protesten für den Gang ins Kino, in die örtliche Kneipe oder einen Roman entscheiden, für eine Konsum-Sphäre also, in der sich so etwas wie ein Geschmacksurteil noch bilden kann. Vor allem aber fürchten Werners Figuren den tumben Sound des vermeintlichen Fortschritts, den Abgesang auf die romantische Hingabe zugunsten einer Unternehmerphilosophie, die Verrat an spontaner Sinnlichkeit und am Glück verübt hat.
Der Altphilologe Felix Bendel, einer der beiden Hauptcharaktere in Markus Werners jüngstem und erfolgreichstem Roman »Am Hang«, ist solch ein Zerrissener der Moderne. Er ist dem Leben so entrückt, dass sich schon die kleinsten Tücken des Alltags in unerträgliche Zumutungen verwandeln. Während er nur dem Anschein nach einer romantisch verklärten Nostalgie nachhängt und bisweilen als frühvergreister Kauz mit einem Faible für tote Sprachen auftritt, teilt sein Widersacher, der pragmatische Scheidungsanwalt und Junggeselle Thomas Clarin, die Liebe in ebenso rationalisierte wie liberalisierte Kategorien ein. Sein expertentümlerisches Gerede über »Anforderungs-profile«, »Beziehungsinvestitionen« und ältere Frauen, die in der Sexualität eine »optimale Genussreife« erreicht hätten, verursacht bei Bendel eine allergische Reaktion in Form eines Hautausschlages.
Wie in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften treffen bei Markus Werner schroff widersprüchliche Erfahrungen und Weltanschauungen aufeinander. Da ist der sehr moderne Ulrich, dessen Cousine Diotima wie Bendel in Erinnerungen an die Werte der »alten« Welt schwelgt, während es für Ulrich im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert kaum etwas zu geben scheint, das verheißungsvoll über den Dingen schwebt. Mit Clarin entwarf Werner einen Sozialcharakter, der Ulrichs skeptische Weltgewandtheit in das heutige »smarte« Ich überführt.
Clarin wird dabei die Rolle der blendenden Charaktermaske zuteil, die ihre zeitgeisttypischen Züge durch ein besonders individualistisches und hedonistisches Profil überdecken will. Seine Idee von sexueller Freiheit unterliegt einer Konsumlogik: immer neu, immer spannend. Ganz so einfach macht es sich Werner mit der Persiflage auf Clarin als egozentrischen Schürzenjäger jedoch nicht, denn dieser ist redegewandt und lebenslustig, erfolgreich im Beruf und bei den Frauen, aber gerade deshalb einsam. Seine »Partnerschaften auf Zeit« verkümmern zu »Netzwerken«, deren Zweckmäßigkeit sich darin erschöpft, tieferen Beziehungen mittels eines schier unerschöpflichen »Pools an Kontaktmöglichkeiten« aus dem Weg zu gehen. Kaum zufällig materialisiert sich in seiner Art zu sprechen eine Art Chiffre für navigationstüchtige Digitalisierungsgewinnler. Intellektuell flach wirkt Clarin gleichwohl nicht, vielmehr fungiert er als narzisstisch deformierter Spiegel einer entfremdeten Marketing-Persönlichkeit, die nur noch bestimmten Automatismen unterliegt.
Bendel steht dem als gnadenloser Kritiker, lebenskluger Beobachter und bisweilen auch ulkiger Eigenbrötler und Moralist entgegen, so wie die meisten Figuren in Werners Büchern charismatische, aber verstockte Anti-Helden mit einem Hang zur Schwermut sind. Bewahrte für Bendel die Ausschließlichkeit der romantischen Liebe noch die Hypostase an ein besonderes Gegenüber, das sich dem Tauschprinzip verwehrt, deutet Clarin seine flüchtigen Affären zum höchsten Gebot der großen Freiheiten und Authentizitäten um. Nun könnte man so viel moralischen Übereifer auch als pädagogische Erziehungsmaßnahme missverstehen, doch dafür sind die Protagonisten zu zerrissen und in Selbsttäuschung geschult. Sie werden vielmehr von einer Sehnsucht getrieben, die sie selbst nicht ganz verstehen.
So lässt Bendel gegenüber seinem einzigen Gesprächspartner Clarin verlauten, dass Nostalgie sich trotz allem verbiete. Das Handy stoße ihn zwar ungemein ab, weil es »die Liquidierung des Privaten und Intimen betreibt und nebenbei den Weltlärmpegel erhöht«, aber viel schlimmer sei doch, dass anfängliche Kritiker der immer mobileren Welt irgendwann dem Strom der Anpassung folgen. Je mehr der Strom anschwillt, je närrischer und diktatorischer er sich gebärdet, umso mehr fallen um und hinein, und er stehe allein am Ufer und beobachtet, wie seine einstigen »Weggefährten zu Schmieröllieferanten jenes Rades wurden, dem sie einst in die Speichen greifen wollten«. Nun würden sie dem vorherrschenden Weltungeist, den sie damals noch zurecht als menschenverachtend empfanden, zum Durchbruch verhelfen: allerdings mithilfe eines humanen Anstriches, der Liberalismus mit Gleichgültigkeit verwechsle.
Werners Figuren sind einer Welt ausgesetzt, die sie immerhin noch ein bisschen besser verstehen als die Mikroidioten und Fachmanager, die von ihr hervorgespült werden. Wank, der Held seines dritten Romans »Die kalte Schulter«, begegnet während eines Friedhof-Spaziergangs einem androgynen Wesen, das er zunächst als einen wie aus der Zeit gefallenen »Wald- und Futterkrippenmensch« beschreibt, später aber aufgrund seines zarten Lächelns als Frau erkennt. Die beiden kommen bei einer gemeinsamen Zigarette ins Gespräch, weil Wank dem sonderbaren Wesen ein Zündholz statt einem Feuerzeug reicht: »Wie schön, daß Sie Zündhölzer verwenden, man darf auch bei Winzigkeiten nicht dumm sein«, sagt der Waldmensch und erklärt ihm sodann das Vico-Prinzip, welches besagt, dass der Mensch nur das versteht, was er selbst machen kann: »Wir aber sind, im Gegensatz zu unseren Vorfahren, förmlich umzingelt von Gegenständen, die wir weder selber machen können, die wir also nicht verstehen. […] Der Rückzug auf das Unvermögen, die Dinge zu verstehen, belässt die Welt beim Alten.«
Nun kann man, wie es die »Sendung mit der Maus« lange Zeit pflegte, einem Kind, das nicht in der Lage ist, einen bestimmten Gegenstand zu bedienen, die Bau- und Funktionsweise eines Plattenspielers oder eines Öllämpchens erklären, aber wie ein Smartphone funktioniert, verstehen auch die Erwachsenen nicht.
Einem Literaturmarkt, der sich von schriftstellernden Personality-Managern wie Ronja von Rönne und ihrem Diversitäts-Äquivalent Hengameh Yaghoobifarah betören lässt, hat Werner nichts zu sagen. Er lebte bis zu seinem Tod im Juli 2016 zurückgezogen in einem abgelegenen Häuschen bei »Schaffhausen«. Seine Romane schrieb er alle mit der Hand. Neben seinem Telefon hängt ein Zettel mit Bartlebys Credo »I would prefer not to«. Googelt man ihn, schaut er einen zögernd an, sein Blick ist gleichermaßen von Verzweiflung, Wärme und Zartheit durchdrungen. Er raucht und trinkt am liebsten Rotwein. Ein klassischer Schriftsteller eben. Mehr erfährt man über ihn nicht, einzig der Züricher Literaturkritiker Martin Ebel machte sich unter dem schönen Titel »Allein das Zögern ist human« daran, Werners Prosa, Essays, Reden und Interviews zu sammeln, um sie der breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Einen ungelenken Satz findet man dort nicht. Markus Werner, der mit einer Arbeit über Max Frisch promovierte, war nicht nur hinsichtlich seiner Spracheleganz ein Ästhet, sondern auch ein unterhaltsamer und lebensweiser Beobachter. Mit ungleich mehr Humor als Witz führte er uns den herrschenden Geist unserer Zeit vor.
Allein das Zögern ist human
Sara Rukaj über den im Juli 2016 verstorbenen Schweizer Romancier Markus Werner.