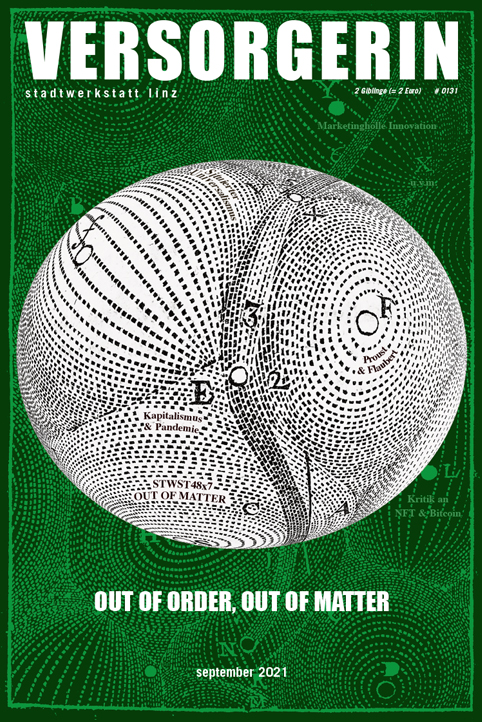Seit Jahrzehnten steht der Universalismus auch von progressiver Seite in der Kritik. Warum?
Nora Sternfeld: Zwei Aspekte des Begriffes »Universalismus« wurden in den letzten sechzig Jahren in Grund und Boden kritisiert. Der erste betrifft ein wissenschaftstheoretisches bzw. erkenntnistheoretisches Problem. Hier ging es darum, die Vorstellung einer universellen Geltung von Wahrheit aufzubrechen: ihren enthistorisierenden Charakter, der jegliche Spezifität aus dem Blickfeld verdrängt. Michel Foucault schreibt in seinem gesamten Werk gegen diesen Universalismus an. Der Vorstellung eines/r »universellen Intellektuellen« stellt er jene des/r »spezifischen Intellektuellen« gegenüber – also eines konkreten, in spezifischen Kontexten reflektierenden und intervenierenden Denkens.
Der zweite Aspekt betrifft die universelle Geltung von Rechten. Mit der Erklärung der Menschenrechte und den Idealen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gibt das ausgehende 18. Jahrhundert – mit der Französischen Revolution, die zugleich die Revolution in Haiti als Kampf um Unabhängigkeit und Befreiung von der Sklaverei war – wesentlich vor, was wir heute unter Universalismus verstehen. Doch es stellte sich immer die Frage: Wer war gleich, und wer blieb und bleibt bis heute von der Gleichheit ausgeschlossen?
Was genau waren bzw. sind die Kritikpunkte und von wem wurden sie vorgebracht?
Von postkolonialer und feministischer Seite wurde der »Universalismus« massiv kritisiert und als weißer, westlicher Partikularismus entlarvt. Infrage gestellt wurde, dass eben nur manche »alle« waren (und sind) und andere nicht, dass zwar von »universellen Rechten« die Rede sei, tatsächlich aber eine westliche und männliche Perspektive als universell angenommen werde. Weiters wurde der Universalismus als missionarische und koloniale Gewaltherrschaft kritisiert, dessen Verallgemein-erungen nichts anderes als polizeiliche Unterdrückungs- und Anpassungstechniken waren. Denn wenn eben manche im scheinbaren Universalismus mehr wert sind als andere, dann wird der Universalismus zur Unterwerfungstechnik, die Sprachformen, Gewohnheiten, Religionen, Alltagspraktiken alle einem weißen, bürgerlichen, christlichen Normensystem unterordnet.
Ein dritter Kritikpunkt war jener an der paternalistischen Funktion des Universalismus, da seine Logik der StellvertreterInnenpolitik ohnmächtige Objekte produziere und nicht selten gerade die Sichtbarkeit politischer Kämpfe verhindere. So wurde sehr lange unter dem Label des Universalismus »für Andere« gesprochen, während es keine Mechanismen und Bühnen eines Sprechens der Gleichheit gab. Dabei wurden aber »Andere« erst produziert, in deren Namen wiederum sehr oft weiße, westliche, jedenfalls machtvolle Positionen sich selbst reproduzieren konnten. In einem vierten Punkt musste sich das Konzept des Universalismus eine weitere Infragestellung gefallen lassen: die Rhetorik der Verdeckung realer, existierender Ungleichheiten, wie sie sich etwa im Phantasma »Alle haben die gleichen Chancen« bis heute ausdrückt. »Es ist den Armen wie den Reichen gleichermaßen verboten, in Paris unter den Brücken zu schlafen«, lautete bereits in der Zeit der Französischen Revolution ein ironischer Kommentar über die ideologische Funktion des Gleichheitspostulats: Wenn Ungleiches gleich behandelt wird, entsteht Ungerechtigkeit.
Aus allen diesen Gründen fand sich der Universalismus als diskreditiert wieder. Gerade gegen die Herrschafts-techniken eines verkürzten, vereinnahmenden und ausschließenden Universalismus schien es notwendig, sich aus marginalisierten Perspektiven der Strategie der Identitätspolitik zu bedienen. Die Ausschlüsse und Ungleichheiten erforderten Bewusstseinsbildung und partikulare Positionen und Politiken, die sich eben ins Universale hinein reklamierten. Nichtsdestotrotz ist es das Konzept der »Gleichheit«, in dessen Namen und vor dessen Horizont marginalisierte Positionen immer wieder ihre Rechte einfordern, eben: »Gleiche Rechte für alle!«
Mit dem Ruf nach »Gleichheit« beginnt aber natürlich nicht die Gleichheit.
In der Tat. Doch der Anfang, der hier markiert wird, ist vielmehr ein Anfang der Kämpfe um Gleichheit: ein Reklamierungsmodell gegen die produzierte Ungleichheit. In gewisser Weise hatte der Universalismus der Menschenrechte von Anfang an zwei Seiten: Einerseits beginnt mit der Idee der Gleichheit, die eben nur für einen Teil der Gesellschaft gilt, eine völlig neue Dimension der Ungleichheit: Standen in den feudalen Strukturen alle an ihrem Platz, so findet die Ungleichheit nun unter den Bedingungen der Gleichheit statt (denn der Humanismus hatte jene Struktur produziert, die den »Anderen« die Menschlichkeit verwehrte).
Dies ist vielleicht einer der Gründe, wieso die Debatten um die Rechte der Schwarzen in der französischen Nationalversammlung so heftig ausfielen. Denn dort stand eben die Frage auf dem Spiel, für wen die Menschenrechte Geltung haben sollten und für wen nicht (wer also kein Mensch war). Wer war Mensch und wer war Eigentum? Darüber stritt die Generalversammlung. Hier ist die ganze Gewalt des Humanismus und Universalis-mus auf den Punkt gebracht. Andererseits ist die Idee der Gleichheit, einmal ausgesprochen, als Horizont nicht mehr aufzuhalten. Sie markiert die Möglichkeit, Gleichheit zu reklamieren. Doch diese Reklamation konnte weder im Fall der Frauen oder der ArbeiterInnen noch im Fall der Schwarzen im Parlament entschieden werden. Gleichheit konnte in allen diesen Fällen daher nur durch reale Kämpfe beansprucht werden.
Was bedeutet das für Ihr Nachdenken über den Universalismus, auch für das Verhältnis zwischen Universalismus und Partikularismus?
Vor dem Hintergrund der Hegemonietheorie Ernesto Laclaus stellt sich die Frage nach dem Universalismus neu. Laclau formuliert die Differenz zwischen Universalismus und Partikularismus als eine Spannung, die zu keiner der beiden Seiten hin aufgelöst werden kann. Er weist in diesem Sinne puren Partikularismus zurück und adressiert die Notwendigkeit einer Universalität, die allerdings eine radikale Neudefinition erfährt.
So stellt er fest, dass »das Universelle nichts anderes ist, als ein zu einem bestimmten Zeitpunkt dominant gewordenes Partikulares.«
Indem die Hegemonietheorie Laclaus darauf verweist, dass es keinen Ort der Gesellschaft gibt, von dem aus sie als Ganzes begründbar, als Totalität fassbar wäre, bleibt der Ort, an dem die Universalität begründet wäre, ebenso leer wie umkämpft. Universalität bleibt als Dimension erhalten, ohne dass sie je von einem Partikularismus ausgefüllt werden könnte. Sie ist die Leerstelle, die Politik ermöglicht. Das Universelle wird so zum »unvollständigen Horizont« der partikularen Kämpfe, ebenso unmöglich wie ermöglichend. Aus der Perspektive Laclaus muss sich jeder Partikularismus, wenn er auf Hegemonie zielt, für seine Kämpfe dieses universalistischen Horizonts bedienen.
Welche Bedeutung kommt in diesem Prozess der Universalisierung dem Imaginären, dem Utopischen zu?
Befreiung ist ein Akt, der zwei Seiten hat. Eine Seite ist immer von den Bedingungen definiert, von denen sie sich befreit. Und die andere Seite ist die utopische Dimension, die der Befreiung innewohnt. Die eine Seite ist also immer partikular, wir befreien uns als die, zu denen wir gemacht wurden. Die andere Seite ist universalistisch, sie öffnet den Horizont der Freiheit. Und wer will sich schon partikular in einer utopischen Zukunft wiederfinden? Unter Universalisierung möchte ich mit Jacques Rancière und Ernesto Laclau den Moment der Ausweitung dessen verstehen, was wir unter »Alle« verstehen, also den Moment, den Rancière in seinem Buch »das Unvernehmen« Politik nennt, wenn der Teil ohne Anteil seinen Anteil einfordert, den Moment also, wenn sich die Teilung ändert.
Und wenn genau diese Universalisierung stattfindet, geschieht eben zweierlei: Der Teil ohne Anteil definiert sich als Teil ohne Anteil, um seinen Anteil einzufordern. Aber dabei geschieht eben etwas mit dem Teil und dem Ganzen. Das ist das utopische Moment. Ein Handeln, mit den Worten von Cornel West »im Licht dessen, was noch nicht ist.« Universalismus ist also Erweiterung des Horizonts von »allen«. Mit jeder Erweiterung dieses Horizonts wird wieder aufs Neue seine Erweiter-barkeit klar, dass »alle« eben umkämpft ist und bleiben muss, dass es ein Skandal ist, dass wir »alle« sagen, aber dabei nur manche meinen. Ein Skandal, der immer wieder und immer neu aufs Tapet gebracht werden muss, ein Horizont, der verändert, erweitert werden muss.
Darüber hinaus wird mit jeder Universalisierung durch die partikulare Befreiung performativ eine weitere Universalisierung möglich. »Und dürfen wir nun für andere sprechen?« Diese Frage stellte mir ein Journalist im Herbst 2019 bei einer Diskussion mit dem Titel »Beiträge zur dekolonialen Kritik« in den Berliner Sophiensälen. Was ich damals antworten hätte sollen: Nein, aber wir dürfen im Namen der Ausweitung des Horizonts und im Hinblick darauf mit anderen daran arbeiten. Wir können gemeinsam dem, was ist, widersprechen, verändern und verändert werden und im Lichte dessen handeln, was noch nicht ist. Genau das meine ich mit dem Begriff des situierten Universalismus: Es gibt nur eine partikulare Befreiung, nur eine aus der konkreten, spezifischen Position aus der es sich zu befreien gilt. Aber die Freiheit, in die sie sich befreit, hat eine universalistische, visionäre Dimension.
Leerstelle Universalität
Till Schmidt hat sich mit der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nora Sternfeld über verschiedene Kritikpunkte an universalistischen Ansätzen und ihren Begriff des »situierten Universalismus« unterhalten.