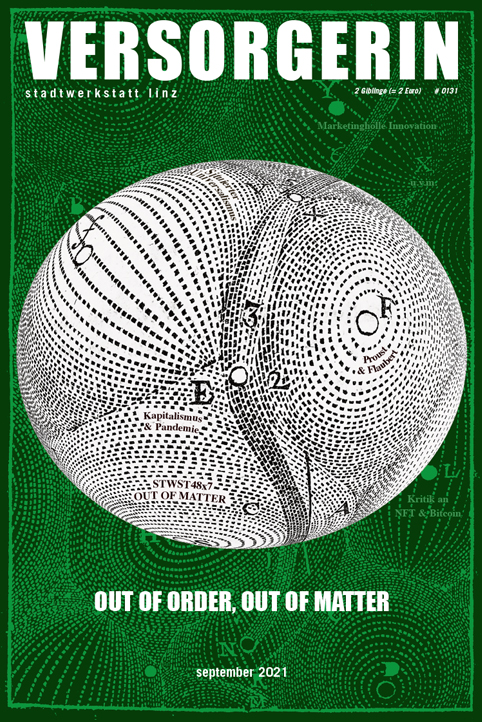Der von der Kulturwissenschaftlerin Christine Holste und dem Soziologen Richard Faber herausgegebene Band »Vom jüdischen Bilderverbot zur Gründung israelischer Kunstgeschichte« dokumentiert in überarbeiteter Form Vorträge einer Tagung des Centrums für Religionswissen-schaftliche Studien (CERES) an der Ruhr-Universität Bochum aus dem Jahr 2017. Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert, die sich mit Baraschs Kindheit und Jugend in Czernowitz beschäftigen, seiner kunsthistorischen Auseinandersetzung mit der jüdischen und griechisch-römischen Antike einerseits, sowie dem christlichen, humanistischen und säkularen Europa andererseits und versammelt abschließend einige persönliche Erinnerungen an Moshe Barasch. Zusätzlich sind noch zwei Aufsätze von Moshe Barasch selbst (»Wissensvermittlung durch Bilder« und »Antike und klassische Moderne. Über Pablo Picasso«) angefügt. Mit dieser Gliederung kommen Holste und Faber sowohl einer chronologisch informierten Struktur entgegen (am Beginn Texte zu Baraschs Zeit in Czernowitz und am Ende Erinnerungen an Begegnungen mit ihm), als auch einer thematisch gebündelten (anhand seiner beiden wichtigsten Forschungsschwerpunkte). Da der Band keine eigene Kurzbiographie enthält (obwohl sich nach Lektüre der Texte ein recht umfassendes Bild von Baraschs Leben ergibt) und der Kunsthistoriker und Maler hierzulande kaum bekannt sein dürfte, seien an dieser Stelle einige Angaben zu seinem Leben gemacht.[1]
Von Czernowitz nach En Charod
Bereits als 13-Jähriger bestritt der gebürtige Czernowitzer Moshe Barasch seine erste Ausstellung mit expressionistischen Bildern und zwei Jahre später veröffentlichte er sein erstes Buch »Des Glaubens schwere Wege«. In den 1930er Jahren bereiste er Europa, um sowohl Kunstmuseen und -bibliotheken zu besuchen, als auch Kunst zu studieren – dies aber weniger über die entsprechenden akademischen Einrichtungen, als im Austausch mit Spezialisten, die er gezielt aufsuchte. 19-jährig kehrte Barasch nach Czernowitz zurück, wo es noch eine größere jüdische Gemeinschaft gab, die aber mit stärker werdenden antisemitischen Anfeindungen konfrontiert war.[2] Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Errichtung des Czernowitzer Ghettos schloß er sich dort dem Widerstand an und war sowohl für die Hagana[3], als auch die Bricha[4] aktiv. Berichten zufolge nutzte er sein künstlerisches Talent, um hunderte Stempel und Genehmigungen herzustellen, die Jüdinnen und Juden halfen, Rumänien zu verlassen. Nachdem dies bekannt wurde, musste er selbst fliehen – zunächst 1945 nach Italien, wo er weiterhin für die Hagana tätig war und 1948 emigrierte er schließlich nach Israel, wo er als ausländischer Rekrut in der Eliteeinheit Palmanach diente und nach Ende seines Dienstes zu seiner Ehefrau ins Kibbutz En Charod zog, wo er begann, Kunst- und Kulturgeschichte zu unterrichten.
Kunstgeschichte in Israel
1956 lud die Hebrew University in Jerusalem Moshe Barasch ein, einen Kurs in Kunstgeschichte abzuhalten und in weiterer Folge, dort – und damit zugleich erstmalig in Israel – Kunstgeschichte als akademische Disziplin zu etablieren. Die gesamte Infrastruktur musste dementsprechend erst aufgebaut werden – vom Studienplan über eine Kunstbibliothek, bis hin zu den Unterrichtsmaterialien. 1958 konnte er – »unterstützt vor allem durch seine philosophischen Lehrer Hugo Bergmann und Martin Buber« (S.11) – erste Vorlesungen am neu eingerichteten kunsthistorischen Lehrstuhl halten. Baraschs Pionierarbeit in dieser Richtung ist zu verdanken, dass es heute an mehreren israelischen Universitäten Kunstgeschichte-Abteilungen gibt. Während dieser Jahre publizierte er auch Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften (bis zum Ende seines Lebens werden es über 200 gewesen sein) und auch Bücher – vor allem zu seinem Spezialgebiet: Der Kunst in Renaissance und Barock. Er beschäftigte sich aber auch mit anderen Epochen, etwa der Kunst in der jüdisch-griechisch-römischen Antike und der des frühen Christentums bis hin zum Mittelalter. Sein theoretischer Fokus galt dabei unter anderem dem Verhältnis von Wort und Bild, den Besonderheiten künstlerischer Ausdrucksformen im Rahmen religiöser Malerei, aber auch der Bedeutung von Gestik und Gesichtsausdrücken. Zwischen 1993 und 2000 wirkte er am Aufbau eines Zentrums an der Bar Ilan Universität für den Religionsphilosophen Jacob Taubes mit, einem Freund aus seiner Zeit in Jerusalem, der 1987 verstorben war. 1996 wurde ihm für seine Leistungen auf dem Gebiet der Kunstgeschichte der Israel-Preis (die höchste Kulturauszeichnung des Staates Israel) verliehen.
Wanderwege der Ideen
Der Titel »Vom Jüdischen Bilderverbot zur Gründung israelischer Kunstgeschichte« ist insofern sehr gut gewählt, als damit nicht nur Moshe Baraschs professionelle Entwicklung reflektiert ist, sondern an seiner Person auch die gesellschaftliche Dimension einer »Transformation eines religiösen Verständnisses von Judentum hin zu einem kulturellen« (S.39) verdeutlicht wird. Vordergründig scheint das Bilderverbot Anathema einer Disziplin zu sein, deren Gegenstand die Erforschung von Inhalten und Symboliken bildlicher Darstellungen – gerade auch in religiös geprägten Kunstwerken – ist. Zugleich ist festzuhalten, dass auch der Versuch, das Nicht-Darstellbare darzustellen, das Unsichtbare mit den jeweiligen künstlerischen Mitteln auszudeuten, eine vornehmliche Triebfeder von Kunst war und ist. Den Weg, der Mosche Barasch zur Auseinandersetzung mit den Spezifika jüdischer Kunst geführt hat, zeichnet Christine Holste in ihrem Beitrag »Reichtum an Gedanken und Bildern.« Das Czernowitzer »Wunderkind« Moses Barasch begegnet der jüdischen Renaissance nach, der hier exemplarisch herausgegriffen sei. Als zentral erachtet Holste Moshe Baraschs Kontakt mit der »Jüdischen Renaissance«, einer innerjüdischen Reformrichtung, die der Philosoph Martin Buber auch »als Antwort auf die Wagner‘sche Polemik gegen die vermeintliche ‚Kunstunfähigkeit der Juden‘» (S.41f.) begriff. Martin Buber war (zusammen mit dem Schriftsteller Achad Ha‘am) nicht nur engagierter Vertreter dieser kulturzionistischen Strömung,[5] sondern auch ein lebenslanger Freund Moshe Baraschs. Neben den Kunstmetropolen Paris, Berlin und Wien gab es nach dem ersten Weltkrieg auch in der Bukowina, bzw. dem neu geschaffenen rumänischen Staat, kulturzionistische Initiativen, die eine Förderung der visuellen Künste zum Ziel hatten. Darum wurde auch der Politiker und Publizist Dr. Mayer Ebner (ein früherer Mitstreiter Theodor Herzls) 1930 auf den hochbegabten Mosche Barasch aufmerksam. Czernowitz war zu dieser Zeit reich an Talenten – bezeichnend für den damaligen hohen Stellenwert der bildenden Künste ist, dass die öffentliche Aufmerksamkeit dem zehnjährigen Maler Barasch galt, nicht aber dessen gleichaltrigem Freund Paul Antschel (der später als Lyriker unter dem Namen Paul Celan bekannt wurde). Auch die einige Jahre ältere Rose Ausländer (die zu dieser Zeit nach mehrjährigem Aufenthalt in den USA wieder in Czernowitz lebte und dort Gedichte und Aufsätze veröffentlichte) war in ihrer Heimatstadt kaum bekannt. Dieser Fokus auf die Malerei kontrastiert in gewissem Sinne mit der traditionellen chassidischen Welt, mit der Mosche Barsch über seine Familie in Kontakt kam:
»Noch 1988 berichtete er, dass im orthodoxen Haus seines Großvaters als Wanddekoration ein Mikroskript des Jerusalemer Tempelbergs hing, ein Hinweis darauf, dass die Beachtung des Bilderverbots, welches durch diese künstlerische Technik aus dem jüdischen Buchdruck respektiert
und zugleich eingeschränkt wurde, in strenggläubigen Kreisen der Bukowina noch üblich war. Selbst die Eltern des jungen Künstlers sollten noch keine illustrierten Bücher besessen haben.« (S.45)
Die Besonderheit jüdischer Bildproduktion begegnete dem junge Moshe Barasch auch auf dem alten jüdischen Friedhof in Czernowitz: Hier widmete er seine Aufmerksamkeit weniger dem gemeißelten Bild, als der »Priorität der Schrift gegenüber dem Bild, aus der sich Aufbau und Bedeutungsgehalt der vielgestaltigen Symbolik erst erschließt.« (S.48)
Christine Holste weist darauf hin, dass es noch einen weiteren bedeutenden Teil visueller Kultur in der Bukowina gab, der aber zu dem Zeitpunkt, als Moshe Barasch seine Kindheitserfahrungen 1988 in einem Text artikulierte (»Reflection on Tombstones: Childhood Memories«) nicht mehr – bzw. noch nicht – zugänglich war: Die polychrome Synagogenmalerei in der Bukowina. Diese Wanddekorationen waren im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört worden, bzw. unter Ruß verdeckt, bis sie schließlich 2016 freigelegt wurden. Deren Bedeutung sieht Holste darin, dass sie weitere Aufschlüsse »über die Transformation zu einer säkular-jüdischen Malerei geben könnten« (S.50). Also über jene Entwicklung, die im Titel des Sammelbandes angedeutet ist. Moshe Baraschs Erforschung der visuellen Kultur seiner Gegend wurde durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten beendet – 1939 fand auch die jüdische Renaissance in der Bukowina ihr Ende und alle Bemühungen mussten auf die Notwendigkeit zur Flucht gerichtet werden. Für Christine Holste sind jene Motive der jüdischen Renaissance, die Moshe Barasch künstlerisch und intellektuell aufgegriffen hat, in zweierlei Hinsicht aufschlussreich: Zum einen, weil sie eine Verschiebung in der Bewertung zuvor gemeinhin »geächteter« Ausdrucksformen markieren. Zudem »gehören sie zu jenem Fundus seines Lebens, welcher unterbrochen von der Shoah in Israel seine kosmopolitische, so kunsthistorische wie religionsanthropologische Transformation erfuhr.« (S.64)
Das Buch
Holste, Christine; Faber, Richard (Hg.): Vom jüdischen Bilderverbot zur Gründung israelischer Kunstgeschichte. Zu Leben und Werk des Kunsthistorikers Moshe Barasch, Würzburg: Königshausen & Neumann 2019, 362 S., 64 Euro