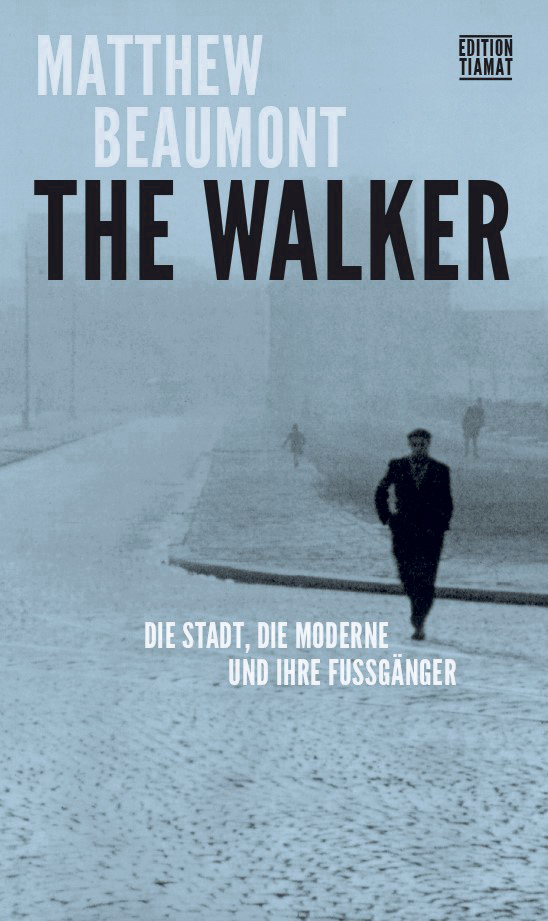»Mein Flaneur ist auf der Flucht vor der Stadt, mit der er auf fatale Weise verbunden ist.« (Matthew Beaumont)
Klaus Bittermanns Verlag Edition Tiamat ist zum Teil getragen von den Schriften der Avantgarde, wie diese selbst von der großstädtischen Moderne, in der sich der Alpdruck ausdrückt, den sie auf den Einzelnen hinterlässt und gegen den diese aufbegehren.
Gemeint sind damit die historischen Avantgarden, die aus der Kunst kamen und in ihren Angriffen auch vor der Kunst selbst – als vom alltäglichen Leben abgetrennten Bereich – nicht halt machten: Dada, Surrealismus und die Situationisten. Eine Avantgarde, die sich nicht in Form eines Führungskommandos bestimmt, sondern als verlorener Haufen hinter feindlichen Linien: in der Stadt, als Erkundungstrupp im Gestrüpp des geordneten Raums.
Passend dazu erschienen mit Matthew Beaumonts »The Walker« bei Tiamat nun literarische Streifzüge auf den Spuren einer seltenen Spezies in deutscher Übersetzung. Beaumont greift die prominentesten städtischen Abenteuer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (wie die des Surrealisten Breton mit seiner Muse »Nadja«) auf und geht zurück zu den literarischen Niederschlägen solitärer Stadtwandler aus dem 19. Jahrhundert. Was diese eint, ist nicht das Agieren in einer Gruppe oder das Ausrufen eines Programms, sondern die gesättigte Erfahrung, sich in einer feindlichen Umgebung zu bewegen und den Reflex darauf in Wort und Tat festzuhalten.
Auf schwarzem Grund in Feindesland
In »The Walker« kommen jene Fußgänger zur Sprache, die sich laut Beaumont durch ihr »nicht dazugehören« auszeichnen: »Sie sind die Anti-Helden der Moderne. Sie lassen sich treiben, lungern herum oder streifen ziellos durch die Stadt; sie brechen angesichts ihrer Überfülle zusammen oder stolpern zufällig durch die Straßen; sie drücken sich nach langer Krankheit herum; sie verschwinden auf mysteriöse Weise oder müssen plötzlich vor denen fliehen, die die Stadt verwalten und überwachen. Es ist die Überzeugung dieses Buches, dass die, die den Widersprüchen der großstädtischen Moderne am nächsten sind, sich am besten dazu eignen, ihren entfremdenden, aber auch ihren befreienden Möglichkeiten auf den Grund zu gehen. Das ist es, was es heißt ein Modernist der Straße zu sein.«
Nun tummeln sich auf der Straße viele, nicht nur zu Fuß – allein das Wort »Straße« weckt fast natürlich den Gedanken an Autos, die über sie fahren. Gerade für diese interessiert sich Beaumont aber gerade nicht – für ihn steht das Auto der Erfahrung der Stadt gerade entgegen und zementiert die Atomisierung der entfremdeten Individuen. Aber auch beim Gehen unterscheidet er; es kommt auf den Schritt an – der Gleichschritt des Pendlers mag zielstrebig sein, doch für die Erfahrung einer städtischen Umgebung ist er verloren. Prägnant findet sich dies in der Einleitung über »verlorene« und »unverlorene Schritte«, wo er die Abenteuer von André Breton aufgreift, die dieser in »Nadja« beschrieben hat. Gerade der zielstrebige Gang, der sich nirgendwo verliert, ist verloren – derjenige, der sich in der Stadt verliert, dagegen nicht; er ist unverloren, weil er einen neuen Blick auf die Stadt eröffnet und darüber auch die Fremdbestimmung und die Verlorenheit der Einzelnen innerhalb der Stadt erkennbar macht. Für den Pendler wiederum wäre dies verlorene Zeit auf dem Weg zur Arbeit – Beaumont und seinem Fußgänger dagegen ist die Arbeit verlorene Zeit, solange mit ihren Produkten nicht die Bedürfnisse im Vordergrund der Produktion und damit auch eine andere Art des Lebens samt anderer Stadt stehen. Beaumont ist wie sein Fußgänger ein »Zeichendeuter«, der in die untergründigen Flüsse der Stadt eintauchen und die Gravur der kapitalistischen Herrschaft in der Architektur freilegen kann, ganz so wie Walter Benjamin die Surrealisten beschrieb, für die das Elend dieser Gesellschaft nicht nur das »soziale sondern genauso das architektonische, das Elend des Interieurs« umfasste. In keiner Weise geht es den Genannten um das Ressentiment gegen den »Moloch Großstadt«: Die Stadt steht für die Moderne und die Erfahrung des Fußgängers ist symptomatisch für die gesellschaftlichen Spannungen; er ist, laut Beaumont, eine Art »Indikatorenspezies«, in der Biologie ein Organismus, dessen »Gesundheit etwas über den allgemeinen Gesundheitszustand der Umgebung« aussagt.
In seinen literarischen Studien entwirft Beaumont insgesamt zehn bestechende Modelle, die die psychischen Bedingungen der Stadt sowie den Reflex darauf zutage befördern. Anhand Edgar Ellen Poes »Der Mann in der Menge« verweist er auf den Zustand des »Genesenen« als Ideal des Fußgängers – der Kranke ist ausgeknockt, der Gesunde muss zurück an die Arbeit und verheddert sich im Alltag. Bei Charles Dickens »Der Raritätenladen« zeigt Beaumont auf das Moment des »vom Wege abkommen«. In Edward Bellamys »Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887« ist es das »Verschwinden«, aus der Identität und der eigenen Zeit, als Moment von Freiheit und Bedrängnis. Besonders eindrücklich ist Beaumonts Abhandlung zum »Fliehen« anhand H.G. Wells‘ »Der Unsichtbare«: Wells – selbst geplagt von Angstzuständen beim Gang durch die Stadt – entwirft für seinen literarischen Charakter die Möglichkeit, unsichtbar zu werden, um sich unverwundbar zu machen; doch der Charakter dreht in seiner gefühlten Omnipotenz auf und geht auf andere los und steht so für das mögliche Kippen der Unsichtbarkeit in eine barbarische Regression. Beaumonts siebtes Modell ist das des »Irren« und lässt an G.K. Chestertons »Der Mann der Donnerstag war« aufscheinen, dass die Moderne ebenso die Zeit des Rationalen wie des Irrationalen ist, die Zeit des radikalen Zweifels am Hergebrachten ebenso wie die des Irren. Innerhalb Ford Madox Fords »Return to Yesterday« wird im Modell des »Zusammenbrechen« herausgearbeitet, wie der Autor von der eigenen Geschichte eingeholt wird und am Alpdruck der Verhältnisse zerschellt. Während einige Figuren die aktive Gegenwehr gegen den Druck der modernen Gesellschaft widerspiegeln, verweist Virginia Woolfs »Mrs Dalloway« an der Figur des »Peters« auf das – für Beaumont beim zur Passivität verdonnerten Städter – charakteristische Moment des »Starrens«. In dieser Figur »dekonstruiert« Woolf, so Beaumont, den Archetypus des Flaneurs und zeigt auf, wie er, als Mann – vor allem als Mann der Oberschicht – vergafft ist in das Spektakel, in die Welt der Ware. Besonders daran ist nicht nur Woolfs Art, dem Flaneur den Spiegel vorzuhalten, sondern auch, wie hervorgehoben wird, dass es sich um ein Gegenmodell handelt zu den anderen Werken, in denen das Geschlecht weitgehend unsichtbar gemacht wird; so kommt die Flaneuse partiell zu ihrem Recht. In »Anfangen« folgt Beaumont Georges Batailles Abhandlung »Der große Zeh«. Dabei arbeitet er heraus, wie der Mensch sich für seinen aufrechten Gang preist und gleichzeitig die Basis, den Fuß (zumal den großen Zeh) verschmäht und mit dem Niederen verbindet. Ray Bradbury lässt in »Geh‘ nicht zu Fuß durch Stille Straßen« die Hauptfigur durch die Gegend wandern, während die Mehrheit zuhause vor der Glotze sitzt. Klare Sache: Wer draußen umhergeht, der kann nicht ganz normal sein. Umgedreht in Matthew Beaumonts Modell des »Stolperns«: Wer nicht stolpert, der macht keine Erfahrungen – merkt nicht, dass hier was nicht stimmt.
In »The Walker« wird das Bild des Flaneurs konturiert durch jene randständigen »Modernisten«, die mit der Stadt verwoben sind und ihren Zwängen zu entkommen trachten. Abgeschlossen werden die Studien mit einer Abhandlung über die »architektonische Logik des zeitgenössischen Kapitalismus«, die noch einmal in den Blick holt, was in der von Beaumont angestimmten »Feier« der solitären Stadtwandler in der Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhundert etwas an den Rand gerät: es handelt sich lediglich um den Ursprung einer Tendenz zur Verdrängung von Erfahrungen auf der Straße. Denn heute – nach Jahrhunderten »kreativer Zerstörung« der vormaligen städtischen Struktur – ist es wesentlich schwerer, sich in der Stadt treiben zu lassen, sich gegenüber der Übermacht der Warenwelt, sowie dem stetigen Verlust von Öffentlichkeit durch die Privatisierung unbeeindruckt zu verhalten. Grell beschreibt der Autor dabei, wie die neue Architektur, die nicht auf Offenheit und Mitbestimmung aus ist, dem Einzelnen wie mit einem Visier begegnet, sich abschottend und zugleich beobachtend. Dagegen wirkt Beaumonts Idee, sich mithilfe eines schwarzen Kapuzenpullovers selbst ein Visier anzuschaffen, selbst bereits antiquiert.
Letztlich handelt es sich hier um einen Aufruf, es den Stadtwandlern gleichzutun und in Form eines »aufmerksamen Gehens« für die Stadt eine poetische Geographie zu formulieren, die derjenigen des Kapitals schroff entgegen tritt, indem man – in den Worten Beaumonts – »Erinnerungen und Geschichten der öffentlichen, kollektiv gelebten Stadt freilegt, die die privaten Interessen systematisch auszuradieren versuchen.« Um den Charakter der Dingwelt freizulegen und die verschwommene Gravur ihrer Geschichte zu entziffern, muss in sie eingetaucht werden. Wer dies tut, der wird heimgesucht von der versteckten Geschichte der Stadt und der Kämpfe um sie. Beaumonts Fußgänger wird die Stadt unheimlich – entrückt vom Alltäglichen bricht wie im Traum auf, was sonst verstellt wird. Umgekehrt werden für die Stadt die verlorenen Schritte der Fußgänger selber zur Heimsuchung, wenn er sich in Allianz mit der untergründigen Geschichte bewegt; eine zweite, poetische Geographie kultiviert. Folglich fordert Beaumont für die Stadt: »Wenn sie unser Zuhause bleiben sollen - so wie in ‚heimsuchen‘ das Wort Heim steckt -, müssen die Straßen unheimlich werden.«
Einzelne Stellen des Buchs verlieren sich im Literaturhistorischen, wirken dem Feuilleton verhaftet. Ob Beaumont dem »Fußgänger« etwas zu viel zutraut, lässt sich theoretisch schlecht klären, entschieden wird die Frage letztlich auf der Straße – zu Fuß. Eine Herausforderung, die hoffentlich viele eingehen werden.