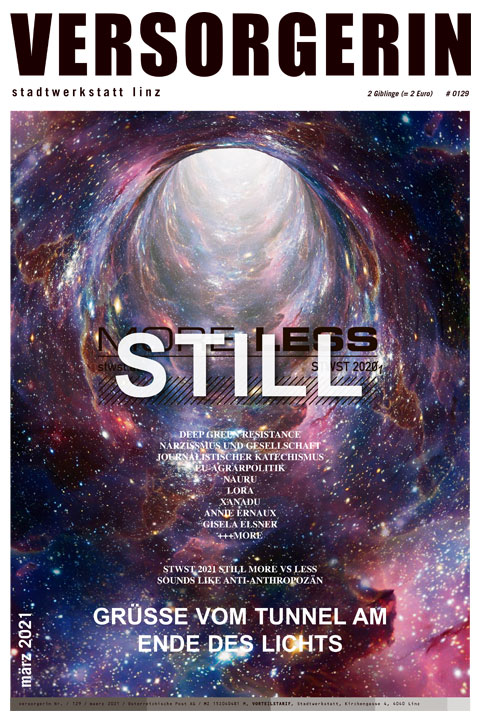Als im vergangenen Frühjahr die erste Corona-Welle Italien heimsuchte und trotz der Dramatik der Lage keine Rede von einer Schließung der nicht unmittelbar notwendigen Industrie war, taten die Beschäftigten der Fiat-Werke das, was sich in Ländern mit einer langen Tradition von Arbeitskämpfen schon oft bewährt hat: Sie traten in den Streik – und setzten damit einen Lockdown der Autoindustrie durch.
In den Auto- und Arbeitsfetischnationen weiter nördlich wäre so etwas natürlich undenkbar. Zwar standen einige Wochen später etwa auch in Deutschland die Bänder bei VW & Co. eine Zeitlang still; allerdings nicht auf Druck der Belegschaften und wohl auch vor allem deshalb, weil die Konzerne ohnehin gerade zu viele Fahrzeuge auf Halde hatten und ihnen deshalb ein paar Wochen staatlich bezahlte Betriebsferien ganz
gelegen kamen.
Im Herbst, als die zweite Welle anrollte, war jedenfalls keine Rede mehr von Kurzarbeit – offenbar haben die im Sommer beschlossenen Subventionen für die Branche[1] ihre Wirkung getan. (Ironischerweise sorgte die Pandemie Anfang des Jahres dennoch für einen Produktionsstopp in etlichen Werken – die gestiegene Nachfrage nach Heimelektronik und Ähnlichem führte zu Lieferengpässen bei Mikrochips, ohne die heutzutage ja auch kein Auto mehr auskommt.)
Der Unwille der Autoindustrie, sich auf ein paar Wochen harten Lockdown mit Aussicht auf eine annähernd coronafreie Zukunft einzulassen, steht dabei exemplarisch für die gesamte Wirtschaft und die (Un-)Logik des Kapitalismus an sich, der auf kurzfristige Profite nicht verzichten kann, auch wenn dies auf längere Sicht deutlich schwerere Schäden für die Ökonomie bedeutet – die Klimakrise lässt grüßen.
Einst war es ja mal die Aufgabe des Staates, diese selbstzerstörerischen Tendenzen einzuhegen. Mit der neoliberalen Wende seit den 1980er/90er Jahren hat er diese Funktion jedoch weitgehend aufgegeben – zu Ausnahmen von der Regel kommen wir gleich – und versteht seine Rolle als »ideeller Gesamtkapitalist« nur mehr darin, der Wirtschaft jeden Wunsch zu erfüllen. Zumindest deren finanz- und lobbystarken Sektoren; Kleingewerbe, Selbständige und Kulturbetriebe hingegen werden in der Krise mit Kleckerbeträgen abgespeist und können ansonsten sehen, wo sie bleiben. Aber die tragen ja auch nichts zur Exportbilanz bei.[2]
Reif für die Insel
Während in Europa also abgewogen wird, wie viel Lockdown light »der Wirtschaft« gerade noch zuzumuten ist, und die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle nur als in belegten Intensivbetten gemessene Variable in die volkswirtschaftliche Rechnung einfließt, zeigen andere Länder, dass so eine Pandemie keine unabwendbare Naturkatastrophe ist. Und zwar nicht nur Staaten wie China oder Vietnam, sondern auch solche, die garantiert nicht unter Sozialismusverdacht stehen, wie etwa Australien oder das Musterbeispiel Neuseeland. Dort wurde jüngst nach dem Auftreten von gerade einmal drei Fällen ein dreitägiger Lockdown in Auckland, der größten Stadt des Landes, verhängt und Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen im gesamten Land untersagt.
Dass die Bevölkerung dies mitträgt – wie auch schon die sehr viel weitergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die zu Anfang der Pandemie dafür sorgten, dass es momentan nur zu derart überschaubaren Ausbrüchen kommt –, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass kaum jemand[3] um seine Existenz bangen muss, wenn die Berufsausübung eine Zeitlang nicht möglich ist: Der neuseeländische Staat kompensiert Verdienstausfälle ganz selbstverständlich mit Notfall-Sozialleistungen. So etwas wäre in Deutschland natürlich undenkbar, wo das Nichtbeitragen zum Bruttoinlandsprodukt mit dem Disziplinierungswerkzeug Hartz IV bestraft wird und dabei noch unter dem Verdacht des Sozialschmarotzertums steht.
Gefährliche Denkpause
Trotz dieser fast aussichtslosen Voraussetzungen wurde im Januar die Initiative »Zero Covid« ins Leben gerufen. Die Initiator*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz knüpfen damit an die Forderung aus der Wissenschaft nach einer europaweiten »No Covid«-Strategie an, gehen aber darüber hinaus: »Wir sind allerdings überzeugt, dass die Eindämmung des Sars-CoV-2 Virus nur gelingen kann, wenn alle Maßnahmen gesellschaftlich solidarisch gestaltet werden«, heißt es in dem Aufruf. Deshalb werden neben einem mehrwöchigen europaweiten Shutdown mit dem Ziel, die Ansteckungen auf (annähernd) null zu reduzieren, flankierende soziale Maßnahmen gefordert, finanziert durch eine Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und hohe Einkommen.
Leider ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Initiative mehr bewirkt als einen Anstoß zum Nachdenken über die Menschenfeindlichkeit und allgemeine Absurdität eines Wirtschaftssystems, in dem viele Jobs keinen anderen Zweck haben, als Profite zu generieren und quasi als Nebeneffekt Menschen ein Einkommen verschaffen, die zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungen sind.
Die Weigerung, große Teile der Gesellschaft für ein paar Wochen kollektiv in den Urlaub auf Balkonien zu schicken, dürfte nämlich neben den ökonomischen auch ideologische Gründe haben. Schon der erste Lockdown im vergangenen Jahr führte gefährlich nahe an die Erkenntnis, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn eine Zeitlang mal kein unnützes Zeug produziert wird und die Arbeit in PR-Agenturen, Assessment Centern oder Consultant-Firmen ruht. Und nicht auszudenken, wenn dann auch noch die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens über linke Zirkel hinaus populär würde – das hieße ja, dass man bisherige Billigjobs deutlich besser bezahlen müsste, damit sie jemand erledigt.
My Home is My Office
Wenn aber schon auf Teufel bzw. Corona-Mutanten komm raus Mehrwert produziert werden muss, so ließe sich das in vielen Fällen doch immerhin von zu Hause aus erledigen – Konjunktiv wohlgemerkt. Zwar zeigte sich im vergangenen Frühjahr, dass dies in zahlreichen Berufen möglich ist: Der gewerkschaftsnahem Hans-Böckler-Stiftung zufolge wechselten damals 27 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland ins Homeoffice. Im November waren es jedoch nur noch rund halb so viele, nämlich 14 Prozent.
Das liegt teils sicherlich auch daran, dass das Arbeit daheim in vielen Fällen eben nur eine Notlösung ist; sei es, weil es an den räumlichen Gegebenheiten oder ergonomischen Arbeitsmitteln fehlt oder weil »nebenbei« auch noch Kinder betreut werden müssen. Vielfach sind es jedoch die Vorgesetzten, die darauf bestehen, dass sich die Leute in den öffentlichen Nahverkehr quetschen, im Großraumbüro sitzen und an Präsenzmeetings teilnehmen, die sich auch per Videokonferenz abhalten ließen.
Mit wirtschaftlichen Erwägungen ist das nur bedingt zu erklären, auch wenn sicher viele Firmen davor zurückscheuen, den Beschäftigten die Anschaffung von Heimequipment zu bezahlen. In erster Linie ist es aber die sogenannte Unternehmenskultur – die häufig auf Misstrauen basiert. »Es gibt natürlich auch den Mitarbeiter, der da unter Umständen einen persönlichen Vorteil draus schlagen möchte und jetzt den Wunsch nach einem Heimarbeitsplatz verwirklichen möchte«, zitiert etwa der NDR den Personalchef eines Flensburger Unternehmens. Was an den möglichen Vorteilen schlecht für den Betrieb sein soll – wenn die Leute beispielsweise ohne morgendliche Pendelei ausgeschlafener sind oder sich schlicht am eigenen Schreibtisch wohler fühlen –, erschließt sich nicht.
Bei den Vorbehalten schwingt natürlich die Unterstellung mit, ohne permanente Kontrolle wären die Angestellten schlicht faul – was mehr über das Betriebsklima aussagt als über die Einstellung der Beschäftigten. Befördert wird dieses Denken zudem durch die gängigen Homeoffice-Symbolfotos von Menschen, die mit dem Laptop auf dem Sofa lümmeln (was freilich nur in Hinsicht auf die Rückengesundheit verwerflich wäre); auch der immer wieder zu lesende Rat, die Heimarbeit bloß nicht in der verpönten Jogginghose zu verrichten, weil das schlecht für die Arbeitsmoral sei, schlägt in diese Kerbe – wer so etwas schreibt, hat offensichtlich noch nie ausprobiert, wie wunderbar eine kleine Gymnastikpause oder auch schon ein paar Kniebeugen zwischendurch Kreislauf und Hirn ankurbeln können.
Jedenfalls widerlegen wirklich alle Studien zum Thema die Legende vom Müßiggang im heimischen Arbeitszimmer und kommen zu dem Ergebnis, dass Angestellte im Homeoffice nicht nur weniger gestresst, sondern tendenziell sogar produktiver sind. Ob es sich einfach ungestörter arbeiten lässt, wenn den Leuten nicht ständig Vorgesetzte im Nacken sitzen und Besprechungen von der Sorte »das hätte sich auch mit einer E-Mail klären lassen« wegfallen, oder ob es daran liegt, dass sich Beschäftigte selbst mehr Druck machen, um sich eben nicht dem Vorwurf der Faulheit auszusetzen, ist allerdings unklar.
Gegen die uneingestandene Angst, insbesondere des mittleren Managements, vor Bedeutungs- und Machtverlust, die beim Widerstand gegen die Heimarbeit eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen dürfte, kommt die Empirie allerdings nur schwer an, und auch der windelweiche Homeoffice-Erlass, zu dem sich die deutsche Regierung widerwillig durchgerungen hat, zeigt erwartungsgemäß keine Wirkung. Und wo selbst eine solche minimalinvasive Option, die gesamtgesellschaftliche Viruslast zu senken, kaum wahrgenommen wird, ist erst recht nicht mit weitergehenden Maßnahmen zu rechnen, von einer sozialverträglichen Pandemiebekämpfung à la Zero Covid ganz zu schweigen.
Stattdessen wird die inoffizielle Strategie von Think Tanks wie dem Institut der deutschen Wirtschaft vorgegeben, das, pünktlich zum Anrollen der dritten Welle mit noch aggressiveren Virusvarianten, für Lockerungen plädiert – eine »gewisse Sterblichkeit« müsse eben hingenommen werden. Aber vielleicht werden ja wenigstens künftige Generationen mit Gruseln auf eine Zivilisation zurückblicken, die Menschenopfer darbrachte, um eine unbarmherzige Gottheit namens Wirtschaft zu besänftigen.
Das Virus und der Todeskult
[1] Deklariert als »Umweltprämie« für Elektro- und Hybridautos (wobei insbesondere Letztere ungefähr so öko sind wie das Ersetzen eines Schotterbeets durch eine Rasen-Monokultur, aber das nur am Rande)
[2] Sicherlich spielen nicht nur ökonomische Faktoren eine Rolle beim Versagen in der Pandemiebekämpfung. In Deutschland etwa bilden protestantisches Arbeitsethos und die sehr katholische Suche nach Schlupflöchern in den ohnehin laschen Auflagen eine ungesunde Mischung; hinzu kommt der Hang der Politik, sich lieber von rechtslastigen bis offen faschistischen Strömungen – also auch den quarkdenkenden Coronazis – vor sich hertreiben zu lassen, als sich an der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung zu orientieren, die mit den Einschränkungen einverstanden ist oder sogar schärfere Maßnahmen fordert.
[3] Auch der Inselstaat ist freilich nicht das Paradies der unfreiwillig Nicht-Werktätigen: Der auch sonst sehr lesenswerte Artikel »Ausgangssperre und Tracing-App«, in dem die Zeitschrift analyse & kritik die Situation in verschiedenen Corona-Musterstaaten aus linker Perspektive beleuchtet, weist darauf hin, dass die Leistungen fast ausschließlich an Staatsangehörige und Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltstitel gezahlt werden.