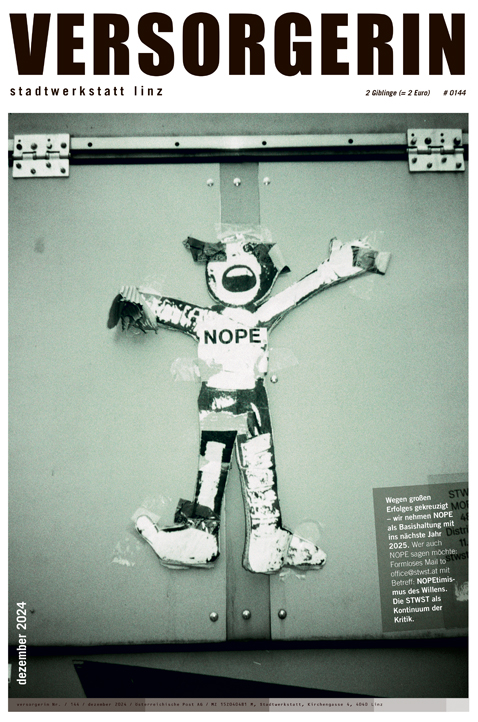Hochverehrter Dr. Franz Kafka,
nie wäre mir die Idee gekommen, Ihnen einen Brief zu schreiben, wenn in diesem Jahr nicht Ihr hundertster Todestag gewürdigt werden würde. Von der Wiederkehr dieses Tages geht eine sonderbare Faszination aus, der auch ich erliege. Doch verstehen Sie mich nicht falsch: Zwar bin auch ich von der quasi-magischen Wirkung erfasst worden; jedoch weiß ich immerhin darum, dass ich damit die Abgerundetheit einer im Dezimalsystem angeordneten Ziffer fetischisiere. Denn obgleich die Jahreszahlen 1924 und 2024 für sich genommen in einem Verhältnis ziemlicher Bedeutungslosigkeit zueinander stehen, erwächst aus der Wiederkehr Ihres Sterbetags eine der Ziffer geschuldete pseudohafte Ordnung.
Seither ist die Erde einhundert Mal um die Sonne gekreist – und in dieser Zeit haben sich in Europa Ereignisse zugetragen, deren Ungeheuerlichkeit dazu geführt haben, dass zu Ihren Lebzeiten noch gültige Annahmen über den Zusammenhang von Geschichte, Fortschritt und Vernunft endgültig widerlegt wurden. Unumgänglich scheint es mir, Ihnen an dieser Stelle mitzuteilen, dass auch Ihre drei Schwestern und lieb gewonnenen Freunde zu den zirka sechs Millionen Juden gehören, die nicht in der Lage waren, sich der systematisch betriebenen Ausrottung des jüdischen Volkes zu entziehen. Im Jahr 1942 wurden Ihre Schwestern Gabriele und Valerie in Chelmno ermordet. Ein Jahr später wurde Ihre Schwester Ottilie in Auschwitz-Birkenau, der zwischen Krakau und Kattowitz gelegenen Todesfabrik im damalig deutsch gewordenen Polen, umgebracht. Im Jahr darauf wurden dort auch Ihre ehemalige Verlobte Julie Wohryzek und Max Brods Bruder Otto ermordet. Ihr Freund Jizchak Löwy wurde 1942 in Treblinka umgebracht. Ihre Freundin Milena Jesenská ist nach fast vierjähriger ›Schutzhaft‹ 1944 im Lager Ravensbrück den unmenschlichen Haftbedingungen erlegen. Was in Auschwitz-Birkenau geschah, macht diesen Ort zu einem Niemandsland des Verstehens, einem schwarzen Kasten des Erklärens, einem Vakuum, das historiographische Deutungsversuche aufsaugt und außerhistorische Bedeutung annimmt, so der Historiker Dan Diner. In vielerlei Hinsicht – wenn auch unter einem völlig anderen Vorzeichen – sind auch Ihre Werke zu einem Inbegriff dafür geworden, die Vergeblichkeit des Verstehens zu verstehen. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen.
Ihr Schreiben ist laut Maurice Blanchot, einem Autor und Literaturtheoretiker, vor allem dadurch gekennzeichnet, ein Verhältnis zum Tod zu finden. Während Selbstvergewisserung in Ihren Sprachkunstwerken nahezu unmöglich gemacht wird, führen Sie uns die Gewissheit der eigenen Endlichkeit vor Augen: Mehrheitlich neigen wir Lebenden doch dazu, uns unsterblich zu wähnen, ohne uns dabei jemals der Frage gestellt zu haben, ob es das, was wir für unser Selbst halten, überhaupt wahrhaftig gibt. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir Tiere sind, die sich damit abmühen, das zwischen Innerlichkeit und Weltbezug gefangene Ich zu verkennen. Hochverehrter Herr Kafka, ist es nicht so, dass wir als Angehörige der menschlichen Spezies danach streben, eine unüberwindbare Grenze zum Tierischen zu errichten, um uns etwa davor zu bewahren, unwillentlich ins äffische Vorleben zurückzufallen? Ist das hypertrophe Bewusstsein des Menschen nicht etwas zutiefst Ambivalentes, das einerseits zwar der Natur entsprungen ist, das ihn andererseits aber von der Natur und damit unwiderruflich auch von sich selbst abtrennt? Dass Sie sich mit diesem Schlamassel auseinandergesetzt haben, macht die von Rotpeter erzählte Geschichte mit dem Titel Ein Bericht für eine Akademie überaus deutlich.
Erwartungsgemäß ist Ihr Freund Max Brod der von Ihnen auf Zetteln hingeschmierten Bitte, Ihre unveröffentlichten Schriften zu vernichten, nicht nachgekommen. Im Gegenteil, ihm ist es zu verdanken, dass die von ihm bearbeiteten Fragmente veröffentlicht wurden. Weil ihm die Flucht ins Mandatsgebiet Palästina noch rechtzeitig gelungen ist, konnte er auch Ihren Nachlass retten. Ihnen muss klar gewesen sein, dass eben gerade er Ihre Bitte missachten würde. Haben Sie beim Schreiben Ihrer Tagebücher darauf spekuliert, dass sie einmal veröffentlicht werden würden? Wenn nicht, möchte ich Sie die Indiskretion zu entschuldigen bitten, nun auf diese Notizen zurückzugreifen. Ihr am 8. Januar 1914 verfasster Tagebuch-Eintrag weist auf eine doppelte Identitätsproblematik hin, schreiben Sie darin doch über eine Entfremdung von der jüdischen Zugehörigkeit und zugleich vom personalen Ich. Da heißt es: »Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich ganz still, zufrieden damit dass ich atmen kann in einen Winkel stellen.«
Zum einen nimmt sich jemand wie Sie (zumindest zum damaligen Zeitpunkt) kaum noch als Jude wahr, was vorrangig dem an die Assimilation geknüpften Emanzipationsversprechen sowie dem negativen Selbstbild angesichts des östjüdischen Traditionsbewusstseins geschuldet sein mag. Zum anderen fällt Ihnen eine Identifizierung mit einer Gruppe vermutlich auch deshalb schwer, weil Sie an sich selbst beobachten, wie trügerisch das personale Identitätsgefühl ist. Da Sie etwas, das so unergründlich wie das eigene Ich ist, durch die Unmöglichkeit gekennzeichnet sehen, nicht vollständig mit sich selbst identisch sein zu können, zeugt dies nicht nur von einer Verbindung von Demut und Selbstdemütigung, sondern wirkt sich zugleich auf die Fähigkeit aus, sich einem Wir überhaupt zugehörig fühlen zu können. Zudem wird in Ihrem Eintrag eine künstlerische Sublimierung des Absurden avant la lettre offenbar, da Sie das Nichtidentische im Identitären unterstreichen – und nicht etwa durchstreichen. Demgemäß ist es eine Besonderheit Ihrer Biografie, dass sie sich der Zuweisung von Zuordnungen und Zuschreibungen weitgehend verweigert: Sie sind als deutschsprachiger Jude Angehöriger einer Minderheit innerhalb der deutschen Minderheit in Prag – einem einstigen Schwellenort zwischen Ost- und Westjudentum, zwischen Bewahren und Verleugnen der Herkunft – zunächst österreichisch-ungarischer Staatsbürger, nach dem Ersten Weltkrieg dann Tschechoslowake, niemals aber deutscher Staatsbürger. Ihre Literatur lässt sich daher kaum verorten, weil sie – wie Sie – von gegensätzlichen innerjüdischen Konzepten der Assimilation, der Diaspora und des Kulturzionismus geprägt wird.
Nach Auschwitz lässt sich in die oben zitierte Tagebuchnotiz außerdem eine düstere Prophezeiung hineinlesen: Sie appellieren darin an sich selbst, zufrieden damit zu sein, atmen zu können. In den Gaskammern ist Juden das Atmen im wortwörtlichen Sinne millionenfach unmöglich gemacht worden. Indessen wurde Ihr Roman Der Prozess als Vorwegnahme stalinistischer Schauprozesse gelesen. Es heißt, der berühmte Literaturtheoretiker Georg Lukács – nur zwei Jahre nach Ihnen geboren – habe ausgerechnet Sie, dessen Literatur im Realsozialismus wegen Ästhetizismus, Nihilismus und Subjektivismus geächtet wurde, zum Realisten erklärt, weil sich die metaphorische Verdichtung des Realen in Ihren Texten plötzlich mit der von ihm im Jahr 1956 gemachten Verhaftungserfahrung gedeckt habe. Dennoch, hochverehrter Herr Kafka, wird es der künstlerischen Originalität Ihrer Texte nicht gerecht, sie ausschließlich als Weissagungen totaler Herrschaft zu lesen oder sie sogar als ›bourgeoises‹ Negativbeispiel für eine ideologisch ausgerichtete Ästhetik im Geiste eines vulgärmarxistischen Realismus zu missbrauchen. Womöglich besteht das vermeintlich Dekadente und Subversive Ihrer Literatur gerade in der pessimistisch verzerrten Darstellung von Sozialität.
Apropos Sozialität, Ihr Schreiben setzt das Alleinsein voraus. Sie sehen sich in das Alleinsein laufen wie das Wasser ins Meer. Erlauben Sie mir eine weitere Frage: Stimmen Sie mir darin zu, dass Ihr Schreibzwang keiner Berufung, keinem Interesse und erst recht keinem Engagement für etwas entspringt, sondern im Schreiben der Sinn und Zweck Ihres Lebens besteht? Mir scheint, Ihre gesamte Lebensweise sei nur auf das Schreiben hin eingerichtet. Sie sagen über sich selbst, aus Literatur zu bestehen, nichts Anderes zu sein und nichts Anderes sein zu können. Sie schreiben davon, alles zu hassen, was sich nicht auf Literatur bezieht. Es langweile Sie, Gespräche zu führen, selbst wenn Literatur der Gegenstand des Gesprächs sei. Und sogar die Leiden und Freuden Ihrer Verwandten, so schreiben Sie, würden Sie bis in Ihre Seele hinein langweilen. Ja, Ihr Leben bestehe im Grunde von jeher aus Versuchen zu schreiben und meist aus misslungenen, wie Sie in einer Ihnen eigenen Art der Selbstherabsetzung betonen: Schreiben Sie aber mal nicht, dann sehen Sie sich auch schon auf dem Boden liegen, wert hinausgekehrt zu werden.
So wichtig Ihnen, lieber Herr Kafka, das Alleinsein ist, ebenso sehr lassen Sie die Leserschaft mit Ihren Texten allein. In Der Verschollene und Das Schloss lassen Sie uns etwa Karl Roßmann und K. auf sinnlosen Wegen ohne irdisches Ziel folgen. In der Unerschöpflichkeit Ihrer Türhüter-Parabel wird wiederum deutlich, dass in dem Anspruch, die Sinnfrage erschöpfend zu klären und somit das Sinnbegehren zu stillen, eine Ästhetik des Scheiterns angelegt ist, deren innere Wahrheit über den verloren gegangenen Sinnzusammenhang hinausweist. Ihre Literatur führt an die Grenze des Verstehens, weil sie zur Interpretation herausfordert, ohne dass die von Ihnen gestaltete Welt in textueller Angemessenheit ergründbar wäre. Der Kulturkritiker Theodor W. Adorno hat Sie daher einen »Paraboliker der Undurchdringlichkeit« genannt. Was es heißt, dass sich Ihr Text einer Verstehbarkeit grundsätzlich zu entziehen sucht, fasst er treffend zusammen: »Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden.« Und so wird in Ihrer Literatur exemplifiziert, dass einem auf Sinn ausgerichteten Verstehen durch die Rätselhaftigkeit Ihrer Texte der Boden entzogen wird, weil das semantische Fundament nur scheinbar feste Konturen aufweist und eine vorübergehende Verflüssigung des Aussagegehalts einer Sinngebung zuwiderläuft. Es ist, als würde die Suche nach Sinn in Ihrer Literatur selbst zum Problem werden, weil sich die im Zerfall begriffene Kohärenz nicht fixieren lässt. Angesichts einer alles überformenden Gegenwärtigkeit des Todes, der das Leben der Protagonisten wiederum mit Leere erfüllt, machen Sie etwas Grundlegendes über die Grenzen des Verstehbaren und deren Paradoxien kenntlich.
Wie Sie sich vorstellen können, gerät das menschliche Bewusstsein, das mit der Hermetik eines Ihrer Kunstwerke konfrontiert wird, – metaphorisch gesprochen – in eine Denkbewegung hermeneutischer Schleifen und Verstrickungen. Ein Spezifikum Ihres Schreibens – darin ist man sich übergreifend einig – besteht gerade im bedrückend Absurden, das immer wieder dasselbe Nichts in konzentrischen Formen umkreist und durch den Einsatz wirkungsästhetischer Mittel intensiviert wird. Paradigmatisch hierfür steht der Mann vom Lande in der Türhüter-Parabel, deren Intensität durch den Sturz in einen hermeneutischen Abgrund gesteigert wird. Albert Camus – ein Philosoph des Absurden, der sich von Ihnen prinzipiell unterscheidet, weil er annimmt, gegen die Absurdität revoltieren zu können – stellt fest, Ihr Geheimnis würde sich durch parallele Kontraste besonders akzentuiert in dem ständigen Wechsel zwischen Natürlichem und Außergewöhnlichem, zwischen Individuum und Allgemeinem, zwischen Tragik und Alltäglichem sowie zwischen Absurdem und Logischem einen künstlerischen Ausdruck verschaffen. Was halten Sie von Camus‘ Befund?
Wenn man mich fragt, worin die künstlerische Finesse Ihrer Geschichten besteht, so antworte ich mit einer bildlichen Übertragung: Ihre Texte versetzen mich in ein Spiegellabyrinth, das keinen Ausgang hat. Ähnlich labyrinthisch ist übrigens der fachwissenschaftliche Dschungel, den man oft beklagt, der sich aber immer weiter ausbreitet, so der Historiker Saul Friedländer, der wie Sie in Prag geboren wurde. Vermutlich geraten Sie in einen Zustand ausgelassener Heiterkeit, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass man in zirka 20.000 Büchern über Inhalt und Form Ihrer Texte spekuliert. Sofern Sie sich fragen, wie ich dazu komme, Ihre Reaktion darauf vorhersehen glauben zu können: Es heißt, Sie seien beim Vorlesen Ihrer Texte mitunter in ein haltloses Gelächter ausgebrochen. Liegt der Grund für das Gelächter auch darin begründet, dass eine von Kohärenzerwartung erfüllte Aneignung Ihrer ausgefeilten Sprachkunstwerke permanent ins Leere läuft, weil Sie Ihre Geschichten derart konzipieren, dass die Grenzlinien zwischen Verstehen und Missverstehen, Orientierungswunsch und Orientierungsverlust verschwimmen?
Infolge semantischer Verschiebungen machen Sie eine Bestimmbarkeit von Bedeutung unmöglich, was wiederum jegliche Deutung misslingen lässt, die diese Eigenheit Ihrer Texte nicht als unabdingbare Voraussetzung für deren Reflexion in sich aufnimmt. Laut dem Kulturkritiker Walter Benjamin haben Sie ohnehin alle erdenklichen Vorkehrungen gegen die Auslegung Ihrer Texte getroffen. Aus den semantischen Verschiebungen darin entspringt die Quelle unerschöpflicher Sinnpotentiale. So weist der Geistliche im Dom-Kapitel Ihres Romans Der Prozess auf etwas unsagbar Wesentliches hin, dessen Selbstwidersprüchlichkeit jedoch gleichermaßen aufschlussreich und irreführend ist: »Richtiges Auffassen einer Sache und Mißverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus.« Der Germanist Gerhard Neumann bezeichnet das formgebende Verfahren Ihrer Texte demgemäß als gleitendes Paradox, das zum Entstehen einer kennzeichnenden Deutungsoffenheit beiträgt. Diese wird durch gegenläufige Bewegungen insofern intensiviert, als sich Ihre Texte einer Bestimmbarkeit wiederum verschließen, was keinesfalls gleichbedeutend damit ist, dass Auslegungsversuche als solche sinnlos wären.
Es ist, als würden Sie die Leserschaft in ein Kaleidoskop blicken lassen, worin disparate Sinnpotentiale in spiralförmig verlaufenden Richtungen so angeordnet sind, dass deren Anblick uns die Grenzen des Verstehbaren vor Augen führt. Der unwiderstehliche Reiz Ihrer Literatur speist sich vermutlich aus einer der Komplexität geschuldeten Undurchdringlichkeit von nach Erklärung verlangenden Sinnresiduen. Soll heißen, dem Schwanken zwischen Unfassbarkeit und Klarheit liegt eine Zirkulation variabler semantischer Potentiale zugrunde. Sie lösen die Verrätselung aus und machen die Widersprüchlichkeit zugleich unauflösbar: »[D]as Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen«, sagt der Erzähler in Die Sorge des Hausvaters über Odradek, einem merkwürdig ungreifbaren Dingwesen, das eine Zwirnspule verkörpert und sich gleichsam als abstrakte Personifikation eines Textgewebes lesen lässt, dessen Elastizität und Unbestimmbarkeit wiederum die Unmöglichkeit des Verstehens ästhetisch inszeniert. Damit erhält die Sinnlosigkeit den Schein ganzheitlicher Notwendigkeit. Kurz gesagt, das Konstruktionsprinzip Ihrer Textgewebe besteht darin, dass die formgebenden Erzählfäden nach einem Muster gestrickt sind, das zwischen einer auf Vergewisserung ausgerichteten Kohärenzerwartung und einer auf Deutungsverweigerung hinauslaufenden Zumutung verläuft. Bitte lassen Sie mich bei Gelegenheit wissen, was Sie von diesen Überlegungen halten!
Im Übrigen kennen Sie mich nicht, können mich gar nicht kennen. Und es ist auch gänzlich irrelevant, wer ich bin. Meine Funktion beschränkt sich darauf, Ihnen diese Botschaft zukommen zu lassen. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, erlaube ich mir, Sie damit über die kulturhistorische Bedeutsamkeit Ihrer Literatur in Kenntnis zu setzen. Und obwohl Sie bekanntlich ein obsessiver Briefeschreiber sind, misstrauen Sie dem Brief als Medium zutiefst. Denn das Tückische des Briefeschreibens sei es, sich von den selbst verfassten Briefen immer betrügen zu lassen. Seien Sie sich dennoch gewiss, dass die im Brief vermittelte Illusion zugleich ein wirksames Placebo gegen die inwendige Erstarrung und gegen das fortwährende Absterben des Lebens ist. Denn ist es nicht so, dass die verinnerlichte Leere zum Schreiben drängt, weil sich die Flamme des Lebens im Schreibakt selbst verzehrt und paradoxerweise einen Ausdruck zu verschaffen sucht? Natürlich ist mir klar, wie ausgesprochen unwahrscheinlich es ist, dass Sie meine Nachricht eines fernen Tages erreicht haben wird, zumal ein in die Vergangenheit gesandter Brief gleichbedeutend damit ist, auch gegen die Unumkehrbarkeit der Zeit anzuschreiben. Und doch habe ich Grund zu der Annahme, mit dieser Botschaft den allzeit linear in die Zukunft voranschreitenden Zeitstrahl ausnahmsweise in die entgegengesetzte Richtung umkehren zu können.
In bewundernder Hochachtung verbleibt der Ihnen herzlich zugeneigte Leser
Marcel Matthies