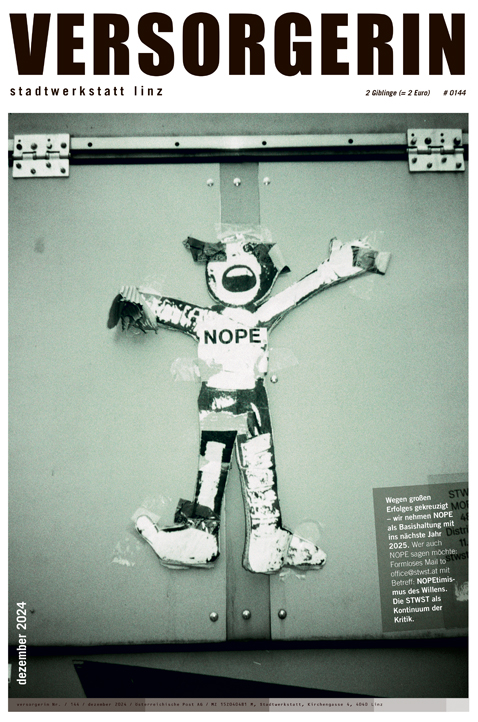Chris Weinhold: Herr Raddatz, Sie sprechen vom Anthropozän als Blackbox für die Theatertiere. Was hat es damit auf sich?
Frank Raddatz: Was mit dem Anthropozän auf die Welt zukommt, und damit auf die Künste, weiß niemand. Dieses Zeitalter setzt ein mit der Beschreibung von Paul Crutzen im Jahr 2000, als er verkündet, dass die Erdgeschichte erstmals angestoßen durch den Menschen in Bewegung kommt. Gemeint sind Prozesse wie der Klimawandel, das Schmelzen der Pole usw., die enorme Konsequenzen haben werden. Vielleicht lassen sie sich regulieren, aber die Gesellschaften reagieren im Augenblick kaum oder zu langsam darauf. Blackbox kann aber auch eine Chance meinen, denn die Erde erscheint jetzt als ein von lebendigen Wirkmächten überzogener Planet namens Gaia.
Kürzlich gastierten wir mit Anwälte der Natur vom Theater des Anthropozän im Hamburger Schauspielhaus. In der anschließenden durchaus kontroversen Diskussion mit Professor*innen der Universität Hamburg, herrschte in einer Hinsicht Konsens: Wir befinden uns am Beginn eines kosmologischen Wechsels. Heute leben wir auf einem Planeten, der Sphären hat und zwar auf einer kleinen Kruste, die räumlich ziemlich beschränkt ist. Ein paar Kilometer hoch und wenige Kilometer in die Tiefe. Die Sphärenbewohner sind von den Sphären, also Atmo-, Hydro-, Bio- , Pedosphäre usw. vollkommen abhängig. Wir wissen weder im Guten wie im Bösen, was diese neue kosmologische Verortung für Implikationen beinhaltet. Jedenfalls vollzieht sich ein umfassender Paradigmenwechsel bezogen auf die Kultur und die Zivilisation, der epistemisch motiviert ist. Aus Objekten, also den Flüssen, Wäldern, Tierarten werden Aktanten, Quasi-Subjekte, Wirkmächte. Diese Perspektivierung besitzt eine Nähe zum indigenen Denken oder den Überresten schamanistischen Denkens in der Antike, wo der Fluss nicht als Wasserstraße, also etwas Totes gesehen wird, sondern als Akteur. Es gab eine verschollene Tragödie, in der ein Fluss in Streit mit Herakles gekommen ist und gegen ihn kämpft. Die Metamorphosen von Ovid behaupten eine Verwandtschaft von menschlichen und nicht-menschlichen Subjekten wie Bäumen oder Blumen, in die sich die Protagonisten verwandeln. Der Text demonstriert die Aufladung des Nicht-Menschlichen mit Subjektivität. Wie diese Erdenbürger in nicht-menschlicher Gestalt auf die Bühne kommen, ist eine technisch hoch reizvolle Frage.
Chris Weinhold: Sie zitieren Heiner Müller über die Weisheit der Märchen, »dass die Geschichte der Menschen von der Geschichte der Tiere (Pflanzen, Steine, Maschinen) nicht getrennt werden kann außer um den Preis des Untergangs«. In den Märchen ist es der Normalfall, dass z.B. Hunde, Katzen, Bäume und Menschen miteinander handeln.
Frank Raddatz: Das ist genau der Punkt, über den wir jetzt reden, also über den Augenblick, wo sich die westliche Kultur in die strikte Subjekt-Objekt-Spaltung hineinbegeben und die lebendige Beziehung zu dem nicht-menschlichen Leben aufgegeben hat. Vor ein paar Jahren wurde ein Baum auf dem Hof vor meiner Wohnung abgesägt. Ein Nachbarsjunge kam aus der Schule und fing, sobald er den gefällten Baum sah, an zu weinen. Ich fand es signifikant, dass dieser Junge so eine intensive Verbundenheit mit diesem Baum fühlte. Er lernt diese Verbundenheit ja nicht in der Schule. Es ist ein ganz normaler Gestus in seinem Alter, sich mit Tieren und Pflanzen und sonst was verbunden zu fühlen, der einem im Zivilisationsprozess abtrainiert wird. Wenn wir diese Art Beziehung wieder gewinnen, können wir in eine andere Art der Existenz oder der Zivilisation oder Kulturform springen und bekämen unverbrauchte Optionen, anders zu denken oder eine bessere Kunst zu machen. Müllers starke Formulierung stammt aus den 80er-Jahren. Er hat ein Potenzial gesehen, das uns erst 40 Jahre später so richtig aufgeht. Darin ist er Beuys verwandt.
Chris Weinhold: In Ihrem Buch Drama des Anthropozän schreiben Sie, dass es – wie im Märchen – hilft, den wahren Namen des Gegenübers zu kennen und es auch für das Theater entscheidend ist, seine Kartografierungen immer wieder zu aktualisieren. Was bedeutet es, wenn sich das Theater auf »Gaia« bezieht?
Frank Raddatz: Das impliziert, mit epistemischen Systemen zu arbeiten, die viele alte Gewissheiten in Frage stellen. Vor einer Generation hätte wohl niemand an der Bedeutung von Galileo Galilei für den Fortschritt gezweifelt. Dann proklamiert Bruno Latour die anti-kopernikanische Wende und sagt sinngemäß: »Das war eine vollkommen falsche Verortung, weil der Planet kreist zwar um die Sonne, aber das machen auch zahllose andere Volumina im Raum. Das Entscheidende ist dagegen, dass unser Planet Leben hervorgebracht hat und darauf müssen wir uns um den Preis des Überlebens sensibilisieren. Das ist die Qualität, die Gaia auszeichnet!« Wie können wir aus dieser Perspektive das Theater verstehen? Wir erkennen einen anthropologischen Bruch. Die schamanistischen Traditionen zeigen, dass sie auf einem Begriff des Sozialen beruhen, der auch die nicht-menschlichen Gegenüber inkludiert, dass der Baum oder ein Tier oder was auch immer auch eine lebendige Persönlichkeit ist, mit der man kommunizieren kann.
Dann setzt der anthropozentrische Bruch ein. Fortan heißt es: Nur der Mensch zählt. Alles Nicht-Menschliche existiert nur als entseeltes Objekt. Im antiken Griechenland wird diese Umwertung der Werte als Fehde zwischen Platon gegen Homer bezeichnet. Platon sagt: »Das ist alles Quatsch mit diesen Göttern und Verwandlungen, was zählt, sind die Ideen und die bleiben immer gleich.« Oder das Credo von Protagoras: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge.« Damit setzte der kulturgeschichtliche Umbruch ein. Diese Art von Denken ging von den Städten aus. War das Soziale zuvor durch das Zusammenleben der Menschen in Kommunikation mit dem Nicht-Menschlichen definiert,
zu dem signifikant das Dionysische gehört, verändert sich das alte Kulttheater nun in eine Tradition des Schauspiels, wo das Soziale
nur noch aus Interaktionen zwischen Menschen besteht. Wird aber Gaia in den Diskurs eingeführt, gelangen wir an den Punkt einer kulturhistorischen Revision und sehen die Wurzeln des Theaters in einem anderen Licht.
Die ästhetische Frage ist also, wie lässt sich das, was in antiken Tragödien, in Mythos oder Märchen verhandelt wurde, in das 21. Jahrhundert transferieren, sodass sich der Anthropos auf überzeugende Weise als Aktant im Netz des Lebens erkennt.
Chris Weinhold: Sie sagen, dass Heiner Müller bereits vor 40 Jahren diesen anthropozentrischen Bannkreis überschritten hat und führen das Moment der Landschaft in seinem Stück Der Auftrag an: »Mit jedem Herzschlag der Revolution wächst Fleisch zurück auf ihre Knochen, Blut in ihre Adern, Leben in ihren Tod. Der Aufstand der Toten wird der Krieg der Landschaften sein, unsre Waffen die Wälder, die Berge, die Meere, die Wüsten der Welt. Ich werde Wald sein, Berg, Meer, Wüste.«
Frank Raddatz: Eine großartige Stelle von Müller, Ende der 70er-Jahre, wo er ein politisches Subjekt konstruiert, das seine Identität aus der Landschaft bezieht. Das ist eine ganz andere Definition eines politischen Subjekts, das sich allein im Sozialen verortet. Ein neues Kapitel des politischen Theaters; die Fortsetzung der gescheiterten Revolution durch ein Bündnis mit der Erdgeschichte. Nur, wie gewinnen solche Sequenzen Gestalt?
Chris Weinhold: Boris Groys sieht im Künstler einen Doppelagenten am Werk, der zwar die Tradition der Kunst erhält, weil er sie in seiner Zeit aufhebt, doch mit dem Ziel, die Gegenwart zu transzendieren. Kann Kunst Zukunft schaffen?
Frank Raddatz: Keine Zukunft ohne Vergangenheit, sagt Müller. Die Bühne will seit den Tagen Lessings oder der Weimarer Klassik bis hin zu Brecht und Sarah Kane, Zukunft generieren, die Zukunft beeinflussen. Das geht aber nicht mit naturalistischen Formen, die historisch kaum eine Rolle gespielt haben. In der antiken Tradition wurde hinter Masken gespielt, denen im Kult eine zentrale Bedeutung zukommt. Im Shakespeare-Theater saßen privilegierte Zuschauer direkt auf der Bühne.
Letztes Jahr habe ich mehrere Teile eines Hörspiels mit dem Titel Konferenz der Flüsse verfasst, die vom Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Darin kommt kein einziger Mensch als Akteur vor. Stattdessen debattieren Flüsse miteinander über ihr Schicksal und den Lauf der Welt. Die Reihe kam sehr gut an. Offenbar ist das Medium sehr geeignet, weil die Protagonisten nicht visualisiert werden. Abgesehen davon, dass der Regisseur Leopold von Verschuer alle Register seines Könnens gezogen hat.
In einer Szene in Zirkus der Bäume tritt ein Liebespaar auf. Er ist ein Papagei, geführt von einem Puppenspieler, und sie ist eine Menschen-Frau. Eine Souffleuse, während er beim Kinderkanal als Kleindarsteller arbeitet. Sie suchen eine Wohnung, haben aber angesichts der Mieten zu wenig Geld und so ziehen sie in ein Baumhaus. In eine Baumhöhle, die ein Specht gebaut und wieder verlassen hat. In der zweiten Szene ist sie schwanger von dem Papagei, der sich als ziemlich ekelhafter Typ entpuppt. Plötzlich gibt es Lärm an dem Baum. Eine Demonstration. Sie ergattert ein Flugblatt und begreift, dass der Baum gefällt werden soll, weil dort Häuser gebaut werden. Sie bekommt einen Nervenzusammen-bruch. Plötzlich klopft jemand. Ein Anwalt der Natur, der die Rechte der Bäume vertritt. Ebenfalls eine Puppe. Schließlich kommt auch noch eine Vertreterin der Baugesellschaft Wohnen im Grünen. Dann streiten sie sich und wollen vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Auf dieser surrealen und dezidiert anti-naturalistischen Ebene lassen sich die Inhalte mit großer Leichtigkeit transportieren. Darum geht es eigentlich auf dieser Bühne: Möglichkeits- und Freiheitsräume zu eröffnen und nicht die Routinen des Spielbetriebs zu bedienen. Dann kann problemlos ein wissenschaftlicher Vortrag neben einer surrealistischen Szene stehen mit eigens von Kevin Mooney komponierten und von ihm vorgetragenen Songs. Das ist ein Versuch, Zukunft zu generieren. Mal sehen, ob die Zukunft antwortet. Aber auf jeden Fall muss sich eine derartige Bühne vom Gegenwartswahn und seinen Verblendungen befreien.
Chris Weinhold: Worauf bezieht sich Ihre Kritik eines Gegenwartswahns? Um was für eine Verblendung handelt es sich?
Frank Raddatz: Der ökologische Diskurs tut in der Regel so, als wären das Klimadesaster und andere ökologische Krisen vom Himmel gefallen: Eines Tages schmelzen die Pole und es ist zu viel CO2 in der Luft. Unsere Beziehung zur sogenannten Natur, die auch immer kulturell geprägt ist, resultiert aus historischen Weichenstellungen. Das Gilgamesch-Epos, etwa 6000 Jahre alt, erzählt, dass der Baumkönig erschlagen wird und welche Rückkopplungen dieser Gründungsakt der Naturbeherrschung bewirkt. Schon erste Aufzeichnungen der Kulturgeschichte reflektieren diese Ambivalenz, die einen wichtigen Baustein in unserer Präsentation Requiem für einen Wald bildet. Dieses Bewusstsein um die Interdependenzen, die unser Verhalten auslöst, wurde kulturhistorisch vom Anthropozentrismus abgelöst und muss jetzt wiedergewonnen werden.
Unsere Produktion Anwälte der Natur über die Rechte der Natur, wie sie nicht-menschliche Akteure in einigen – zumeist nicht-europäischen – Ländern besitzen, beginnt mit einem Rekurs auf das alte Ägypten. Dort herrschte ein vollkommen anderes Rechtsbewusstsein als in Rom. Leute wurden hingerichtet, weil sie eine Katze getötet hatten. Das galt selbst für römische Diplomaten. Seneca und Hegel regen sich darüber auf. Wir sehen, dass Rechtsauffassungen, die wir für Selbstverständlichkeiten halten, historisch bedingt sind, womit die Phantasie angeregt wird, eigene Entwürfe für die Zukunft zu wagen.
Chris Weinhold: Mit Bezug auf Christoph Türckes Philosophie des Traums beschreiben sie, dass der Mensch ein traumatisiertes Wesen ist, weil er vom gehetzten Tier, das in der Wildnis dauerhaft bedroht war, sich zum hetzenden Tier oder naturbeherrschenden Menschentier entwickelt hat: vom Opfer zum Täter, könnte man sagen. Muss der Mensch also immer weiter draufschlagen, aus Angst erschlagen zu werden?
Frank Raddatz: Ich finde, eine ökologische Bühne muss die anthropologischen Wurzeln mitreflektieren. Vielleicht unterliegen wir tatsächlich einem Wiederholungszwang. Die schamanistischen Gesellschaften hatten ein intaktes Verhältnis zur Natur, aber kein friedfertiges. Untersuchungen erweisen, dass viele Großtiere um 10.000 vor Christi ausgerottet wurden. Da war bereits eine Kraft am Werk, die sich als Vorläufer unserer Vernichtungsfeldzüge gegen die Biodiversität identifizieren lässt. Wir müssen uns unbedingt über unsere kulturelle Hardware aufklären, wenn wir das Anthropozän meistern wollen. Falls da ein Urtrauma wirkt, sollte es zumindest benannt werden. Nur dann können wir darauf Einfluss ausüben, also im Sinne von Klaus Heinrich eine Zivilisation schaffen, die sich über sich selber aufklärt.
Die Götter konnten sich zwar verwandeln, wie Dionysos, der als Theatergott auf offener Bühne die Gestalt eines Stiers annimmt, aber die Welt der Metamorphose strotzt von Gewalttaten, wie Euripides‘ Bacchien zeigen. Das Identitätsdenken, das auf Platon zurückgeht, der postuliert, dass die Realität aus Erscheinungsformen besteht, die einen ewigen Kern haben, eben die Idee, besitzt ebenfalls etwas Gewaltsames. Platons Denken richtet sich gegen die Metamorphose zugunsten eines Identitätsdenkens A = A; ein Drittes, also Mischformen sollen nicht sein. Dagegen negiert das Denken der Verwandlung dieses tertium non datur, das alles exkludiert, was sich der Identität nicht fügen will.
Chris Weinhold: Das heißt, man bringt eine Kritik der Gewalt, eine Kritik des Opfers und des Opferns auf die Bühne?
Frank Raddatz: Unsere kulturgeschichtlichen Rückblicke zeigen, dass es keinen paradiesischen Zustand gab, den man gegen den zivilisatorischen ausspielen kann.
Die aktuelle Situation ist entstanden, weil bereits gewaltaffine Kulturen und Zivilisationen mit Wissenschaft und Technik aufgerüstet wurden. Ohne diese Instrumente wären die aktuellen Verwerfungen nicht möglich. Es handelt sich um Nebeneffekte der Technosphäre. Wie Elisabeth Kolbert formuliert, haben wir es aktuell mit der Reparatur der Techniken der Naturbeherrschung zu tun. Wir haben auch keine andere Möglichkeit, als mit Wissenschaft die von ihr ausgelösten Rückkopplungen einzufangen. Damit befinden wir uns in einer quasi magischen Situation: Nur der Speer, der die Wunde schlug, kann sie heilen!, heißt es bei Wagner, also allein die Wissenschaft, die Technologie, die Klimakatastrophe verursacht hat, kann sie regulieren. In diesem Paradox sind wir anscheinend gefangen.
Neben der anthropologischen Dimension handelt es sich beim Theater des Anthropozän auch um ein Wissenschaftstheater. Eine derartige Bühne gibt es seit Brecht, der von einem Theater für die Kinder des wissenschaftlichen Zeitalters spricht und damit ein szenisches Spiel meint, das in vielerlei Hinsicht auf Kausalität beruht. Dabei wird sein Theater auf ein Naturbild gesattelt, das auf Ausbeutung beruht, soll doch der Schlüssel in der gerechten Distribution der durch Ausbeutung der Natur generierten Güter liegen. Dagegen lässt sich einwenden, dass die Ausbeutung der Natur und die Ausbeutung des Menschen nicht voneinander zu trennen sind. Heute fragt sich, wie ein Wissenschaftstheater aussieht, das nicht auf einem unendlichen Fortschritt und grenzenlosen Verfügungsräumen beruht, sondern den kosmologischen Wechsel mitdenkt.
Chris Weinhold: Sie sprechen von wissenschaftlich dionysischen Tanzplätzen. Wie kann man sich das vorstellen?
Frank Raddatz: Ein Wissenschaftstheater kann sehr schnell langweilig und belehrend wirken. Alleine ins Theater zu gehen, um etwas über die zukünftige Rolle der Stadtbäume zu erfahren, ist eine Zumutung. Aber unsere Partner in der Wissenschaft unterstützen uns gerade, weil wir Erkenntnisse und Fakten vermitteln, die in ihren Forschungen relevant sind. Daher treten im Theater des Anthropozän in jeder Vorstellung Wissenschaftler und Experten auf. Das können Förster*, Kuratoren*, Richter*, Anwälte*, Gartenbauerinnen etc. sein, die stehen neben Vertreter*innen von Musik, Schauspiel, Tanz, Inklusionstheater, Puppenspiel, Videokunst. Es geht uns also nicht um eine bestimmte Form, sondern das jeweilige Thema wird mit den verschiedensten Mitteln bearbeitet. Ich nenne das spektrale Ästhetik. Brecht unterscheidet Unterhaltungswert und Lehrwert. Wenn ein realer Wissenschaftler in einem Pandabärkostüm auf die Bühne tritt und über Stadtbäume spricht, beginnen sich diese Gegensätze zu vermischen. Dass die Wissenschafts-uniform abgelegt wird und stattdessen die Ikone der ökologischen Bewegung ins Feld geführt wird, geht weit über die öden Konventionen der Wissenschaftsvermittlung und Wissenschaftskommunikation hinaus. Zugleich wird damit die Frage nach dem Subjekt der ökologischen Transformation angeschnitten. Dieser Unterhaltungswert grundiert also das diskursive Moment. Das Publikum soll nicht deprimiert nach Hause geschickt, sondern motiviert werden. Diese Aktivierung, der zentrale Punkt des politischen Theaters, verlängert den alten Brecht’schen Gedanken, dass der Zuschauer aus einer Passivität herausgerissen werden muss. In diesem Zusammenhang steht Brechts Votum, dass das Theater nur eine Berechtigung hat, weil es Spaß macht. Das geht auf Nietzsches Konzept einer fröhlichen Wissenschaft zurück, mit der Nietzsche seinen wagneraffinen Tragödiendiskurs torpediert. Das Heroische wird durch das Lachen als Gegenmittel ausgehebelt, in dessen Kontext Nietzsche vom dionysischen Unhold Zarathustra spricht. Das Lachen und das Dionysische werden zusammengezogen und gegen das Pathos in Stellung gebracht. Und das ist auch der Urgrund meiner Bühne.
Chris Weinhold: Brecht plädiert aber auch für die ernsthafte Vermittlung eines Gegenstandes mittels des kalten Blicks, wie er das nannte, und macht auch einen bösen Buben aus, nämlich den Kapitalismus.
Frank Raddatz: Aber die Option des Lachens darf nicht unterschätzt werden. Brecht handelt in Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui den deutschen Faschismus am Beispiel einer Bande ab, die den Blumenkohl-markt monopolisiert. Da werden die kapitalistischen Gesetze vorgeführt, aber als Groteske. Brecht bezeichnet das Dritte Reich mitunter als Bayreuther Republik. Der Antipode ist Wagner und das Heroische.
Chris Weinhold: Bleiben wir beim Kapitalismus. Ist der Green Deal auch eine Groteske? Sie beschreiben ihn als »eine Synthese wie aus alten hegelianischen Zeiten, in der ökonomische und ökologische Vernunft profitabel zusammenfließen. Die Naturzerstörung ist in diesem Fall ein in die wirtschaftlichen Operationen einzupreisendes Element, das den planetarischen Realitäten Rechnung trägt, in der Regel zu Ungunsten der sozial Schwachen«.
Frank Raddatz: Der Traum Europas von einem grünen Kapitalismus bröckelt gerade, weil die populistischen Parteien Zulauf haben, die sich derartigen Lösungen verweigern. Ich habe in den USA einen verzweifelten Wissenschaftler kennengelernt, der meinte: »Man kann nicht darüber abstimmen, ob die Erde eine Scheibe ist!« Als junger Mensch konnte ich mit Hegels Definition von Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit nicht viel anfangen. Aber vor diesem Horizont gewinnt sein Bonmot, auf die Frage, was wäre, wenn Realität und Idee nicht übereinstimmen: »Um so schlimmer für die Wirklichkeit!« an existentieller Tragweite.
Chris Weinhold: Sie meinten einmal, man müsse die Ökologie den Grünen entreißen.
Frank Raddatz: Diese Partei ist mit der politischen Ökologie völlig überfordert. Es gibt keine philosophische Einordnung. Baerbock und Co haben noch nie von Michel Serres, Donna Harraway oder Bruno Latour gehört. Bruno Fücks will grüne Politik aus einer liberalen Moderne hervorgehen lassen. Habeck ordnet seine politische Agenda explizit dem Fortschritt unter. Das ist doch vollkommen irre. Die gesamte ökologische Misere ist Resultat eines quasi-religiösen Fortschrittsglaubens, wie er die Moderne auszeichnet. Das ist ein ganz trauriges Kapitel: der Knoten jeder politischen Ökologie, der unbedingt geschnürt werden muss.