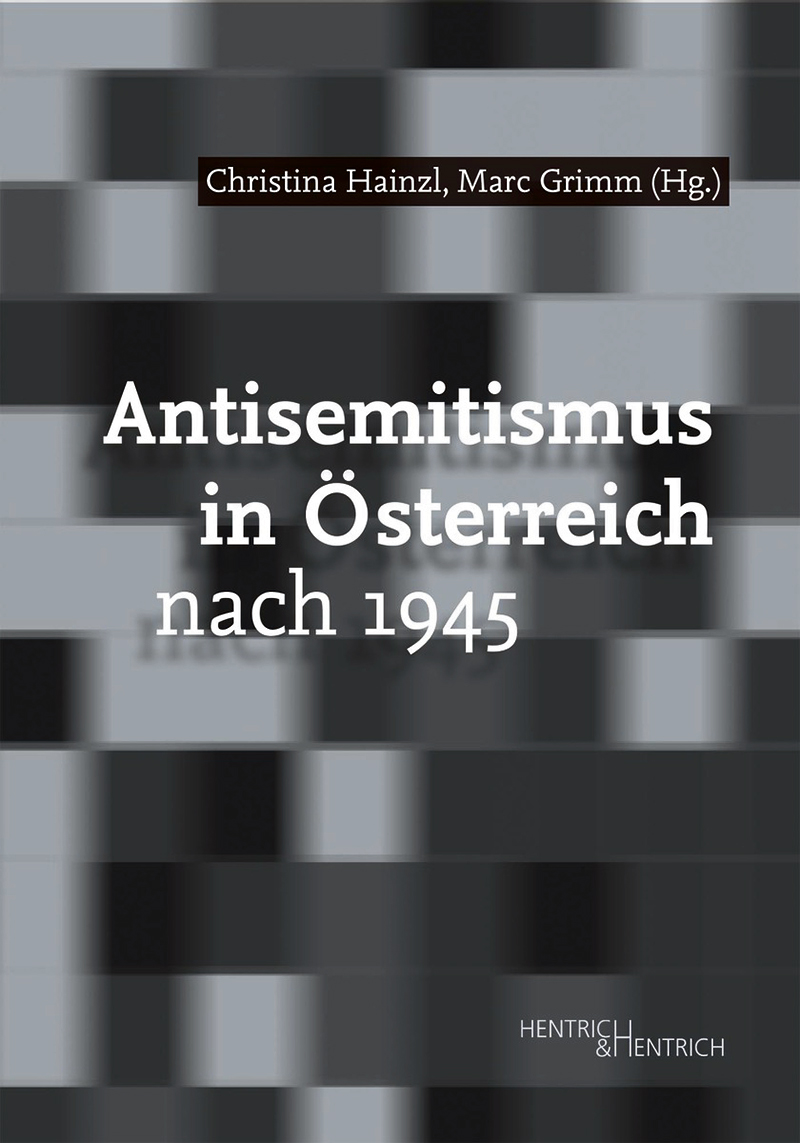Die Historikerin Christina Hainzl und der Politikwissenschaftler Marc Grimm haben einen Sammelband veröffentlicht, der den Antisemitismus in Österreich in seinen verschiedenen Ausprägungen nach 1945 untersucht. Den Ausgangspunkt bilden 30 Interviews, die Hainzl mit österreichischen Jüdinnen und Juden zu »Jüdische[m] Leben in Österreich« geführt hat. Trotz der geringen Stichprobe zeigen sie eindrücklich, dass antisemitische Ressentiments weit verbreitet sind. Fachlich fundiert informieren die Beiträge über die Ursachen und Spezifika des Antisemitismus in Österreich.
Barbara Serloth fokussiert in ihrem Beitrag die Regierungsstrukturen im Nachkriegsösterreich und fragt danach, wie diese das entstehende Opfernarrativ begünstigten. Anders als Deutschland, das den schmachvollen Weg des Eingestehens und anschließend den des »Erinnerungs-weltmeisters« gehen musste, war Österreich in der Lage, sich als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen: Der Anschluss an Deutschland wurde zur Okkupation erklärt. Serloth arbeitet die Voraussetzungen für die Entstehung des Opfer- und Kontinuitätsnarrativs heraus und setzt hierzu bei der politischen Elite der Nachkriegszeit ein.
Diese konnte im Österreich der Nachkriegszeit auf einen latenten Antisemitismus der Gesamtbevölkerung und des gesellschaftlichen Diskurses bauen, der alle Verantwortung und Restitutions- sowie Reparationsansprüche als ungültig erachtete. Diese Form des »demokratisch legitimierten legislativen Antisemitismus« war der österreichischen Nachkriegspolitik eingeschrieben und ermöglichte, sogenannte Ehemalige im »Verbotsgesetz 1945«, das die Registrierungspflicht aller NSDAP-Mitglieder vorsah, zu verschonen, sofern sie nur diese Zugehörigkeit »niemals missbraucht« hatten. Damit war eine täterfreundliche Abwicklungspolitik der eigenen Involvierung in den NS auf den Weg gebracht, die die Entnazifizierung als »Pflichtprogramm« und nicht als moralisch gebotene Notwendigkeit betrachtete. Antisemitische Traditionen mussten in der österreichischen Gesetzgebung keinen Abbruch fürchten, stattdessen wurden sie an die neue demokratische Verfassung angepasst.
Welchen politischen Strategien für die antisemitische Agitation nutzbar gemacht wurden, untersuchen Karin Bischof und Marion Löffler anhand von Nationalratsdebatten der Nachkriegszeit. Sie unterscheiden vier rhetorische Cluster, die jeweils den Stand der gesellschaftlichen Aufarbeitung reflektieren: Bis 1955 diente der Antisemitismus als sozialpartnerschaftlicher Kitt (1), der Spannungen zwischen Parteien, Linken und Rechten, »zum Wohle des Volkes« überdeckte. Nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der Alliierten folgte die Phase der Verleugnung und Verharmlosung (2): Das Ansehen Österreichs im Ausland stand noch immer parteiübergreifend im Zentrum und konnte auch durch die antisemitischen Auslassungen Taras Borodajkewycz’, die Schiller-Feiern oder den Frischenschlager-Reder-Handschlag nicht erschüttert werden. Erst die Waldheim-Affäre (3) erwirkte ab 1986 eine Debatte, die das österreichische Opfernarrativ auch im Parlament infrage stellte. Die Dialektik dieses Aufarbeitungsprozesses, der, nach Waldheim, Opfermythos und NS-Schuldabwehr sukzessive öffentlich tabuisierte, bildet eine neue Form des Antisemitismus heraus, der sich in Form von Verhetzungsvorwürfen (4) bzw. der Rede von der »Nazi- und Faschismuskeule« artikuliert und im israelbezogenen Antisemitismus Ausdruck findet.
Dieser ist auch für Florian Markl bei seiner Betrachtung der (Print)Medien vorherrschend. Ben Dagan wiederum sieht jene Printmedien längst im Verfallsprozess. Während diese für das Zeitalter der Nationalstaaten mit auf diese begrenzte Sprachräume stehen, sorgen inzwischen neue, »Soziale Medien« für eine tendenzielle Entgrenzung des Diskurses. Dagan zeigt, wie fragmentierte Echokammern sich anschicken, das gesellschaftliche Tabu des Antisemitismus weiter zu unterhöhlen.
An diesem Muster bzw. an dieser rhetorisch-strategischen Anpassung antisemitischer Artikulation kommt keine gesellschaftliche Gruppe – ob links, rechts oder religiös – vorbei. Das antisemitische Ressentiment mag dasselbe bleiben, aber seine Ausdrucksform muss stets – je nach politisch-gesellschaftlicher Gemengelage – seine Wandelbarkeit unter Beweis stellen. Beispiele, ob bei FPÖ, Katholiken oder Linken, bietet der Band in Fülle.
Zwar überwindet die antisemitische Rhetorik spielend leicht alle Parteigrenzen, doch taten sich Vertreter der FPÖ respektive des VdU (Verband der Unabhängigen) darin besonders hervor. Antisemitismus gehörte hier neben Antikommunismus, Deutschnationalismus und Antiamerikanismus zum guten Ton, Juden wie Alliierte waren Feindbild. Der VdU diente unmittelbar nach Kriegsende als Sammelbecken für »minderbelastete« Nationalsozialisten, nach »abgeschlossener« Entnazifizierung 1956/57 dann auch für »Belastete«. Personelle Überschneidungen waren gang und gäbe, und aus der informellen Nähe verschiedener revisionistischer Vereine wurde nach Rehabilitation der »Ehemaligen« kein Hehl gemacht. In ihren Reihen lebte der Nationalsozialismus buchstäblich über 1945 hinaus fort, was sich in der Binnenkommunikation der Partei zeigte wie auch im Parteiumfeld, in dem martialische Sonnenwendfeiern, Gedenkfeiern für »NS-Helden« und Veteranentreffen abgehalten wurden; oder in der Schiller-Feier 1959, auf der der verbotene Bund Heimattreuer Jugend auftrat.
VdU und FPÖ bildeten also in einer Zeit, die von antisemitischer Schuldumkehr und dem Narrativ Österreichs als »erstem Opfer« geprägt war, zweifellos den antisemitischen Bodensatz der Gesellschaft, gespeist aus ehemaligen Nazis, fern davon, die antisemitischen Ressentiments zu verkleiden.
So wie Löffler und Bischof die Wandlungs- bzw. Anpassungs-fähigkeit antisemitischer Rhetorik dechiffrieren, so tut es Helga Embacher mit jener der FPÖ. Zwar war die Partei bis in die 2010er Jahre auf diese Rhetorik angewiesen, entdeckte dann aber unter Heinz-Christian Strache und im Bündnis mit anderen rechten Parteien den Anti-Antisemitismus als neue politische Strategie.
Um die strikte Kursänderung der Strache-FPÖ hin zu einem projüdischen Kurs und weg vom Haider’schen Vulgär-Antisemitismus nachzuvollziehen, setzt Embacher im Nachgang der Waldheim-Affäre an. Hier erwachte die Zivilgesellschaft: Die Grünen zogen ins Parlament ein, Österreichs Opferthese wurde revidiert. Damals übernahm auch Jörg Haider die FPÖ und polarisierte mit antisemitischen (KZ als »Straf-lager«; »ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich«; Bezeichnung von Waffen-SSlern als »Anständige«) und rassistischen Auslassungen. Zudem diente er sich antisemitisch geprägten palästinensischen Organisationen an und ließ keine Möglichkeit aus, alles Jüdische und Amerikanische zum Feindbild zu stilisieren.
Die proarabische und antiisraelische Haltung wurde nach der Wahl Straches zum Vorsitzenden der Partei noch mitgetragen: Im Libanon-krieg 2006 sagte man der Hizbullah Unterstützung zu; noch 2008 gab die FPÖ die Schrift »Wir und der Islam« heraus. Erst mit einer Strache-Reise nach Israel, begleitet von anderen rechten Parteivorsitzenden Europas, änderte sich die ideologische Ausrichtung: Israel wurde zum Partner im Kampf gegen den fundamentalistischen Islam erklärt.
Dass diese Bezugnahme eine rein instrumentelle ist, wird daran deutlich, wie FPÖler, der Partei Nahestehende oder Strache selbst antisemitische Posts, Veröffentlichungen oder Aussagen verfassen, die eine antisemitisch eingestellte Wählerbasis nicht verschrecken sollten. Und wenn die Diskussion in der antisemitismuskritischen Linken auch in Deutschland, ob und inwiefern man mit rechten Antisemitismuskritikern zusammenarbeiten solle, dadurch nicht beantwortet wird, lässt die FPÖ-Fähigkeit zur politischen Inanspruchnahme des Antisemitismus bzw. seiner Bekämpfung aufscheinen, auf welch tönerne Stütze diese Israelsolidarität sich begibt.
Die Beiträge von Bernhard Weidinger, der sich dem Antisemitismus der Studentenverbindungen in Österreich widmet, von Matthias Falter, der die postnazistische Transformation des katholischen Antisemitismus ins Private untersucht und von Stephan Grigat, der auf die (postnazistische) österreichische radikale Linke und insbesondere auf ihr Verhältnis zu Israel schaut, treffen sich im Motiv, je nach politisch-gesellschaftlicher Gemengelage die Strategie aufzudecken, die den Antisemitismus dieser Gruppen kennzeichnet. Was sich bestätigt ist, dass antisemitische Artikulation weder an politischen noch an religiöse oder kulturelle Milieus gebunden war und ist. Als antisemitische Akteure erwiesen sich seit jeher auch Intellektuelle: Während die NSDAP 1930 in Österreich auf drei Prozent der Stimmen kam, holte das studentische Äquivalent, der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, bereits 1930 die Hälfte aller Mandate.
Diese milieuunabhängige Anfälligkeit macht auch vor der muslimischen Community Österreichs nicht halt, wie Mouhanad Khorchide analysiert. Insbesondere die Muslimbruderschaft und Millî Görüş vertreten eine Strategie des Legalismus, der sich oberflächlich den demokratischen Werten verschreibt, gleichzeitig aber andere ideologische Ziele verfolgt. Khorchide traut diesem instrumentellen Bekenntnis zur Demokratie dementsprechend nicht – und wirbt für eine besser überprüfbare Integration der muslimischen Verbände.
Antisemitische Einstellungen in der arabisch-muslimischen Community untermauert Khorchide auch empirisch – und leitet damit eine ganze Reihe empirisch fundierter Beiträge ein, die Hasan Softicˇ für die bosnisch-muslimische Community weiterführt, Bernadette Edtmaier anhand Jugendlicher expliziert und Heinz P. Wassermann für das Österreich der vergangenen 50 Jahre analysiert. Während Wassermann einige Dutzend Erhebungen dieses Zeitraums technisch zusammenbringt, sodass es dem Leser am Ende schwerfällt, aus diesem – wenn auch verdichteten – Material eine sinnvolle Erkenntnis abzuleiten, verfährt Softicˇ anders: Seine Interviews kommen mit deutlich weniger Material aus, und sind offen geführt. Das ist deshalb so viel erhellender, weil aus den Antworten der Befragten – die migriert sind als sogenannte Gastarbeiter:innen ab den 1960er Jahren oder im Zuge des Krieges Anfang der 1990er Jahre bzw. in späterer Generation in Österreich geboren wurden – oftmals eine ganz naive, unreflektierte Sicht auf das Thema spricht. Diese Schilderungen übernimmt der Autor zurecht nicht als empirische Befunde – in ihnen kristallisiert sich jedoch heraus, wo ganz basale politische Bildungsarbeit ansetzen müsste.
Während persönliche Bezüge zu Jüdinnen und Juden durchweg positiv erinnert werden, werden sie gleichzeitig Ideologemen einer teils konterkarierenden, teils auf einer anderen, abstrakteren (un)verhandelten Ebene (bspw. der der Religion) nebenangestellt. Diese abstrakt-antisemitischen Gedanken sind in ihrer Kontrafaktizität aber ganz deutlich Bruchstücke, die sich aus gängigen Klischees ergeben, (noch) ohne die überzeugende Fähigkeit der Befragten, ihnen fundiert auf den Grund zu schauen oder sie zu verwerfen.
Wer sich einen Überblick über die Geschichte des Antisemitismus in Österreich nach 1945 verschaffen will, kommt an diesem Sammelband nicht vorbei. Die pränazistisch-ideologische Substanz des (kulturellen) Katholizismus, die unmittelbare Nachkriegsphase mit der Entstehung des Opfernarrativs sowie die verspätete Aufarbeitung im Zuge der Waldheim-Affäre in den späten 1980ern dienen hierbei als Fixpunkte, um die herum der Antisemitismus in Österreich in seinen verschiedenen Artikulationsformen seziert wird. Wünschen würde man sich bisweilen die stärkere Rückbindung der einzelnen Phänomene an die jeweilige gesellschaftliche Debatte. So bleiben insbesondere die empirischen Beiträge wie auch der filmanalytische Artikel von Klaus Davidowicz in Teilen deskriptiv. Die Vernachlässigung dessen, dass aber besonders Kulturgüter in und aus einem spezifischen gesellschaftlichen Verhältnis entstehen – sei es nach Staatsvertrag und der Rehabilitation »Ehemaliger« oder nach der Waldheim-Debatte – und auch nur durch Rückbindung für die Analyse fruchtbar gemacht werden können (was auch für empirische Erhebungen gilt, deren Ergebnisse vor allem dann hilfreich sind, wenn klar wird, in welchem Diskursraum sie entstanden), schmälert die analytische Wirkmacht einzelner Beiträge etwas.