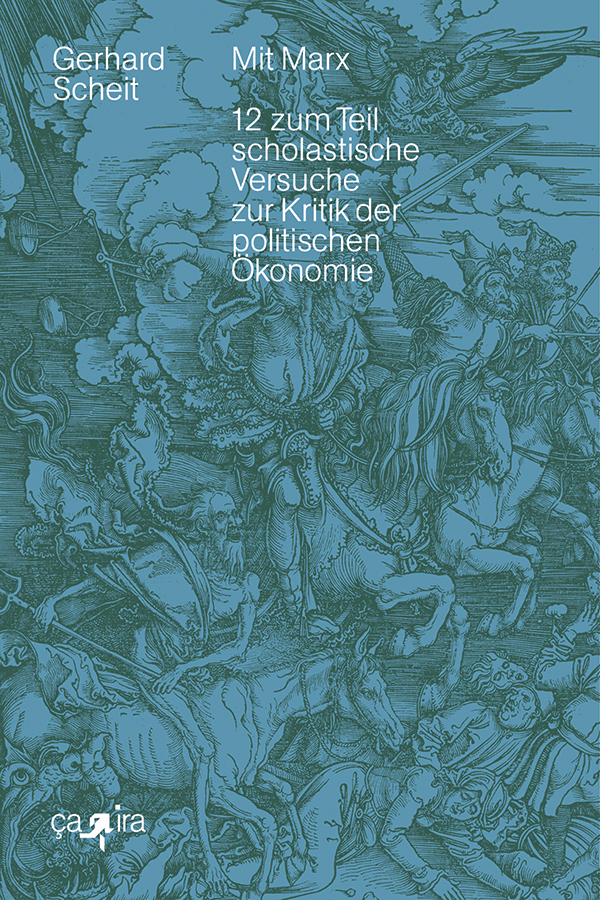Philip Zahner: Horkheimer hatte 1946 ein Gespräch mit Adorno über eine mögliche Fortsetzung der Dialektik der Aufklärung mit der Frage beendet: »Wieweit hat man an der Selbsterhaltung teilzunehmen und wieweit ist sie Wahnsinn?« Bei dieser Frage handelt es sich nicht nur um den zentralen Aufhänger deines neuen Buches. Sie sei, schreibst du, vielmehr gleichbedeutend mit der Frage, wie nach Auschwitz die Kritik der politischen Ökonomie als »Existentialurteil« zu entfalten wäre. So evident diese Engführung der Dialektik der Aufklärung mit der Kritik der politischen Ökonomie im Grunde auch ist, so irritierend unüblich scheint dieser Gedanke mit Blick nicht nur auf die, häufig auf eine bloße Historisierung von Marx hinauslaufenden, Rezeptionsgewohnheiten der Dialektik der Aufklärung, sondern auch mit Blick auf die geschichts- und erfahrungslosen Diskussionen innerhalb der Neuen Marx-Lektüre, doch gleichzeitig zu sein. Woher kommt diese merkwürdige Polarität, die sich zunehmend auch in ideologiekritischen Kreisen bemerkbar macht?
Gerhard Scheit: Ja, entweder man verwendet die Dialektik der Aufklärung dazu, von Marx Abschied zu nehmen und landet dann, wenn man irgendwie doch links und antikapitalistisch sein möchte, bei absurden Begriffen wie »postmodernem« oder »digitalem Kapitalismus«; oder man verwendet die Marxsche Kritik, um Adornos und Horkheimers Einsichten zu ignorieren und bleibt das, was Marx nie sein wollte: Marxist. Dabei, so meine Auffassung, hat Adorno die Negative Dialektik u. a. geschrieben, um das eine durch das andere neu zu bestimmen, die Dialektik der Aufklärung durch die Kritik der politischen Ökonomie und vice versa. Ihr erster Satz lautet: »Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward.« Es ist nicht zuletzt die Kritik der politischen Ökonomie, die in dieser Situation nach Philosophie verlangt. Du erwähnst kritisch die Neue Marx-Lektüre: sie hat aber hier immerhin auf konkrete Probleme hingewiesen, so vor allem Hans-Georg Backhaus, etwa darauf, an welchen Stellen Marx seine eigene Analyse um ihren philosophischen Sinn brachte, um sie populärer zu gestalten. Aber es stimmt: sie ist trotz vieler wichtiger Einsichten insofern gescheitert, als sie versäumt hat, am Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie die Konfrontation im deutschen Idealismus, insbesondere die der Hegelschen Dialektik durch die Kantische Transzendentalphilosophie freizulegen und fortzuführen, die bei Marx implizit stattfindet (das geschah dann eher bei Außenseitern wie etwa Peter Bulthaup). Ohne sich auf die Kritik der politischen Ökonomie in extenso einzulassen, hatte Adorno bedeutend mehr dafür getan, den Sinn für diese Konfrontation zu wecken, zunächst unter dem Einfluss Sohn-Rethels, später vermutlich angeregt von Karl Heinz Haag. Darin ging er dann auch über die Dialektik der Aufklärung hinaus.
Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch der paradox anmutende Untertitel deines Buches, der, im Zusammenhang mit der Anspielung auf den Essay als Form und das konstitutive Moment der Erfahrung, durch den leicht ironischen Bezug auf die Scholastik neben der geschichtsphilosophischen auch eine erkenntniskritische Perspektive eröffnet, die mit den einst metaphysischen Begriffen von Form und Substanz, nach den begrifflichen Voraussetzungen der Kritik der politischen Ökonomie fragt. Die Scholastik genießt allerdings einen schlechten Ruf, auch und gerade unter Marxisten, denen irgendwo von Fern die zweite Feuerbachthese im Ohr klingen dürfte. Es war Manfred Dahlmann, dem, angeregt durch Johannes Agnoli, jedoch der Zusammenhang zwischen dem Universalienstreit und Alfred Sohn-Rethels Erkenntniskritik in seiner ganzen Tragweite, auch für die »ver-rückten Formen«, voll »theologischer Mucken und metaphysischer Spitzfindigkeiten«, mit denen es Marx im Kapital zu tun bekommt, bewusst geworden ist. Es verwundert daher nicht, dass dein Buch fast durchweg auch eine Auseinandersetzung mit Sohn-Rethel darstellt, dessen Überlegungen, im Vergleich zu deinen früheren Arbeiten, in den letzten Jahren zunehmend an Gewicht gewonnen haben. Könntest du den angedeuteten Zusammenhang, der in der Neuen Marx-Lektüre Anathema ist und auch in der Kritischen Theorie nicht ausreichend expliziert wurde, etwas deutlicher machen?
Sohn-Rethel hat sich als sehr beharrlich in der Auffassung gezeigt, dass die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie – aller Anspielungen auf Hegelsche Begriffe ungeachtet – zunächst einmal mit Kant gelesen werden muss. Von dessen »radikalem Dualismus« ausgehend erkennt Sohn-Rethel in der Wertform eine Formbestimmung >a priori<, sie stellt eine Synthesis >a priori< dar, wie bei Kant die Denkform für die empirische Mannigfaltigkeit. Sohn-Rethel unterscheidet zwar dualistisch zwischen der Logik der Wertform und der Logik der Produktions-tätigkeit, und er hält fest, dass vom unmittelbaren Produktionsprozess in der Wertform eben nichts Konkretes, Physiologisches, mehr zurückbleibt – so wie eben im Transzendentalsubjekt von allem Mannig-faltigen, das nur mit ihm gedacht werden kann, nichts enthalten ist. Doch fetischisiert er seinerseits die Produktion durch die Annahme einer Eigenlogik, die er der Produktionstätigkeit unabhängig von den Subjekten zuschreibt. Hier lebt gewissermaßen – und ohne dass Sohn-Rethel es wahrhat – das Hegelsche Subjekt-Objekt fort, während eben das Kantische Transzendentalsubjekt durchaus richtig für die Wertform in Anspruch genommen wird.
Der Gegensatz zwischen den konkreten Privatarbeiten und der abstrakten gesellschaftlichen Arbeit, den Marx entdeckt hat, kann aber anders als durch eine gemeinsam beschlossene Unterstellung der Vertragspartner, die sie im Vertrag selbst niederlegen, gar nicht vermittelt werden. Das heißt: der sich selbst verwertende Wert vermag nicht an die Stelle des Subjekts zu rücken, ohne dass diese Subjekte sich bereitfänden, der abstrakten Arbeit als Substanz Geltung zu verschaffen als wäre sie Identität von Identität und Nichtidentität, Übergang von Quantität in Qualität, als wäre gewissermaßen eine ‚Versöhnung‘ der konkreten Privatarbeiten mit ihr möglich, oder sozialdemokratisch ausgedrückt: als könnte es einen gerechten Lohn geben. Bei Hegel gehen diese Subjekte natürlich im Staat auf. Es ist wirklich schade, dass Sohn-Rethel nicht zu Hegel übergegangen ist, dass er also dessen Logik einfach ignoriert hat, sonst wäre aus ihm vielleicht ein Staatskritiker statt ein Mao-Sympathisant geworden: Er hätte womöglich entdeckt, dass Hegel, um der »metaphysische Denker des Kapitals« (wie Hans-Jürgen Krahl sagte) zu werden, den Staat als Geist ständig voraussetzen musste. Die Metaphysik des Tausches von Kant ist dafür jedenfalls eine gute Ausgangsposition.
Zu deinem Hinweis auf die Zweite Feuerbachthese: dort wird – wie ich gerade nachgeschlagen habe – gesagt, dass es bei einem Denken, das sich von der Praxis isoliere, eine rein scholastische Frage sei, ob dieses Denken wirklich oder nichtwirklich sei. Aber einmal vorausgesetzt, Marx hätte hier mehr als das im 18. und 19. Jahrhundert gängige Klischee von Scholastik im Sinn gehabt: Jemand wie Abaelard war abgesehen davon, dass er Scholastiker war, ebenso ein Kritiker der rein scholastischen Fragen – also weder ein reiner Nominalist, noch gar ein reiner Universalienrealist. Auch so wäre übrigens der Untertitel meines Buchs zu verstehen: Es sind eben nur »zum Teil« scholastische Versuche zur Kritik der politischen Ökonomie.
Daran gleich anknüpfend: Manfred Dahlmann hat die Tatsache, dass das Kapital historisch zuerst im christlichen Abendland (und zunächst nur dort!) entstanden ist, zum Anlass genommen, sich bei Gelegenheit der Philosophie des von dir eben erwähnten Petrus Abaelardus und im Anschluss an Sohn-Rethel näher mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern die theologischen Auseinandersetzungen um das Trinitätsdogma, die in dieser Form nur im Abendland stattgefunden haben, im Zusammenhang mit den politischen Dimensionen des Investitur- und Universalienstreits eine Denkform geschaffen haben, die als »ideelle Basis« und Bedingung der Möglichkeit für die Etablierung eines völlig neuen gesellschaftlichen Verhältnisses betrachtet werden muss. Inwiefern gehen deine Ausführungen, insbesondere zu Abaelards Verhältnis zum Judentum, über diese Überlegungen hinaus?
Von Manfred Dahlmann, dem mein Buch ja auch gewidmet ist, konnte ich staunend lernen, dass einen bereits der Universalienstreit mit dem Problem konfrontiert, wie das Kapitalverhältnis auf den Begriff zu bringen ist; oder anders gesagt, worin es gerade nicht auf den Begriff gebracht werden kann, weil sich unter ihm letztlich jeder an das Motto halten muss: Credo, quia absurdum est.1 Früher dachte ich eigentlich, es genügt für die Marx-Lektüre den deutschen Idealismus zu studieren, was ja auch schon viel Arbeit macht… Aber um sich die eigene Neigung, das Ungeheuerliche zu rationalisieren (zu der wir erzogen worden sind und in der uns Wissenschaften und Massenmedien täglich bestärken wollen), vollständig abzugewöhnen, ist es ratsam, noch weiter zurückzugehen. Und das eben mit Marx selber, der ja im Verhältnis, das die Waren zueinander eingehen, plötzlich darauf stößt, dass ein Begriff lebendig wird – so als ob das Tier, das Tier schlechthin, neben den einzelnen Löwen, Tigern, Hasen usw. gleichfalls herumläuft.
Wer dabei sozusagen nicht ganz den Verstand verlieren und wenn schon nicht das Unbegreifliche, so doch wenigstens seine Unbegreiflichkeit begreifen möchte, findet bei einem kritischen Scholastiker wie Abaelard Beistand. Abaelard hat es wie später Marx unternommen, solche verselbständigten Universalien à la das Tier – leibliche Inkarnation des gesamten, in diesem Fall von Gott und nicht vom Kapital geschaffenen Tierreichs – weder wie gewöhnliche Nominalisten noch wie die Universalienrealisten zu betrachten: weder schloss er sich bedenkenlos der Meinung an, dass das Tier einfach nicht existierte, sondern nur dieser Löwe oder jener Hase, noch sah er in jedem Löwen oder Hasen eine bloße Erscheinungsweise des Tiers schlechthin, dem noch dazu als deren Wesen mehr Existenz zukomme. Hingegen warf Abaelard die Frage auf, unter welchen Voraussetzungen in Herrgotts großem Tiergarten der Mannigfaltigkeit, zu der ja auch die Menschen zählen, Einheit überhaupt als geltend begriffen werden kann; oder besser mit seinen eigenen Worten gesagt: wie stellt sich das Verhältnis der ratio der Menschen zur Sache an sich (res in se) dar, wenn die Einheit, die Gott verbürgt, sich als nur negative, als supervacuus erweist: inhaltsleer und unbestimmbar. Man glaubt manchmal, es ginge bereits ums Transzendental-subjekt aus der Kritik der reinen Vernunft, zumindest denkt man an Maimonides’ »Ich weiß nur, was Gott nicht ist.«
So fasste Abaelard auch ins Auge, das Dogma der Trinität von Gott, Gottes Sohn und heiligem Geist in Relationen aufzulösen. Und das ist die andere, sozusagen die Hegelsche Seite seiner Theologie. Innerhalb der Trinität sah er im heiligen Geist die Vermittlung, und rückte sie ein Stück weit an die Stelle des Opfers, das Jesus nach der damals bereits durchgesetzten kirchlichen Lehre als Gottes Sohn im Sinne seines ‚leiblichen‘ Vaters dargebracht haben soll. Da die Einheit des Christentums ebenso auf der Identifikation mit diesem Opfer wie auf der Abgrenzung von den Juden als den ‚Opferern‘ beruht, machte sich Abaelard noch weniger Freunde in der Kirche als Marx mit der Wertformanalyse in der Arbeiterbewegung (noch weniger deshalb, weil Letzterer schon in der Zweiten Auflage des Kapitals zumindest bereit war, auf solche Passagen wie die mit dem Tier zu verzichten). Nebenbei bemerkt, halte ich Abaelards Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum für die erste Schrift im Christentum, in der rücksichtslos über die gerade damals in bis dato unbekannter Weise wiederauflebende Verfolgung der Juden berichtet wird.
Jedenfalls versuche ich im Anschluss an Manfred Dahlmann zu zeigen, dass es sich bei Abaelard um eine ganz einzigartige Konstellation handelte, die sich u.a. dadurch ergeben hat, dass staatliche Souveränität noch kaum auch nur im Ansatz vorhanden war – wir befinden uns ja hier im 11., 12. Jahrhundert! Gerade weil sich für Abaelard politische Gewalt nicht ‚positiv‘ in den Instanzen staatlicher Macht verkörperte, können in seinem Denken schon bestimmte Voraussetzungen dafür entdeckt werden, die Abstraktion, wie sie im Kapitalverhältnis real werden sollte, zum Gegenstand der Kritik zu machen, während sie dann in der späteren, in der politischen Philosophie (von Marsilius über Machiavelli bis Hobbes) durch die Fixierung auf den Souverän wieder verdeckt wurden.
Du zeigst nicht nur, wie viel Marx und die Kritische Theorie der negativen Theologie des Judentums grundlegend zu verdanken haben, sondern auch, inwieweit der unabgegoltene Streit des deutschen Idealismus zwischen Kant und Hegel, der seine Vorform in gewisser Hinsicht im theologischen Streit zwischen Judentum und Christentum findet, in der Kritik der politischen Ökonomie und der ihr zugrundeliegenden, »negativen Dialektik des Maßes«, wiederkehrt. Ermöglicht erst die, durch Kant und Sohn-Rethel aufklärerisch, bzw. materialistisch anverwandelte Perspektive des Judentums, in Verbund mit der, von Adorno und Horkheimer entwickelten Dialektik der Selbsterhaltung, einen, unserem heutigen geschichtsphilosophischen Ort gerecht werdenden Zugang zu den Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie? Dies legen zumindest deine, durch die kritische Auseinandersetzung mit Hegel und dem Hegelianismus der Neuen Marx-Lektüre gewonnenen Ausführungen zum Begriff der abstrakten Arbeit nahe, vor deren Hintergrund auch die viel und häufig zu unkritisch zitierte Rede von der »dialektischen Darstellung« bei Marx in einem anderen Licht erscheint. Wenig verwunderlich, aber umso bezeichnender ist dabei, dass der Begriff der abstrakten Arbeit dem Marxismus insgesamt ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist.
Ja, abstrakte Arbeit bzw. der Wert, wovon sie die Substanz bildet, das sind sozusagen bei Marx die Begriffe, die am dringendsten nach dem Bilderverbot verlangen, das ihm seine Kritik der politischen Ökonomie auferlegt. Und so ähnlich wie die hebräische Bibel ist er diesem Verbot treu: Denn in der Tora werden ja ziemlich viele Bilder von Gott bemüht, um nämlich keinem zuzugestehen, das Bild Gottes zu sein; und wie dort JHWH als Vater, Mutter, König, Schild, Löwe, Vogel etc., aber eben auch als Motte, Eiter und Knochenfraß firmiert, so ergeht es dem negativen Gott im Kapital. Kein Wunder, dass die Marxisten mit der abstrakten Arbeit ihr liebes Problem haben, denn wie kann denn die Arbeit, die sie als die einzige Quelle des Reichtums betrachten und wovon sie also den besonderen Status der Arbeiter und ihrer Organisationen ableiten, einen Wert bilden, der kein Atom Naturstoff enthält, gespenstische Gegenständlichkeit hat und dazu noch ein automatisches Subjekt ist, und doch lebendige Junge wirft oder wenigstens goldene Eier legt. Untreu wird Marx dem Bilderverbot nur dort, wo er einerseits das Proletariat wie Gottes Sohn betrachtet, der die Welt durch sein Opfer erlöst, und andererseits Anleihen beim Antisemitismus nimmt, darüber findet sich deshalb auch ein eigenes Kapital in meinem Buch.
Wird der schlechte, gebrauchswertorientierte Konkretismus eines bloß klassenkämpferisch gestimmten Marxismus, der die spezifische und neuartige Synthesis durchs Kapital mit Notwendigkeit verfehlen muss, in antiimperialistischer Manier allerdings auf die Ebene des Weltmarktes übertragen, dann offenbart sich erst das ganze bedrohliche Potenzial einer derartigen, im marxistischen Jargon daherkommenden »Politik mit Begriffen« (Manfred Dahlmann). Dagegen knüpfst du in deinem Buch, im Kapitel über den Weltmarkt, an deine bisherigen Überlegungen an, wonach die Kritik der politischen Ökonomie das Verhältnis zwischen den Staaten unbedingt miteinbeziehen muss. Welche Auswirkungen hat diese Miteinbeziehung des Weltmarktes dabei auf den Maßbegriff und die Geltung des Wertgesetzes?
Das ist vielleicht sogar das wichtigste Kapitel des Buchs, jedenfalls im Hinblick auf die aktuelle Situation, weil im Zuge der stumpfsinnigen Verteufelung der ‚Globalisierung‘ jeder Begriff vom Weltmarkt und dessen für das Kapitalverhältnis unaufhebbaren Zusammenhang mit der Souveränität der einzelnen Staaten verloren ging. Sogar dort, wo man eigentlich mehr Kenntnis von Marx erwarten durfte, setzte sich das durch, etwa bei Robert Kurz, der bereits das »Ende der Nationalöko-nomie« ausrief: Ein rasch wachsender Teil des Weltmarkts (Kurz spricht sogar von einem eigenen »Terrain«!) sei kein Austausch zwischen Nationalökonomien mehr, sondern interne Funktionsteilung von unmittelbar global agierenden Konzernen… Über diesen Konzernen wird dann ein Weltsouverän in Gestalt der USA phantasiert, der »Weltordnungs-kriege« führe, statt gerade in den USA den aus dem letzten Weltkrieg hervorgegangenen Hegemon zu erkennen, der Weltmarktverteidi-gungskriege führt. Das liest sich alles, als wäre der Wunschtraum einstiger neoliberaler Theoretiker wahr geworden, die ihrerseits schon nicht begreifen wollten, dass es keinen Weltmarkt ohne die Souveränität einzelner Staaten geben kann. So schlug z. B. Hayek die Abschaffung der Zentralbanken vor (einschließlich der Fed), weil nationale Währungen weder »unvermeidlich« noch »wünschenswert« seien; und bereits von Mises hatte geschrieben, dass der »Weltstaat« Realität wäre, sobald man überall auf der Erde das Programm des Liberalismus durchführte.
Es hat also eine gewisse Logik, dass linke wie rechte ‚Souveränisten‘ von heute Neoliberalismus sagen, wenn sie eigentlich den Weltmarkt meinen. Sie schwindeln sich aber mit diesem Feindbild am einfachsten darüber hinweg, dass es Souveränität nur durch diesen Weltmarkt gibt und vice versa. Und sie tun das, um Politik machen zu können, und das heißt ja, einerseits einen Feind benennen und andererseits dem Appell an den Souverän einen Anschein von Vernünftigkeit geben: Er soll doch bitte schön diesen Feind, die neoliberalen ‚Globalisten‘, kaltstellen und das Wertgesetz innerhalb des Staats endlich wieder zum Wohle seiner Bürger modifiziert anwenden. Damit wird verdrängt, was geradezu als das Exis-tentialurteil der Marxschen Kritik gelten kann: dass der Totalität des Kapitalverhältnisses (im Unterschied zu jeder anderen Totalitätsvorstel-lung) insofern objektive Realität beizumessen ist, als die einzige Möglich-keit, seine Gesetze nicht hinzunehmen, darin liegt, es abzuschaffen.
In diesem Punkt ist übrigens für die späteren Auflagen bzw. Fassungen des ersten Kapitalbands eine Lanze zu brechen, denn hier beginnt Marx erst die wichtigsten Begriffe zu entfalten, um den Weltmarkt näher zu bestimmen (ursprünglich wollte er ja gerade dazu einen eigenen Band schreiben). Diesen Begriffen gemäß erfolgt die Durchschnittsbildung, was die notwendige Arbeitszeit zur Produktion einer Ware betrifft, in einer, wie Marx sagt, gegebenen »nationalen« Gesellschaft, also innerhalb der Grenzen eines Staats, und nicht in einer vorgestellten Weltgesellschaft. Es ist diese Durchschnittsbildung, die sich zugleich im internationalen Handel in »modifizierter« Weise, nämlich gebrochen durchs Konkurrenzverhältnis unter den Staaten, niederschlägt. Denn wenn Weltmarkt kein Hirngespinst wie der Weltstaat sein soll, dann gehört zu seinem Begriff eben auch, dass Arbeitskraft nicht importiert und exportiert wird wie andere Waren – man handelt sie nicht wie Schweinebäuche auf Warenbörsen. Für diese Ware gibt es keine Weltmarktpreise, sondern jeweils nationale Einwanderungsgesetze.
Das heißt: die Anerkennung der Messung durch die jeweils durchschnittlich notwendige Arbeitszeit und damit des jeweiligen Durchschnitts der »Intensivität« der Arbeit – wie mit Marx deren Produktivität im ausschließlichen Bezug auf die abstrakte Arbeit zu nennen wäre –, erfolgt zwar auf dem Weltmarkt ebenfalls vermittels des Geldes, sie erfolgt aber hier notwendig im Verhältnis der Währungen bzw. der Handelsbilanzen verschiedener Staaten zueinander. Die Unternehmen konkurrieren also auf dem Weltmarkt nicht unmittelbar wie auf dem nationalen Markt. Wer hingegen von »digitalem« oder »postmodernem Kapitalismus« schwadroniert, orientiert sich offenkundig nur an bestimmten Unternehmen wie Google, Facebook, Apple, Microsoft etc., deren Erfolg auf dem Weltmarkt aber letztlich ebenso darauf beruht, dass die Durchschnittsbildung der zur Produktion einer Ware erforderlichen Arbeitszeit unter dem Regiment der einzelnen Staaten erfolgt, nur haben sie einen entscheidenden Vorteil: dass sie aufgrund der besonderen Gebrauchswerte ihrer Waren am besten imstande sind, nicht nur die Produktionszeit, sondern in atemberaubender Weise die Zirkulationszeit des Kapitals zu verkürzen, ja dass diese Verkürzung selbst der wichtigste Gebrauchswert der Waren ist, die sie anbieten.
Das ist jetzt im Unterschied zum Buch natürlich alles sehr verkürzt ausgedrückt, aber worauf ich hinaus will: Erst die Reflexion auf den Weltmarkt ermöglicht einen radikalen Begriff abstrakter Arbeit, mit dem sich niemand mehr vormachen kann, dass die konkreten Arbeiten in der Substanz des Werts irgendwie aufbewahrt und deshalb auf gerechte Weise gegeneinander getauscht werden könnten, wenn nur die Profitgier nicht so groß wäre oder es kein Finanzkapital oder keine Digitalisierung gäbe oder wenigstens deren Konzerne verstaatlicht wären… Eine Kritik, die diesen radikalen Begriff entwickelt, richtet sich damit keineswegs gegen das Engagement für höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit, bessere Arbeitsbedingungen, Leistungen des Gesundheitssystems usw. Zu kritisieren ist aber umso mehr eine Ideologie, die das politisch verallgemeinert sehen möchte, und zwar als Rettung oder Wiederherstellung des Sozialstaats, der über den Weltmarkt den Sieg davontragen könnte. Denn die ‚Errungenschaften‘ des Sozialstaats, wie wir ihn kennen, gehören nicht von ungefähr zu den Resultaten des deutschen Vernichtungskriegs, der, angetrieben vom Hass auf die Juden, das zerstörerische Potential des Kapitals schon einmal nahezu vollständig in die Tat umgesetzt hatte. Daraus ergibt sich der ominöse Zusammenhang, um den es in einem der letzten Teile meines Buchs geht: Dieses Potential, das zu wachsen nicht aufgehört hat, kann tatsächlich wieder nur realisiert werden, wenn der Weltmarkt zerbricht, der es wachsen lässt. Auf das Zerbrechen des Weltmarkts setzt jedenfalls seit dem Ersten Weltkrieg jede Katastrophenpolitik und darauf hofft der antisemitische Wahn.
In deinen vorangegangenen Veröffentlichungen hast du dich besonders mit den direkten und indirekten Beiträgen auseinandergesetzt, die von »Kerneuropa« ausgehen und, etwa in Gestalt der EU, zur Befeuerung jener Katastrophenpolitik beitragen, die dem Zusammenbruch des Weltmarktes gleichermaßen entspringt, wie sie ihn vorantreibt und deren momentane Avantgarde der politische Islam bildet. In deinem neuen Buch widmest du dich nun auch der Politik Chinas. Wie ließe sich das chinesische Modell bestimmen und welchen Beitrag leistet China aktuell zur Etablierung eines Gegensouveräns, dessen Bestimmung in der Freisetzung jenes Vernichtungspotenzials besteht, das in letzter Konsequenz immer und immer wieder auf die Juden und ihren Staat zielt?
Die sogenannte Neue Seidenstraße oder Belt and Road Initiative sehe ich als eine mögliche Bruchform des Weltmarkts – Bruchform ist ein Begriff, den Sohn-Rethel in seinen überaus hellsichtigen Analysen zum Auseinanderbrechen des Weltmarkts in den 1930er Jahren eingeführt hat. An diese Analysen wäre heute anzuknüpfen, um zu begreifen, was droht. China versucht nun seit ein, zwei Jahrzehnten die Weltmarkt-beziehungen, wie ich das ausdrücken möchte: von innen her aufzulösen, also von den Verträgen her: Kreditverträge z.B. sind nicht durchaus auf Äquivalententausch ausgerichtet, spekulieren vielmehr auf eine Art geopolitischer Schuldknechtschaft, etwa auf Inbesitznahme eines Territoriums, das militärisch genutzt werden kann. So wie auch Hitlerdeutschland zunächst Verträge schloss durchaus auch zum eigenen ökonomischen Nachteil, nur um einzelne Länder aus dem Weltmarkt herauszubrechen und von sich unmittelbar politisch abhängig zu machen. Damit schafft die Volksrepublik Voraussetzungen einer Katastrophenpolitik, wie sie vor 20 Jahren noch als Monopol der deutschen EU in deren Beziehungen zur islamischen Welt erschien, siehe die zunehmend enger werdenden Allianzen Chinas und der Islamischen Republik Iran (wozu natürlich auch Putins Russland zählt). Doch erscheint auch die chinesische Politik hier eigenartig doppeldeutig: Sie wirkt als willentlicher Beschleuniger, was den imperialistischen Versuch betrifft, den Weltmarkt aufzuspalten und den US-Hegemon durch Großraumpolitik beiseitezuschieben; aber als Beschleuniger wider Willen, was die Bedrohung Israels anbelangt, wie das Verhältnis zum Islam im Allgemeinen und zum Iran im Besonderen zeigt. Israel sieht sich hier – ganz ähnlich wie im Verhältnis zu Russland – genötigt, seine Beziehungen zu China auch dafür zu nutzen, die Politik dieser Racketrepublik Iran in Schach zu halten. Wie begrenzt die Möglichkeit dazu auch ist, das Iran-Appeasement der USA unter Biden lässt
keine andere Wahl.
---
Gerhard Scheit lebt als freier Autor in Wien. Er ist Mitbegründer der ideologiekritischen Zeitschrift sans phrase und veröffentlicht zu zahlreichen Themen aus dem Umkreis der Kritischen Theorie, darunter besonders zur Kritik der politischen Gewalt, der Kritik der politischen Ökonomie und der Kritik des Antisemitismus. Im August 2022 erschien sein neues Buch »Mit Marx. 12 zum Teil scholastische Versuche zur Kritik der politischen Ökonomie« im ça ira-Verlag.