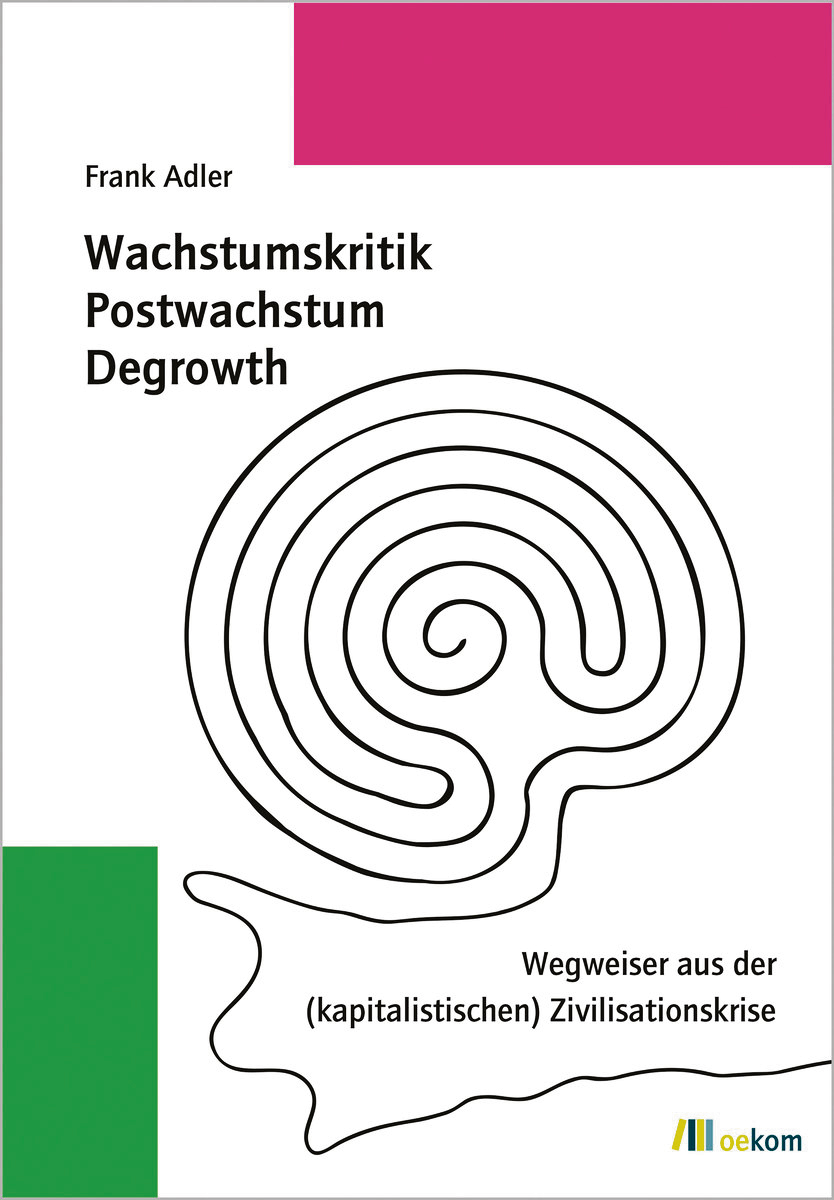Naturzerstörung, ökologischer Kollaps und Klimawandel sowie die damit verbundenen sozialen Verwerfungen zwingen zu einem radikalen Umdenken – das wird auch in den aktuellen Krisen um Corona und Erderwärmung deutlich. Der Diskurs um Wachstumskritik, Postwachstum bzw. Degrowth hat jedoch schon einige Jahrzehnte »auf dem Buckel« und steht eng im Zusammenhang mit dem 1972 veröffentlichten Bericht des Club of Rome. Frank Adler hat hierzu nun eine umfassende Monografie vorgelegt, in der er die historischen und politischen Debatten nachzeichnet und versucht, Antworten auf die Frage zu geben, wie eine alternative Vergesellschaftung im Sinne von Postwachstum bzw. Degrowth aussehen sollte.
Das Buch besteht aus sieben Kapiteln über 607 Seiten, auf denen Adler eine kritische Zeitdiagnose gibt, die Herausbildung und Ideologie des (neoliberalen) Wirtschaftswachstums untersucht und versucht, die Trias von Wachstumskritik, Postwachstum und Degrowth konkret zu definieren und begrifflich zu unterscheiden. Daran anschließend blickt Adler auf den historischen Diskurs, schaut sich diverse wachstumskritische Strömungen an und bezieht zu »linken Kritiken« am wachstumskritischen Diskurs Position – wobei Adler hier leider fast ausschließlich eine Abwehr- und Eingemeindungsstrategie auffährt, der es an einer tiefen Auseinandersetzung mit Gegenargumenten mangelt. Dagegen neigt er dazu, Pappkameraden aufzustellen, um kurzerhand die Kritik mit den Anliegen der Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen des PW/Degrowth-Diskurses gleichzuschalten. Im finalen Kapitel bespricht Adler schließlich unterschiedliche reformerische oder mehr oder weniger radikale Transformationsstrategien, um die ökologische Krise zu lösen. So weit der inhaltliche rote Faden, den Adler jedoch hin und wieder verliert.
Etwas Licht, viel Schatten
Dass eine Monografie zu einem speziellen Thema derart »voluminös« ausfällt – wie Adler in der Einleitung »selbstkritisch« eingesteht – spricht weder für noch gegen ihre Lektüre. Im vorliegenden Fall ist die Redundanz vieler Aussagen aber frappierend: Argumente, Positionen und Fakten unterliegen einer ermüdenden Wiederholung. Dass es den Wachstumskritikern etwa um eine Kritik am ideologischen Wachstumsparadigma und um eine gesellschaftliche Transformation geht, dass es unklar ist, wie diese Transformation genau aussehen soll und dass hier unterschiedliche Positionen existieren – die Adler immer wieder als fruchtbar für eine Allianzbildung ausweist –, wird so regelmäßig und lückenfüllend vorgetragen, dass die Lektüre bisweilen einer ordentlichen Portion Frustrationstoleranz bedarf.
Trotz dessen ist hervorzuheben, dass eine umfassende Darstellung des Diskurses um Wachstumskritik, seiner ideengeschichtlichen Wurzeln und eine kenntnisreiche Untersuchung verschiedener Strömungen und Ansätze gegeben wird. Gleich, ob man sich diese Positionen nun zu eigen macht, bleibt die Lektüre informativ. Auch Adlers Umgang und kritisches Interesse an der kapitalistischen Vergesellschaftung ist durchaus ernstzunehmender als die seiner prominenten Kollegen. Wo etwa Niko Paech von sozialen Kämpfen auf Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft kaum etwas wissen möchte, nicht in der Lage ist, geschlechtsspezifische Fragen zu problematisieren und ein bemerkenswertes Desinteresse an der Klassenfrage zeigt, ist sich Adler dieser Aspekte durchaus bewusst und weiß kritisch darzustellen, warum die kapitalistische Vergesellschaftung in vielerlei Hinsicht zu ökologischen, aber eben auch zu sozialen Problemen führt.
Deswegen hätte es der Autor eigentlich nicht nötig gehabt, immer wieder den Anschluss an Paech zu suchen, diesen regelmäßig und zumeist unkritisch1 als Autoritätsargument anzuführen und damit hinter seine eigene Position zurückzufallen (wenn er etwa mit Paech übereinstimmt, dass doch auch der Hartz-4-Bezieher »die eigenen Spielräume zu nutzen« habe). Dies kann allerdings akademischen Gepflogenheiten und Sachzwängen geschuldet sein. Zwar bemüht sich Adler um einige wenige kritische Einlassungen zu Paechs Postwachs-tumsökonomie (Individualisierung, Voluntarismus, Ausblenden von Herrschaftsverhältnissen), es wäre seiner eigenen Position jedoch wesentlich zuträglicher gewesen, auch zu regressiven Aspekten wie Paechs Revitalisierung der Gesell’schen Zinskritik oder der Verklärung informeller Beziehungen Distanz zu halten, statt sich gegen »linke Kritik« an Paech und vergleichbaren Positionen zu immunisieren. Auffällig und in seinem demokratischen Bemühen um Konsens- und Allianzbildung verortet, verstrickt sich Adler2 dann eben auch in den ein oder anderen Widerspruch: So hält er einerseits emphatisch fest, dass »ohne die angedeuteten Logiken der kapitalistischen Reproduktionsweise […] der Ursprung ökologischer Krisen schwerlich zu erklären« sei, nur um dann direkt auf der nächsten Seite auszuführen, dass eine explizite antikapitalistische Position »keine Voraussetzung« sei, »um als emanzipatorische Wachstumskritik anerkannt zu werden«.
Kritik leugnen, ignorieren oder eingemeinden?
Im 6. Kapitel wendet sich Adler dann dezidiert den »linken Kritiken« am Wachstumsdiskurs zu. Interessant ist der selektive Umgang Adlers mit den Autoren und Autorinnen, denen er einen schlampigen Umgang mit Textbelegen vorwirft, anstatt Gegenargumente zu entkräften. Unterfüttert wird dies durch einen arrogant anmutenden Duktus aus wissenschaftlich-positivistischer Richtung gegenüber Autoren und Autorinnen wie David Harvey, Klaus Dörre, Silke van Dyk, Peter Bierl et. al. Die vorherrschende Strategie besteht hierbei im Verleugnen kritikwürdiger Aspekte, der Ignoranz gegenüber triftigen Einwänden oder dem Versuch, die Kritik durch Umarmung und Eingemeindung zu trivialisieren. Zugleich werden antikapitalistische Positionen kritisch benannt, die versuchen, das ökologische Problem zu lösen, jedoch die Produktivkräfte und damit verbunden z.B. Automatisierung und Arbeitszeitverkürzung als möglichen Schlüssel zur Überwindung der kapitalistischen Vergesellschaftung sehen – ohne aber konkret darauf einzugehen, worin z.B. bei Paul Mason (oder auch Aaron Bastani) das Problem zu verorten ist. Zumindest geschieht das dann implizit an anderer Stelle, worin Adler freilich zuzustimmen ist, dass die Produktivkräfte und der damit verbundene technische Fortschritt nicht zwangsläufig zu einem gesellschaftlichen Fortschritt beitragen, sondern es durchaus auch um eine Veränderung der zwischenmenschlichen Beziehungen gehen muss.
Die Problematik wird aber besonders deutlich an Adlers Umgang mit rechten Autoren, die den Anschluss an den Wachstumsdiskurs suchen. So kritisiert Adler hier z.B. absolut zurecht die antisemitisch gefärbte Zinskritik3 von Höcke oder die ideologische Verklärung der Regionalität sowie patriarchaler Familienstrukturen und der ständigen Rede von Maß, Habgier sowie einer Fetischisierung körperlich-handwerklicher Arbeit durch Autoren wie Alain De Benoist, kann sich aber nicht dazu durchringen, diese Probleme auch bei seinen Kollegen auszumachen. In dieser Hinsicht kritisiert Adler auch die sich dezidiert konservativ verstehende Wachstumskritik eines Meinhard Miegel, bei der die Nähe zu Paechs Phantasmagorie einer »Ökonomie der Nähe« frappant ist. Was an Miegel kritisiert wird, etwa die Gefahr dörflich-informeller Beziehungen, die gegen einen modernen Sozialstaat in Stellung gebracht werden und die kulturkonservative Zivilisationskritik, wird bei Paech übersehen. Vielmehr wäre konkret zu klären, worin sich Autoren wie Höcke, Benoist oder auch Miegel inhaltlich von Paech unterscheiden. Doch genau das fällt zumindest bei den genannten Aspekten eben sehr schwer, selbst wenn man Paech äußerst wohlwollend liest und dieser freilich hier und dort anderes Vokabular verwendet.
Darüber hinaus ist Adler nicht in der Lage, biologistisch und organizistisches Denken im wachstumskritischen Diskurs kritisch zu benennen – bei dieser »Voluminösität« des Bandes wäre es so vermutlich möglich gewesen, wenigstens auch einmal darauf einzugehen, was sich in der Krebszellen-Metaphorik, die vor allem im amerikanischen Diskurs omnipräsent ist, artikuliert. Gegen rechte Vereinnahmungen der Postwachstumsbewegung weiß Adler dann auch alle Spitzfindigkeiten aufzufahren: So »setze [er] zuweilen ein ‚emanzipatorisch‘ vor Wachstumskritik«. Wer eine gesellschaftliche Transformation anstrebt, immer wieder herausstreicht, nach Strategien suchen zu wollen, um auch den »Durchschnittsbürger« zu erreichen, sollte sich schon ein wenig mehr Gedanken machen oder eben ehrlich eingestehen, dass bei aller intendierten Allianzbildung doch nur noch die Querfront bleibt. Eventuell haben »linke Kritiker«, die diese Schnittmengen mit rechter Ideologie problematisieren vielleicht mehr recht als einem lieb ist, vielleicht sollten ihre Mahnungen tatsächlich einmal ernst genommen werden. Im vorliegenden Fall kann davon jedenfalls nicht gesprochen werden.