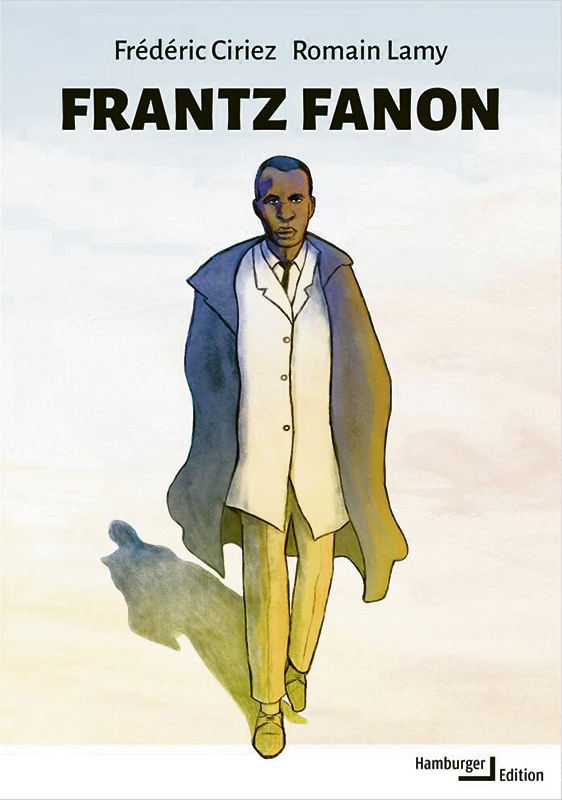Die Graphic Novel ist im Kulturbetrieb angekommen. Die Bezeichnung wurde in den 1980er Jahren vom Zeichner und Autor Will Eisner (1917-2005) erfunden, um die in Bildern erzählende Geschichte vom als massenkulturelles Jugendmedium belächelten Comic abzugrenzen. Ein Bemühen, das heute durchaus ironisch erscheint, wo jeder zweite im hochkulturellen Feuilleton besprochene Kinofilm auf einem Superhelden-Comic beruht. Die von Eisner erhoffte Etablierung als eigenständige literarische Form ist auch in Deutschland gelungen, das zeigen zahlreiche Veröffentlichungen in renommierten Verlagen.
Sachthemen und das biografische Genre erfreuen sich besonderer Beliebtheit. So wurden schon Verschwörungsmythen von Eisner selbst (»Das Komplott«, 2005; kommentierte dt. Neuauflage 2022) oder unlängst Hannah Arendt und Primo Levi zum Gegenstand von Graphic Novels gemacht. Nun hat auch ein wissenschaftlicher Verlag das Medium aufgegriffen, namentlich die Hamburger Edition des Hamburger Instituts für Sozialforschung, mit einem aus dem Französischen übertragenen Werk des Schriftstellers Frédéric Ciriez und des Illustrators Romain Lamy über Frantz Fanon.
Anders als Marx (zu Jubiläen und ökonomischen Krisen), ist der Autor von Schwarze Haut, weiße Masken (1952, dt. 1980) und Die Verdammten dieser Erde (1961, dt. 1966) nie besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Irgendwie ist er aber immer ein wenig en vogue und wird immer wieder entdeckt. Darin reflektiert sich die Faszination, die von Fanon, seinem vielfältigen Werk und seiner wechselvollen Biografie ausgeht. Es spiegelt sich darin auch, dass Fanon trotz aller Zuschreibungen niemandem ganz zuzurechnen, kaum zu verorten ist. Öffentlich wirkender, algerisch-revolutionärer politischer Theoretiker karibischer Herkunft, universalistischer schwarzer Gesellschaftsanalytiker, postcolonial avant la lettre, »antiimperialistischer« Propagandist?

Auszug aus »Frantz Fanon«
Treffend ist ein Essay von Albert Memmi, selbst Autor eines antikolonialen Klassikers, der zu Fanon zeitlebens ein seltsam ambivalentes Verhältnis pflegte, mit »Das unmögliche Leben des Frantz Fanon« betitelt. Im Westen, dem globalen Norden, oft wahllos ausgeschlachtet und wahlweise extrem romantisiert oder als Gewaltprophet verschrien – von einem Autor wie Pascal Bruckner gar in den Rang eines rassistischen Menschheitsverbrechers erhoben –, wurde der tote Fanon nach der Befreiung Algeriens vom kolonialen Joch von der nationalen Befreiungsfront FLN und ihren Generälen als nicht-arabischer Fremder exorziert. Assia Djebar hat dem 1996 mit »Weißes Algerien« meisterhaft ein literarisches Fanal entgegengesetzt – also solchen »Gespenstern unserer Unabhängigkeit« wie Frantz und Josie Fanon, und damit auch den politischen wie emotionalen Konsequenzen postkolonialer Gewalt, sowie dem Ausschluss und dem Vergessen.1
Dem Anspruch, den Fanons Leben und Werk, wie auch die Platzierung in einem Wissenschaftsverlag setzt, werden Ciriez und Lamy vollauf gerecht. Die Graphic Novel führt hervorragend in Biografie und Denken Fanons ein. Allerdings sollte man die Bereitschaft mitbringen – woran politische Debatte und Öffentlichkeit meist scheitern – sich auf die Geschichte der Entkolonisierung und der antikolonialen Kämpfe, wie auch der intellektuellen Landschaft der französischsprachigen Welt im kurzen 20. Jahrhundert einzulassen, mit allen Brüchen, Ambivalenzen und Verstrickungen. Entsprechend sind die 232 Seiten des Buchs sehr »diskursiv« gestaltet – im besten Sinn des Wortes.
Die Autoren lassen Fanon sprechen. Den Rahmen bilden drei Tage in Rom im Sommer 1961, an denen er – von Claude Lanzmann vermittelt – Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre trifft und mit den dreien im Gespräch sein Leben, seine theoretischen Ansichten und politischen Aktivitäten erzählt. Die gleichsam fieberhafte Tätigkeit und Atmosphäre dieser Tage vermitteln die Autoren prägnant. Während der algerische Befreiungskampf seinem Kulminationspunkt zustrebte (Verhandlungen mit Frankreich, Terror der franko-algerischen OAS, interne Machtkämpfe der FLN), erwartet der mit Leukämie diagnostizierte Fanon das Erscheinen seines letzten Werks. Die Möglichkeiten der Form Bilderzählung nutzen die Autoren dafür hervorragend. Die Ambivalenz der Gleichsetzung von Rassismus und Antisemitismus in der Fanon‘schen Konzeptionalisierung etwa, via der Betonung des Blicks des Anderen durch Sartre in Überlegungen zur Judenfrage (1946), können Ciriez und Lamy in einem einzigen Panel offenlegen – und begreifen gleichzeitig die in dieser Ambivalenz aufgehobene Differenz zwischen den beiden Ressentiments: »Mit dem Unterschied,« sagt die Figur Fanon zu Sartre, »dass ich schwarz bin und Sie nicht jüdisch« (21). Die in drei Teile (Freitag, Samstag, Sonntag) und einen Nachsatz gegliederte Erzählung läuft wie ein Dokumentarspiel ab, ergänzt durch nur in diesem Medium mögliche Collagen, Gegenüberstellungen, Texteinschübe.

Frantz Fanon bei einer Presse-Konferenz während eines Autoren-Kongresses in Tunis, 1959 (Bild: Public Domain)
Geboren 1925 in der französischen Kolonie Martinique und Freiwilliger der antifaschistischen, aber kaum antikolonialen Streitkräfte des Freien Frankreich im Zweiten Weltkrieg, studiert Fanon Medizin und Philosophie in Lyon. Als Psychiater im algerischen Blida praktiziert er progressive sozialtherapeutische und ambulante Behandlungs-methoden. In seiner psychiatrischen Forschung wie seinen politischen Schriften zeigt sich Fanon als reflektierter Analytiker gesellschaftlicher Herrschaft, etwa der alltäglichen wie institutionalisierten Gewaltpraxis Rassismus und der Dehumanisierung durch das Kolonialverhältnis. »Die Inferiorisierung auf Seiten der Eingeborenen entspricht der europäischen Superiorisierung. [...] Wenn [der Eingeborene] in einem bestimmten Moment seiner Geschichte dazu gebracht wurde, sich die Frage zu stellen, ob er ein Mensch ist oder nicht, so deshalb, weil man ihm diese Realität absprach.«2 Unter dem Eindruck der Gemetzel und Folterpraktiken der französischen Armee quittiert er 1956 öffentlichkeitswirksam den medizinischen Dienst: »Herr Minister, [...] die in Algerien bestehende soziale Struktur [des Nicht-Rechts, der Ungleichheit] widersetzte sich jedem Versuch, das Individuum [medizinisch] wieder in seine Rechte einzusetzen.«3 Fanon wird zum Zeugen der Wirkungen von Folter, Gewalt und Erniedrigung, einprägsam dafür von Autor Ciriez und Illustrator Lamy bildlich aus einem Patientengespräch in seinem Büro in die Stätte der Tortur verschoben (143).
Im Exil in Tunis leitet Fanon eine psychiatrische Station und wird Mitarbeiter der Zeitschrift der FLN. Als Abgesandter ist er in Westafrika und auf internationalen Kongressen wie dem legendären I. Kongress Schwarzer Schriftsteller 1956 in Paris tätig – wo Fanon Rassismus als Ergebnis wie Rechtfertigung eines Systems gesellschaftlicher Herrschaft benennt, »Rassismus-als-Konsequenz« gegenüber dem vermeintlichen »Rassismus-als-Ursache«.4 Er wird Symbolfigur, Stimme und Theoretiker, nicht nur des algerischen, antikolonialen Kampfs und einer sozialrevolutionären Entkolonisierung. Fanon stirbt Anfang Dezember 1961 in einem Krankenhaus in den USA, kurz nachdem er Die Verdammten dieser Erde in Händen halten konnte.
Fanons bekanntestes Werk analysiert plastisch die Kolonialherrschaft und den antikolonialen Kampf als unterdrückende bzw. befreiende Formen von Gewalt, und es blickt über deren Ende hinaus. Ähnlich wie Memmi einige Jahre zuvor benennt Fanon deren Dialektik: »Der Manichäismus des Kolonialherren erzeugt einen Manichäismus der Kolonisierten.«5 Ein zentrales Kapitel widmet sich den »Mißgeschicke[n] des nationalen Bewußtseins«. »Die Dahomeer und Voltaer, die wichtige Posten im Kleinhandel [der Elfenbeinküste] einnahmen, sind seit der Unabhängigkeit der Gegenstand feindseliger Demonstrationen«, notiert Fanon. »Vom Nationalismus sind wir zum Ultra-Nationalismus, zum Chauvinismus, zum Rassismus übergegangen.«6 »Wiederkehr des Rassismus«, so kommentiert Detlev Claussen, »wenn die Emanzipation aus dem Kolonialismus mißglückt.«7 Dass das von Fanon ersehnte Vorwort Sartres gerade diese Diagnosen einer drohenden postkolonialen Fortschreibung von Elitenherrschaft und Gewalt mit einem Gewaltrhetorik-Holzschnitt überlagerte und die Wahrnehmung des ganzen Werks Fanons prägte, darin liegt eine fast tragische Ironie.
In diesem Sinn kommt den Autoren das Verdienst zu, einfühlsam und künstlerisch ansprechend in Fanons Leben und Denken einzuführen und ebenso, etwa über die Einwürfe oder Gedanken der Figuren Sartre, de Beauvoir und Lanzmann, in dessen Widersprüche und die Debatten darum. Nichtsdestotrotz kann auch dieses schöne Buch, wie Lothar Baier vor zwanzig Jahren zu Alice Cherkis ebenfalls empfehlenswertem Fanon-Porträt anmerkte, die Lektüre seiner Texte nicht ersetzen. Passend dazu ist vom März Verlag auch die Aufsatzsammlung Für eine afrikanische Revolution endlich neu aufgelegt worden.
Das Buch
Frédéric Ciriez & Romain Lamy: Frantz Fanon, übers. von Michael Adrian (Hamburg: Hamburger Edition, 2021), 232 S., 25 EUR.