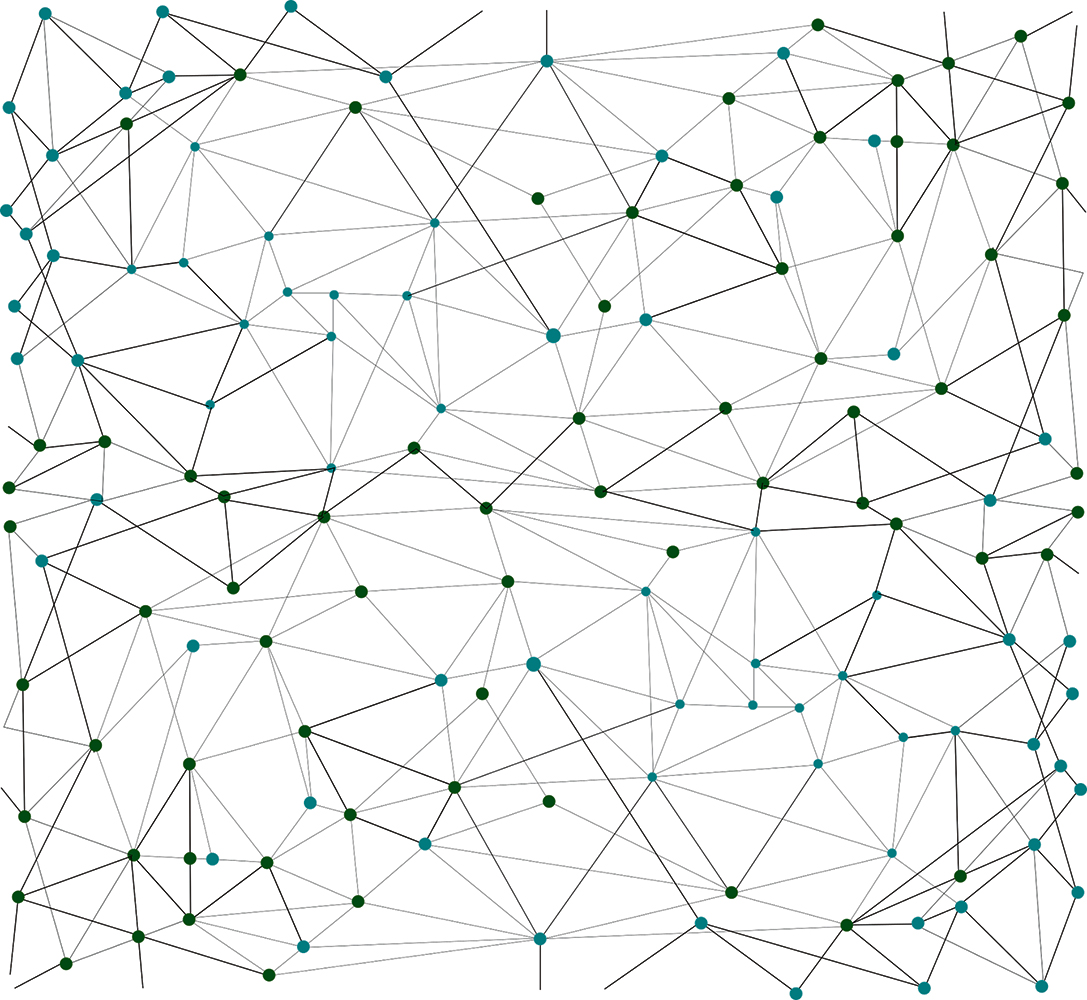Man kann die Rede vom »Vernetzen« als dreistes Dummdeutsch abtun und dort rubrizieren, wo Unwörter wie »proaktiv« herumwesen. Die Vermeidung eines Ausdrucks feit aber nicht vor den Auswirkungen der Realität, die ihn bedingt: Networking & -queen reign supreme. Selbst poststrukturalistisch getaktete Hirne ahnen das tief im Kokon diskursiver Spinnweben, in die sie sich vergekapselt haben. Die allegorische Indienstnahme des Netzes reicht weit zurück und auch seine Ambivalenz: Analog zur Bandbreite der Verwendung physischer Netze (Jagd, Fischfang, Konstruktion, Insektenabwehr, Krieg, Mode) standen sie für Sicherheit, Kunstfertigkeit oder auch Freiheitsverlust, sowie für moralische und geistige Verstrickungen. Perseus und seine Mutter Danae wurden mittels eines Netzes vom Fischer Diktys gerettet, dessen Name »Netzmann« bedeutet. Arachne wurde in eine Spinne verwandelt und samt ihrer Nachkommen dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit zu weben (selten Dispositive) und Hephaistos warf über seine Gattin Aphrodite und deren Liebhaber Ares ein Netz, als er sie in flagranti erwischte und präsentierte sie so zum allgemeinen Gaudium im Olymp. Wortwörtlich zum Verhängnis wurden Netze der Besatzung des englischen Kriegsschiffs Mary Rose: Hunderte starben bei ihrem Untergang 1545 während einer Schlacht im Solent – primär deshalb, weil sie aufgrund der gespannten Abwehrnetze nicht von Bord fliehen konnten. Zu Zeit der Mary Rose verstand man unter einem »network« laut dem Online Etymology Dictionary ein »arrangement of threads, wires, etc., anything formed in the manner of or presenting the appearance of a net or netting«.1 Die Ausweitung des Begriffs, die metaphorische Anreicherung hin zu »any complex, interlocking system« (ebd.) fand erst Mitte des 19. Jahrhunderts statt und bezeichnete zunächst Transportwege wie Kanäle, Flüsse oder Eisenbahnstrecken – zu Beginn des 1. Weltkriegs dann bereits ein »broadcasting system of multiple transmitters«. Als »interconnected group of people« trat »network« erst um 1934 im Jargon der Psychologie (wen wunderts?) auf. Nachdem Mitte der 1970er Computersysteme miteinander verbunden wurden, dauerte es nur wenige Jahre, bis die Verbform »networking« auch auf menschliches Handeln bezogen wurde (»to interact with others to exchange information and develop contacts«). Neben der Euphorie über die neuen Kommunikations-möglichkeiten bestand auch damals schon ein latentes Unbehagen an den potentiellen Gefahren »im Netz der Systeme«.2 Im deutschen Sprachraum ist die Entwicklung ähnlich – die Vorstellung, wonach menschliche Beziehungs- und Interaktionsmuster Netz(werk)e darstellen, findet über Soziologie und Psychologie Mitte des 20. Jahr-hunderts Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch – das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache3 zeigt ab den 1980ern die Verwendung von Wörtern wie »vernetzen«, »networking« oder »netzwerken« in Zeitungsartikeln an, mit einem massiven Anstieg in den 2000ern.
Morbus avant-la-lettrismus
Eine beliebte Übung in den Geisteswissenschaften besteht im Aufspüren von Vorläufern: Gut 300 Jahre nachdem der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz 1714 mit der »Monadologie« seine metaphysische Substanzenlehre skizziert hat, fragt seine nachgeborene Kollegin Sybille Krämer, ob er als »Vordenker der Idee des Netzes und des Netzwerkes« gelten könne. Zu diesem Befund kommt sie zum einen, weil Leibniz »mit seinen über 15 000 Briefen an 1100 Briefpartner in 16 Ländern ein Netzwerk von Korrespon-denzen schuf«.4 Das ist zwar quantitativ bemerkenswert, allerdings war der (gerade auch öffentliche) Briefverkehr bereits vor Leibniz als Leitmedium etabliert und er befand sich damit in bester Gesellschaft (etwa in der des Erasmus von Rotterdam). Leibniz’ Briefkorrespondenz alleine wäre deshalb für Krämers Charakterisierung nicht unbedingt hinreichend – sie führt deshalb darüber hinaus ins Feld, dass sich bei Leibniz auch theoretisch »Ansätze zur Ordnungsform des Netzes« fänden und bezeichnet es als »implizites Muster«, das in diversen seiner Unternehmungen identifizierbar sei. Dabei weist sie klugerweise darauf hin, dass man zwischen stillstellenden (Fang)Netzen (die als geplantes Erzeugnis eine Außenperspektive erlauben) und – sich ungeplant entwickelnden – modernen Verbindungsphänomenen (in denen die daran Beteiligten als Knotenpunkte eben keinen Überblick über die Gesamtstruktur haben) unterscheiden müsse. Das ist naheliegend, da letztere Bedeutung als Begriff zu Leibniz’ Zeiten noch nicht etabliert war (s.o.) – worauf Krämer auch selbst hinweist. Dies bestätigen auch ein Blick in Johann Heinrich Zedlers »Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissen-schafften und Künste«5 oder auch das Grimm’sche Wörterbuch.6 Da stößt man zwar auf charmant mäandernde Beschreibungen verschiedener Verwendungsarten für »verfertigte Gestricke« samt einer Synopse ihres Vorkommens in schöner Literatur und religiösen Schriften, aber nicht auf den Gedanken, eine soziale Organisationsform damit zu benennen. Bereits bei Zedler findet sich aber ein Hinweis auf das metaphorische Potential von Netzen, da der Eintrag zu »Knoten« auf den zu »Nodi« verweist: »Nodi, Knoten, werden in der Astronomie Puncte genennet, in welchen die Bahn des Planeten die Ecliptick durchschneidet«. Krämer geht davon aus, dass für Leibniz die Netzwerk-Struktur von dessen metaphysischer Grundfrage vorgegeben wurde:
»Wie kann der ontologische Individualismus, demgemäß die Grundelemente der Welt aus Individuen bestehen, mit dem realen Verbundensein von allem mit allem zusammen gedacht werden? […] Das Moderne seiner Antwort besteht – so unsere Hypothese – darin, dass er diese Verbindung nach Art eines Netzes visioniert, dessen Spezifik es ist, einen sich selbst organisierenden Zusammenhang von individuellen Elementen zu bilden.«
Nodologischer Gottesbeweis
Was Krämer leider nicht hinterfragt ist die normative Annahme, wonach auch die Welt der modernen Netzwerke die beste aller möglichen sei (und insofern folgt sie hier Leibniz). Zum anderen muss man nicht unbedingt profund materialistisch geschult sein, um die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein aufzuwerfen. Anders formuliert: Inwieweit es nicht von der konkreten Gesellschaftsformation abhängt, ob diese als Netzwerk zu denken ist, bzw. – die erkenntnistheoretischen Implikationen ernst nehmend, an denen sich Alfred Sohn-Rethel zeitlebens abgearbeitet hat – inwieweit sich nur ein Sozialverband selbst als netzwerkförmig begreifen kann (egal ob apologetisch oder kritisch), dessen Denkstrukturen von ihrem gesellschaftlichen Handeln auf diese Art geprägt sind. Wir erkennen uns als vernetzte Wesen, da wir eine Gesellschaft vollständig entwickelter Marktförmigkeit bilden, in der Menschen Teil des Warentausches sind und sich dementsprechend als fungible, aber auch disponible Knotenpunkte, als gleichartige Monaden eines Gesamtsystems begreifen, in dem sie als nomadische Noden herumwandern und das sie zwar im engeren Umkreis beeinflussen, aber nicht grundsätzlich ändern können. Die Totalität des Tauschprinzips bedeutet, dass unsere individuellen Besonderheiten dem Primat der Wertform untergeordnet werden, in dem es darauf ankommt, von allen natürlichen Unterschieden abzusehen, die Dinge und Lebewesen ausmachen und sie als (potentielle) Waren aufeinander zu beziehen. Die Beziehung zur Welt reduziert sich auf das reine Abmessen von Quantitäten und pervertiert jene Fähigkeit im Umgang mit Qualitäten, die Adorno als Kennzeichen von Liebe bestimmt hat: »Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen«.7 Auf gesellschaftlicher Ebene negiert die abstrakte Gleichheit wiederum die utopische Forderung nach einer Gesellschaft, in der die Differenzen nicht eliminiert, sondern versöhnt sind, in der man »ohne Angst verschieden sein kann«.8
Was bedeutet das politisch?
Stellen wir uns doch zum Abschluss die Organisationsfrage. In Folge der berechtigten und notwendigen Kritik am Autoritarismus in linken Kad(av)erparteien Lenin‘schen Zuschnitts organisierten sich Teile der radikalen Linken in Form dezentraler Bezugsgruppen, autonomen Zellen (Italien, Deutschland); nicht zuletzt inspiriert von der Idee freier Assoziation, wie sie in Kommunismus und Anarchismus angelegt ist. Eine Interpretation wäre, dass das kapitalistische System diesen Ansatz (wie auch das Prinzip flacher Hierarchien) absorbiert und in Form scheinselbstständiger Ich-AGs in den Zwang zur Mehrwertproduktion integriert hat. Eine andere – unbequemere – Lesart ist, dass Kapitalismus und die Versuche seiner Überwin-dung in denselben – kapitalistisch konstituierten – Sozial-, Handlungs- und Denkformen fußen. Das existentielle (und dass es ums Überleben geht, sollte unstrittig sein) Paradox besteht also darin, wie man sich im schlechten Hier und Jetzt mit den vorhandenen Möglichkeiten so formiert, dass eine Gesellschaftsform entsteht, die eben diese Organisationsformen obsolet macht und durch solche ersetzt, die bestenfalls als Vorschein antizipierbar sind. In diese Verstrickung hat sich die Menschheit selbst begeben (wenn auch nicht bewusst) und nur sie kann sich aus ihr befreien.