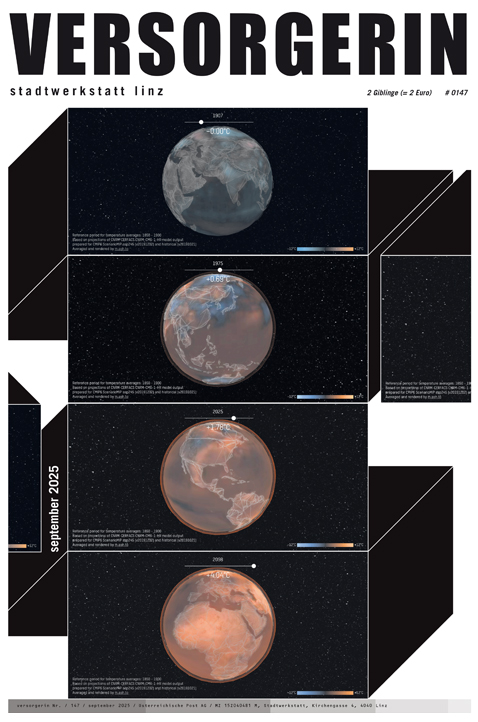In Pädagogik und Psychologie, feministischen Vereinen und Projekten, Mentoring-Programmen und Medien erscheinen weibliche Vorbilder nicht nur aufgrund der generellen Notwendigkeit von Vorbildern für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen als vollkommen unbedenklich und absolut unterstützenswert. Diesbezügliche Forderungen und Fördermaßnahmen nehmen in den letzten Jahrzehnten zu, die Zahl und Arten weiblicher Identifikationsfiguren steigen in jedem kulturellen und ökonomischen Bereich. Gleichzeitig wird in den letzten Jahren der in den 1960ern mit der Ausbreitung der Kulturindustrie in den USA eingeführte Begriff der parasozialen Beziehung von der Medienpädagogik und -psychologie wieder ausgegraben. Stets übersehen wird jedoch der für viele Frauen und Mädchen folgenschwere Zusammenhang der beiden Phänomene.
Idealisierung oder Idolisierung?
Die Psychoanalyse belegt, dass die Entwicklung eines jeden Menschen mit den »ersten autoerotischen sexuellen Befriedigungen« (Freud 2018: 20) beginnt, die mit jenen der Selbsterhaltung zusammenfallen (z.B. Ernährung, Schutz). Später stellt das Kind jedoch fest, dass es die Eltern erhalten und beginnt daher, diese als Sexual- und Liebesobjekt zu sehen und zu idealisieren. Im Zuge des ödipalen Konflikts werden die Eltern dem normalen Subjekt aber auch zu strafenden Autoritäten und Vermittlern gesellschaftlicher Anforderungen und Moral. Es integriert diese und entwickelt ein Über-Ich in Form eines Gewissens, bestimmten Werten und eines Ich-Ideals, mit dem die eigenen realen Handlungen, Äußerungen oder Triebe oftmals in Konflikt stehen. Später kommen jedoch auch andere Triebobjekte hinzu, die im Namen des Feminismus als Vorbilder und projizierte Personifizierung des Ich-Ideals junger Frauen und Mädchen fungieren, sie ermutigen und inspirieren bzw. empowern sollen. Während Plädoyers und Strategien für die Anerkennung einer gewissen Gleichheit oder für Gleichstellung der Geschlechter im Sinne der eingeschränkten Möglichkeit von Emanzipation als zumindest »individuelle[r] Befreiung von den Zwängen der Identität« (Kunstreich/Achersleben 2018: 50) zu begrüßen sind, kommt es manchmal gar zu einem differenzfeministischen Aufgehen in dieser und geschlechtsbezogenem Antiuniversalismus. Dieser geht von unhinterfragbaren, spezifisch weiblichen oder nicht-cis-männlichen Identitäten, Eigenschaften oder Fähigkeiten aus und konstruiert oft weibliche Idole und Götzen anstatt Vorbildern.
Ich selbst bin zu den Anfangszeiten des Internets, auf dem Land und v.a. familiär und subkulturell unter Männern groß geworden – also ohne weibliche Vorbilder und nie als gleichwertiger Teil der (Bruder)horde oder ‚one of the boys‘. Programme wie Frauen und Technik, die Spice Girls oder Sex and The City, das steigende Interesse an Frauenfußball uvm. waren Ergebnisse des Strebens nach Gleichheit. Viele Forderungen waren damals bereits umgesetzt und sind es heute noch mehr, in manchen Bereichen gelten gar Frauenquoten. Etliche unserer Mütter emanzipierten sich von ihren Partnern und wurden uns (auch nach der Kindheit) als arbeitende und alleinerziehende Frauen zu Vorbildern. Viele von uns hatten deshalb trotz Hochstaplerkomplexen und der Einordnung als ‚Freundin von …‘ ein grundlegendes »Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit« und das Wissen darum, dass auch Männer, deren Fähigkeiten und Erfolge die zu erreichende Norm darstellten, »mit ihren eigenen Mitteln geschlagen werden [konnten]« (ebd.). Man wollte nicht nur ‚good for a girl‘ sein: Als einzig weiblicher Punk in meiner Klasse der BHAK und als ungebildete Hauptschülerin vom Land war ich den anderen 4 Punkerburschen, meinen Peers, stark unterlegen, was mich anspornte, »nicht nur gleichgestellt, sondern besser sein zu wollen« (ebd.). Also begann ich, heimlich Zeitung zu lesen, ungekannte Begriffe aufzuschreiben und zu lernen etc. und wurde Klassenbeste.
Räume wie die Wissenschaft boten – so Tjark Kunstreich und Matthias Achersleben 2018 – schon im 19. Jahrhundert Frauen und Juden die Möglichkeit, sich als »selbstmächtige Subjekte … über das ihnen zugedachte […] Schicksal [zu] erheben« und somit einen »Ausweg aus der Zuschreibung« (ebd.) zu finden. Dasselbe galt auch in der Schule. Später auch in manchen Kurven wie der Vienna oder z.B. an der ÖH und hinterm DJ-Pult, wo auch ich weibliche Peers fand, die mir teils zu Vorbildern wurden. Eine vollständige Assimilation war es jedoch nicht – nicht zuletzt aufgrund der höchstindividualisierten, egalitäreren, aber ticketförmigen Gesellschaft. Die meisten von uns blendeten z.B. weder den misogynen Backlash auf die scheinbare Emanzipation der Frau aus, noch vermuteten alle von uns überall das Patriarchat oder verfielen der Sakralisierung und Essentialisierung des ‚Weiblichen‘. ‚Same same, but different‘ eben. Viele von uns waren auf eine gewisse Art Pionierinnen: die erste Fanbeauftragte des FC, die erste der Familie, die studiert (in beiden Fällen überhaupt der erste Mensch), eine der wenigen Frauen, die es ausm Dorf schafft etc. Denn mit zunehmender Gleichstellung und Repräsentanz, durch Förder- und Bildungsmaßnahmen bis hin zur Kulturindustrie, wurden die Lügen des neoliberalen Glücksversprechens und einer Tabula rasa mit unbegrenzten Möglichkeiten auf die Frauenwelt ausgeweitet.
Gestörte Subjekt-Objekt-Bildung
Mangels weiblicher Vorbilder und vorgegebener Pfade und aufgrund des Wissens um die Grenzen dieser Möglichkeiten, verspürten etliche von uns simultan Bedrängnis und Freiheit. Wir wollten als Gleiche den eigenen Weg des Begehrens einschlagen und niemandem vollends folgen oder nacheifern. Es gab für uns lange kaum Frauen, mit denen wir uns identifizierten, und manche von uns standen in Zeiten von Bravo dem übertriebenen Fantum generell etwas skeptisch gegenüber. Aufgrund von ‚same same, but different‘ war außerdem eine gewisse Differenz und Distanz zu männlichen Vorbildern stets vorhanden. Insgesamt war also bei manchen ein geringeres Risiko der Überidentifikation vorhanden.
Aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung und dem Verschwimmen von Privatheit und Öffentlichkeit und dem Trend, »den Menschen als Gesamtpaket der Mehrwertproduktion zuzuführen« (Möller 2021: S. 23), quellen aktuell aber viele Lebens-, Politik- und Wirtschaftsbereiche mit (online) stets verfüg- und nah-, dennoch unerreichbaren Sheroes und Girl Bosses über. Die Ära von selbstständigen Kleinbürgerinnen, zeitlich begrenzten Projekten und Karrieren wie Content Creator, Influencer oder Aktivistin erfordert vom Subjekt konstante Erreichbarkeit, Flexibilität und nicht zuletzt ein Dasein als wandelnde Litfaßsäule für die eigene Arbeit, Softskills oder DEI-taugliche1 Merkmale. Mehr noch: die öffentliche Zurschaustellung der ganzen Person bzw. der für Linked-In oder TikTok zurechtgestutzten Projektion des in diesem Falle angepassten, dennoch feministisch-kämpferischen Ideals. Da diese Ära mit einer Culture of Narcissism (vgl. Lasch 1979) und autoritären Charakteren einhergeht (vgl. Henkelmann et al. 2020), kommt es nicht von ungefähr, dass es einerseits Sheroes gibt, die durch ihre Vorbildwirkung und Eigenvermarktung narzisstische Selbstliebe und Größenwahn befriedigen (vgl. Freud 2018: 23, Kernberg 1983: 34) und andererseits ihre manchmal obsessiven, grenzüberschreitenden und zwischen Demut und lauten Forderungen schwankenden ‚Follower‘. Da erstere ein starkes Bedürfnis danach haben, »von anderen geliebt und bewundert zu werden« (Kernberg 1983: 35), sich zu exhibitionieren und anderen ‚eine Inspiration/ein Vorbild‘ zu sein, ist die Kränkung umso größer, wenn Erfolg, Liebe und Bestätigung entweder ausbleiben oder ihnen aufgrund eines Skandals, Trends oder Unnahbarkeit und Distanz von letzteren wieder entzogen wird.
Manche Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen oder Aktivistinnen spielen dieses Spiel z.B. auf Social Media notwendigerweise, aber widerwillig und nicht kritiklos mit. Sie, wir, vermischen – anfangs naiv – Arbeit und Privates, müssen irgendwann schockiert feststellen, dass sie keine kleinen anonymen Pupse mehr sind, sondern viel eher als nischiger Z-Promi oder Vorbild uvm. wahrgenommen werden – egal, ob sie sich den Schuh (als Heldinnen wider Willen) anziehen wollen oder nicht. (Nicht nur) Frau wird von Fremden oder kaum Bekannten als ‚gesamte Person‘ be- und verurteilt, obwohl diese vielmehr bloßes Triebobjekt ist und diverseste Projektionen ihrer ‚Fans‘ oder ‚Foes‘ repräsentiert. Dies gilt natürlich für weibliche wie auch männliche ‚Fans‘ und auf mannigfaltige Arten. Wir werden beispielsweise von Fremden im Club erkannt und/oder (teils unwissentlich) gezielt angesprochen oder angefreundet, haben im Anfrageordner immer neue Nachrichten von denselben 10 bis 20 Frauen, die seit Monaten versuchen, Nähe aufzubauen und bekommen von jungen Frauen gesagt, dass sie gerne »so wären wie« man selbst. Vorbild- anstatt Idol-/Götzenbildung bedeutet jedoch nicht, vollends wie jemand anderes sein zu wollen, sondern ‚sich eine Scheibe von Person … abzuschneiden‘ oder von jemandem ‚inspiriert‘ oder ‚motiviert‘ zu sein – vor allem unter Freundinnen oder im Austausch auf Augenhöhe unter weiblichen Peers, also Personen im (nahen) Umfeld anstatt Fremden. Es geht also um bestimmte (tatsächliche oder projizierte) Eigenschaften der Vorbilder, nicht die gesamte Person. In parasozialen ‚Beziehungen‘ mit oder bei der Idolisierung durch ‚Followerinnen‘ zeigt sich hingegen einen großer »Neid auf andere und die Neigung, solche Menschen, von denen narzißtische Zufuhren zu erwarten sind, stark zu idealisieren, wohingegen andere, von denen nichts (oder nichts mehr) zu erwarten ist – häufig ihre früheren Idole – entwertet und mit Verachtung gestraft werden« (ebd.). Der Analytiker Otto Kernberg bezeichnet diese Subjekte als »parasitär[…]« (ebd.), nur schwer »der Selbst-Objekt-Differenzierung« (ebd: 46) fähig oder anfällig für eine »primitive Idealisierung […], die Neigung, (bestimmte) äußere Objekte zu ‚total guten‘ zu machen, damit sie einen gegen die bösen Objekte beschützen«, die »unrealistische, ‚nur gute‘ und übermächtige Objektimagines hervor[bringt]« (ebd: 50). Genügend Gründe also, kein weibliches Vorbild sein zu wollen – vor allem, wenn man eigentlich keines ist, sondern bloß überidealisiertes Objekt, das wie das personifizierte Böse behandelt wird, sobald es sich nicht der Projektion entsprechend verhält.
Literatur
Freud, Sigmund (2018): Zur Einführung des Narzissmus, Brétigny-sur-Orge: Inktank
Henkelmann, Katrin et al. (2020): Konformistische Rebellen, Zur Aktualität des autoritären Charakters, Berlin: Verbrecherverlag, 2. Auflage
Kunstreich, Tjark/Achersleben, Matthias (2018): In den Regenbogenfarben der Unterwerfung, in: Bahamas, Nr. 80, Winter 2018, S. 48 – 53.
Kernberg, Otto (1983): Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus, Frankfurt a. Main: Suhrkamp
Lasch, Christopher (2018): The Culture of Narcissism, American Life in an Age of Diminishing Expectations, Neuausgabe, New York: W.W. Norton & Company
Möller, Mario (2021): Team Regenbogen gegen Ungarn, in: Bahamas, Nr. 88, Herbst 2021, S. 20 – 24.