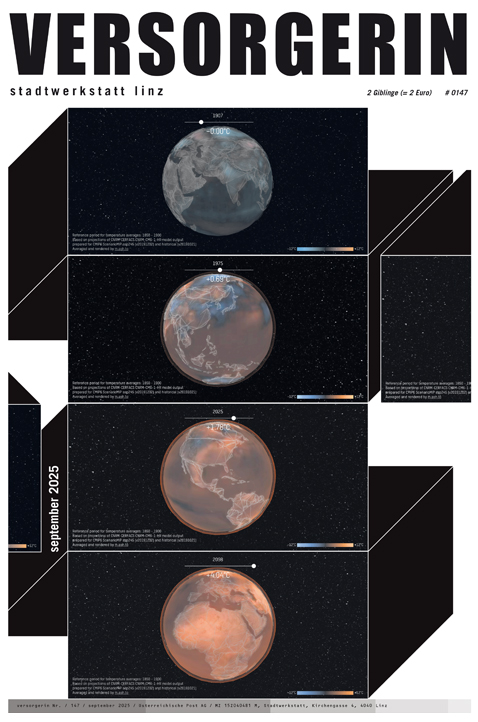Was haben die Queer-Ikone Paul B. Preciado, Fifty Shades of Grey, ein Film namens Babygirl und der Buchpreisträger Kim de l’Horizon gemeinsam? Nicht viel, aber sie alle glauben, dass Schmerz, Gewalt und Unterwerfung sexy sind – oder, was auf dem postmodernen Markt der Beliebigkeit dasselbe meint, dass Begehren ohne Herrschaft nicht mehr zu haben sei. Einst zur abgründigen Randerscheinung bürgerlicher Dekadenz erklärt, feiert der Sadomasochismus heute als popkultureller Empowerment-Mythos fröhliche Urständ: BDSM gilt als chic, subversiv, queer. Vor allem aber ist er wahnsinnig kompatibel mit den spätkapitalistischen Algorithmen von Netflix und Instagram.
Spätestens seit Fifty Shades of Grey darf nun auch im Reihenhaus mit Carport geknebelt und gefesselt werden – nicht, weil man die Ordnung infrage stellt, sondern als therapeutische Maßnahme gegen die libidinöse Ödnis. Der Sadomasochismus wird zur Paartherapie, das Rollenspiel zur Restverwertung erotischer Leidenschaft. Erika Leonard alias E. L. James hat nicht nur eine sadomasochistische Phantasie niedergeschrieben, sondern eine neoliberale Triebökonomie im Korsett der Einvernehm-lichkeit: Ein Milliardär (natürlich sadistisch) kauft das Einverständnis einer studentischen Unschuld (natürlich devot) – und nennt es Liebe. Dass dabei Subkultur zur Prime-Romantik avanciert und der Handlungsstrang noch plumper ausfällt als in den meisten Arztromanen, interessiert offenbar niemanden, solange der Vertrag unterschrieben ist und der »Playroom« geschmackvoll eingerichtet. Während Christian Greys erotischer Charme das Objekt seiner Begierde, Anastasia Steele, in einen Zustand hormoneller Willfährigkeit versetzt, dämmert ihr nach kurzem Widerstand, dass zur Aufrechterhaltung dieses asymmetrischen Verhältnisses ein Personal Trainer hermuss, um mit dem testosterongesättigten Habitus ihres Gegenübers überhaupt physiologisch mithalten zu können. Vor diesem Hintergrund reagiert der Sadomasochismus – zumindest als urbaner Mittelstandstrend – auf eine Realität, die selbst sadistisch organisiert ist: durch Leistungsdruck, Konkurrenz und der ständigen Zurichtung des Körpers zur Ware.
Mit Babygirl (2024) ist Fifty Shades of Grey nun auch fürs geneigte Arthouse-Publikum im Kino zu bewundern: ein queerer Indie-Film, in dem das Ringen um Kontrolle, Abhängigkeit und Lust in die Ästhetik der Selbstermächtigung gegossen wird. Die Kamera streichelt, statt zu starren, das Setting ist konsensual, die Gewalt kunstvoll dokumentiert. Wann genau die Züchtigung mit der Peitsche zur feministischen Praxis umetikettiert wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen – wahrscheinlich irgendwo zwischen der dritten Welle des Feminismus und der vierten Staffel einer Streamingserie, in der Selbstermächtigung sich vorzugsweise in Lack, Leder und safe words artikuliert. Was früher als Ausdruck patriarchaler Gewalt galt, wird heute als mutige Entscheidung zur eigenen Lust gefeiert. Die Erniedrigung ist nun nicht mehr Symbol der Unterwerfung, sondern Zeugnis emanzipatorischer Selbstbestimmung – vorausgesetzt, sie geschieht freiwillig und in einem bürgerlich abgesicherten Rahmen.
Der eine ein BWL-Porno für gelangweilte Hausfrauen, der andere ein queeres Kuschel-Kammerspiel mit weiblichen CEO-Ambitionen, verkaufen sowohl Fifty Shades of Grey als auch Babygirl unterm Strich dieselbe ideologische Botschaft: Machtspiele als Selbstverwirklichung, Erniedrigung als Erleuchtung, Schmerz als Lifestyle. Man soll schließlich zu sich selbst finden – auch wenn das bedeutet, sich dabei in einen Ledergurt zu schnallen. Unter der Regie von Halina Reijn und mit Nicole Kidman in der Hauptrolle als CEO Romy, die eine Affäre mit einem jungen Praktikanten beginnt, wird in Babygirl ein Bild von BDSM gezeichnet, das so glattpoliert ist wie ein frisch gewienertes Parkett. Die Darstellung von Macht und Unterwerfung wird hier nicht in schmutzigen Ecken oder düsteren Kellern verhandelt, sondern in klimatisierten Büros und luxuriösen Hotelzimmern. Und während Fifty Shades of Grey immerhin noch den Versuch unternimmt, die seelischen Trümmerlandschaften seiner Figuren auszuleuchten, verzichtet Babygirl schon ganz auf jede psychoanalytische Kulisse. Die frohe Botschaft lautet hier: Deine Triebe brauchen keinen Ursprung, keine Geschichte, keine Rechtfertigung – sie sind einfach da. Und du darfst, wie es der Zeitgeist verlangt, eine willige Hündin sein, bar jeder Ironie, dafür mit Boss Babe-Hashtag.
Die geistige Ahnenreihe dieses Irrsinns reicht tief hinein in den erotischen Irrationalismus der Aufklärung: Marquis de Sade, der früh erkannte, dass der Mensch im tiefsten Inneren kein Vernunftwesen ist, sondern ein durchtriebener Triebling. Georges Bataille, der daraus ein ganzes metaphysisches System der Ekstase und Transgression bastelte, ein Mystiker des Schmerzes mit bibliophilem Wahnsinn. Und schließlich Pauline Réage, die mit Geschichte der O bewies, dass Frauen auch ohne Männer freiwillig alles aufgeben können – sogar ihre Subjektivität. Während die Sadisten früherer Tage noch offen ihre Lust an der Übertretung zelebrierten und alles Tugendhafte verlachten, wähnen sich ihre heutigen Adepten im Vollzug höherer Moral. Der Schlag ins Gesicht kommt jetzt im Namen des Guten – und trifft umso sicherer, weil er sich als Fortschritt tarnt. Der Marquis de Sade, der in seinen Schriften nicht weniger als die vollständige Auflösung der Moral forderte, verstand den Sadismus als Naturrecht des Stärkeren. Ein schamloser Nihilist, der in einer Zeit des Umbruchs (man schrieb 1789) die Fesseln der Vernunft zerschnitt und den Trieb an ihre Stelle setzte. De Sade war kein Feminist, kein Befreier – er war das Spiegelbild der Aufklärung, in ihr Gegenteil gestürzt. Dass seine Texte heute in Genderseminaren zitiert werden, wäre ihm vermutlich selbst ein Rätsel.
Der ursprüngliche Katalysator dieser zeitgeistkompatiblen Lust am Leiden ist, wie so oft, im Mittelstandsmilieu der Universitäten anzutreffen. Michel Foucault, einst Kritiker institutioneller Macht, ist zur Gallionsfigur der sadomasochistischen Theoriebildung geworden. Aus seinen Überlegungen zu Biopolitik, Disziplin und Körperregimen hat man eine Art philosophischen Freibrief gebastelt: Wer sich selbst knebelt, unterläuft die Macht. Doch gerade in der queeren Aneignung des Sadomasochismus zeigt sich, wie schnell eine radikale Geste zur ästhetischen Pose wird. Die Popliteratur steht dem nicht nach, hat das Genre endgültig entpolitisiert. Die Fantasie von Unterwerfung wird zur Shoppingliste – mit Konsensvertrag und ausführlicher Anleitung zur Aftercare. Alles ist erlaubt, solange es sich freiwillig vollzieht. Dass sich unter dieser Freiwilligkeit eine neue Form von Herrschaft versteckt, bleibt ausgeblendet. Der Zwang zur Lust ist die neue Askese, der Vulgär-Liberalismus wird zur Ersatzreligion des fragmentierten postmodernen Subjekts, das sich selbst nicht mehr spürt.
Wohin der schmerzdurchtränkte Tunnelblick auf den eigenen Körper führt, lässt sich eindrucksvoll am Kontrasexuellen Manifest des derzeit gefeierten transsexuellen Theoretikers Paul (vormals Beatriz) Preciado studieren. Für den Absolventen der Päpstlichen Universität von Comillas ist das Ziel der Geschlechteremanzipation die technische Überwindung des leiblichen Überbaus. Das Lustempfinden spiele sich gerade nicht in lebendigen Organen ab, sondern in deren technischen Prothesen. Hinter dieser eigentümlichen Umdeutung steht der gekränkte und verachtungsvolle Blick auf den eigenen Körper, der bei Preciado ein einziger Haufen von Exkrementen ist und deshalb dringend erlöst werden muss. Dem Manifest beigefügt ist eine ausführliche Gebrauchsanweisung zum Dildosex, die so trostlos anmutet, dass sich der Wunsch nach einem sexbefreiten Leben geradezu aufdrängt. Preciado entwirft ein postpornografisches Subjekt, das sich zwischen Hormonspritze und Konsensvertrag neu erfindet – als ob sich der Mensch durch Medikamente und autoritäre Gesellschaftsentwürfe befreien ließe.
Der Körper ist ein Labor, das Geschlecht eine Prothese, die Lust ein technologisches Dispositiv. Der philosophische Furor, mit dem Preciado den phallozentrischen Diskurs dekonstruiert, endet ironischerweise im selben Panoptikum wie Sades Juliette: nur wer sich ausliefert, darf begehren. So geht es auch dem Erzähler des nicht-binären Buchpreisträgers Kim de l’Horizon, der seine Homosexualität zwar zum Teufel wünscht, aber doch nichts anderes tut, als permanent schwulen Sex zu praktizieren, und das in einer möglichst krassen, erniedrigenden, von Selbsthass bestimmten Form. Die Kritik feiert das als authentisch. Aber ist so viel queer-politisch legitimierte Schwulenfeindlichkeit schon dann ein Schritt in eine bessere Gesellschaft, wenn man ihr ein progressives Etikett überstülpt?
Rein theoretisch betrachtet ließe sich das sogar verstehen. Die Wut auf alles Zweigliedrige, also aufs Denken in Unterscheidungen, stammt aus der letzten Ausdünstung einer akademischen Sekte, die sich als Emanzipationsversprechen ausgibt, unterm Strich aber doch nur alten metaphysischen Müll in neue Begriffe überführt. Was da als radikale Kritik des Körpers firmiert, ist in Wahrheit bloß eine Umschrift für das Unbehagen an der Realität – ganz im Sinne der späten 68er, die mit der Welt brechen wollten, weil sie sie nicht ändern konnten. Preciado und l’Horizon sind keine Irrläufer, sondern Produkte dieser akademischen Ersatzhandlung: dem Versuch, mit Sprachregelungen und Identitätsbasteleien das anatomische Schicksal zu überwinden. Dass das nicht funktionieren kann, ist offensichtlich – darum auch der enorme ideologische Aufwand, der betrieben wird, um die eigene Ohnmacht als radikale Erkenntnis zu verkaufen. Kritik daran ist nicht vorgesehen, höchstens als Beweis für das Fortbestehen der Gewalt, gegen die man sich so heldenhaft inszeniert und gleichzeitig gegen sich selbst wendet.
Vielleicht ist genau das der Punkt: Die Freiheit, sich freiwillig zu unterwerfen, ist das perfekte Symbol unserer Zeit. Wo der Neoliberalismus das Ich zum flexibel umprogrammierbaren Identitätenbaukasten gemacht hat, wird der Schmerz zur letzten authentischen Erfahrung verklärt. Was früher die Seele war, ist heute das vom Körper entfesselte Ich – angeblich fluide, tatsächlich aber wirr. Preciado und l’Horizon sind die modernen Exegeten einer Ersatzreligion, in der jede narzisstische Kränkung als unbedingt zu respektierende Identität gehandelt wird. Insofern ist der neue Sadomasochismus auch kein Skandal, sondern eine konkrete Antwort auf die Zumutungen der Gegenwart. Wer sich selbst schlägt, muss nicht mehr auf Befreiung hoffen. Und wer freiwillig kriecht, kann nicht mehr fallen. Das ist die Ironie des Liberalismus im Zeitalter seiner vollständigen Entleerung: selbst der Schmerz muss heute demokratisch legitimiert sein.