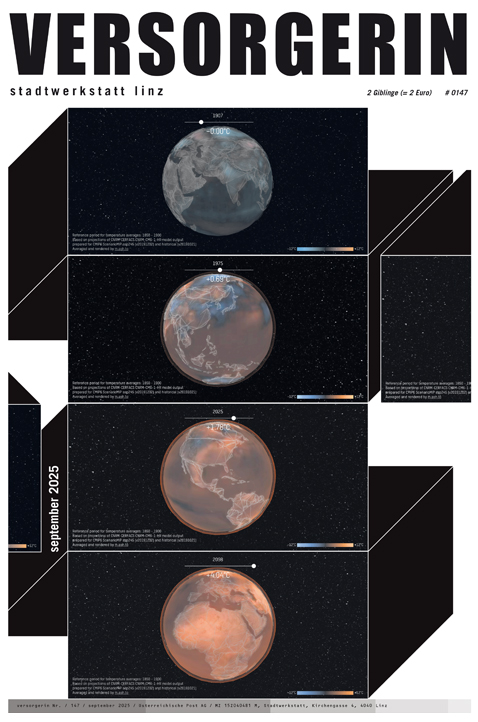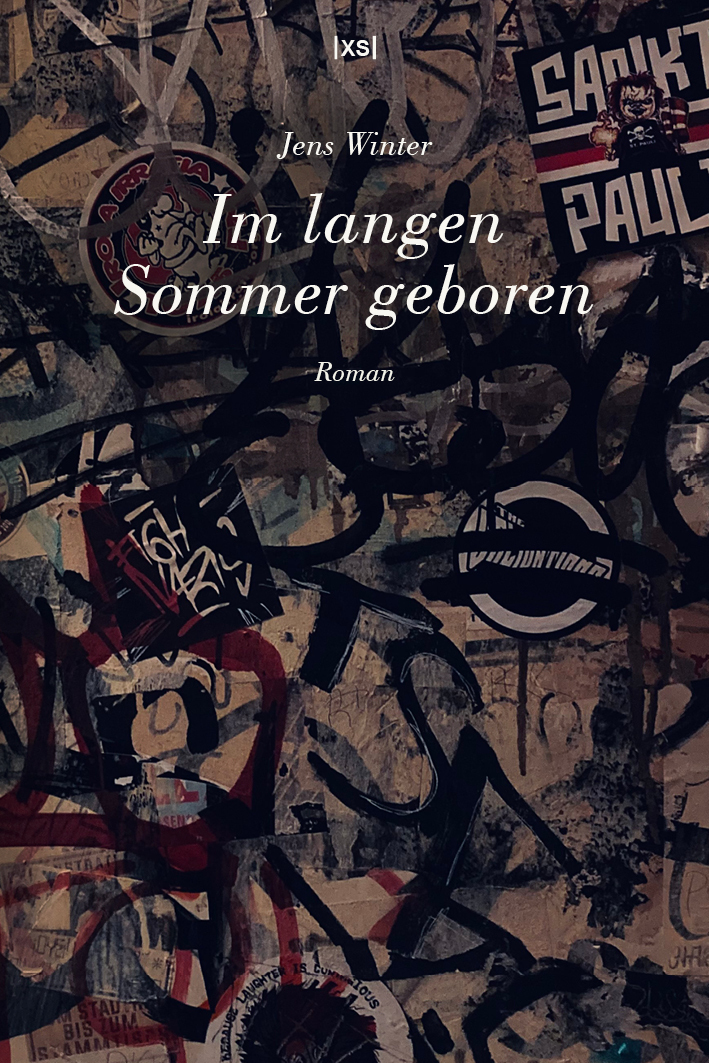Jens Winters Debütroman »Im langen Sommer geboren« spiegelt die tiefe Verunsicherung und Orientierungslosigkeit von Menschen einer wohlhabenden gesellschaftlichen Schicht, die sich in die Zwänge einer pervertierten linken Ideologie flüchten. Das Unverarbeitete und Verdrängte, das sich in dieser Kompensation verbirgt, scheint auf – das Buch deutet einen Weg an, die eigene Empfindung vor einer kollektiven Übernahme zu retten.
Ein namenloser Ich-Erzähler streift durch die gegenwärtige linke Szene Berlins. In der vom Autor geschilderten Welt wird jede zwischenmenschliche Beziehung, jede Meinungsäußerung und Handlung, selbst das Tragen der Kleidung nur noch aus Sicht einer politischen Gesinnung beurteilt und bestimmt. Die Menschen, die sich darin finden, haben ihre Identität auf das Gesinnungsbekenntnis zu einer Ideologie beschränkt. Dieses Bekenntnis, das sich über die Darstellung und die Pose definiert, sowie Wiederholen von kollektiven Codes, wird zur Grundlage, um an diesen Orten akzeptiert zu sein und einen unüberbrückbaren Kontrast zu vermeiden. Es handelt sich bei diesem Buch nicht um eine Fiktion oder eine Dystopie – es sind reale Lebenswelten, die da geschildert werden.
Patrick, ein Freund des Erzählers, will dem Ursprung der deutschen Disziplin durch sein Studium Preußens nachgehen. Er begeistert sich für das »Lied von Eis und Feuer«, dem auch der Titel des Buches entnommen ist, sowie für die daraus entstandene Serie »Game of Thrones«. Durch ihn wird angedeutet, dass Zusammengehörigkeit über den kollektiven Konsum eines Fantasyromans und einer Fantasyserie geschaffen wird und nicht über das Bewusstsein der tatsächlichen gemeinsamen Geschichte.
An Pois, eine Art Doppelgänger des Erzählers, wird deutlich, dass man sich seine Identität nicht aussuchen kann, sondern dass sie immer auch von dem Leben der Vorfahren bestimmt ist – eben von der Tatsächlichkeit von dem, was ist, und nicht von dem, was man gerne hätte.
Sein Großvater war im KZ Auschwitz als Chemiker tätig. An ihm entlädt sich die Weigerung der Verarbeitung und Begegnung mit der eigenen Geschichte, sowie als Ausgleich eine Flucht in eine kollektive Ideologie, die gewaltvolle Form annimmt.
Michel lässt nach einem Auslandsjahr an einem Liberal Arts College in den USA keine Gelegenheit mehr aus, dem Erzähler, mit dem er in einer WG zusammenwohnt, seine problematische Männlichkeit erklären zu wollen.
Dieser versteht nicht, warum Michel sich in dieser Position aufspielt, wo er doch selbst ein Mann ist. Die Freundschaft zwischen den beiden zerbricht daran, dass der Erzähler die Frage stellt, ob es nicht im Grunde seine eigene Minderwertigkeit sei, gegen die er kämpfe.
Diese Sequenz kann exemplarisch für das gesamte Milieu gelten, in dem der Roman sich abspielt und das sich im Erzähler spiegelt. Es ist ein Milieu der Privilegierten, das sich aus dem Wohlstand der Nachkriegszeit im Westen geformt hat. Die Menschen, die darin leben, sind mit der Maxime aufgewachsen, dass sie alles sein können, was sie sein wollen.
Diese Anspruchshaltung, die auf nichts gründet, braucht Stützen, die sie tragen können. Kollektiv wird das linke Gedankengut herangezogen, das sich aus dem Elend derer speist, die eine Wirklichkeit erleben, die diesen Menschen, die nur aus Anspruch und Vorstellung bestehen, nicht fremder sein könnte. In der Maske des Guten wird das Leid und die Erfahrung der Ungerechtigkeit von anderen dazu missbraucht, sich selbst zu erhöhen.
Ein Geflecht wird gebildet, in dem der Grad der Anpassung und Unterwerfung zum Maßstab wird. Gleichzeitig werden jene, die es tatsächlich schwerer haben, als Opfer zur Schau gestellt, um sich an ihrer Wirklichkeit zu nähren.
Das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, die Empfindung der »eigenen Minderwertigkeit« verschwinden nicht, sind durch dieses Handeln nicht ganz zu tilgen und entladen sich in Schuldzuweisungen und Schein-Kriegen mit im Grunde gleichgesinnten Mitmenschen.
Das Buch deckt diese Haltungen auf.
Gleichzeitig finden sich im Erzähler dieselben Merkmale, die das Milieu ausmachen, in dem er sich befindet. Der Geltungswahn, der Zug, seine Befindlichkeit zum Maßstab zu erheben, das Einordnen seiner Umgebung aufgrund von Oberflächlichkeiten und Codes bestimmen auch ihn.
So auch die Widersprüchlichkeit. Er erkennt zwar die Unwahrhaftigkeit der ihn umgebenden Ideologie, doch verlässt sie nicht konsequent und will an der Welt, in der sie bestimmend ist, teilhaben.
Was ihn unterscheidet, ist, dass er sein eigenes Empfinden und Urteilsvermögen zulassen möchte, dass er sich nicht zufriedengibt, sich den Wahrnehmungsschablonen und Maximen seines Umfelds restlos zu unterwerfen. Das äußert sich in einer gewissen Selbstironie und mündet in eine sich steigernde Verstörung und Verwirrung, die ihn schließlich mit seiner Umgebung unvereinbar werden lässt.
Was für das Milieu und für den Erzähler gilt, gilt in einem gewissen Sinne auch für den Autor.
Er benutzt ein anderes Buch, die Wirklichkeit eines anderen, um ein eigenes zu schreiben und seine Vorstellung des Schriftstellerseins zu erfüllen. So sind Form, Sprache, die naive Haltung des Erzählers sowie die gesamte Erzählstruktur, die ihn von Station zu Station treibt, Christian Krachts »Faserland« entnommen.
In diesem Sinne begeht auch er die Verweigerung der Begegnung mit sich selbst, lässt seine Stimme durch die Autorität eines Anderen sprechen. Der Unterschied allerdings ist, dass es sich bei Christian Kracht nicht um ein Kollektiv handelt, sondern um einen Schriftsteller.
Jens Winter erinnert daran, dass Kollektive das Aufgeben der eigenen Souveränität und Empfindung fordern, während die Begegnung und Besetzung durch ein eigenständiges Werk den Weg zum Eigenen offen legen. Somit kann dieses Buch als Übergang zu einer eigenen Stimme gesehen werden und Kracht als Wegweiser. Das Zulassen seines eigenen Empfindens, das den schonungslosen Blick auf das ihn umgebende Kollektiv nicht scheut, macht es zu einem gelungenen Debüt.