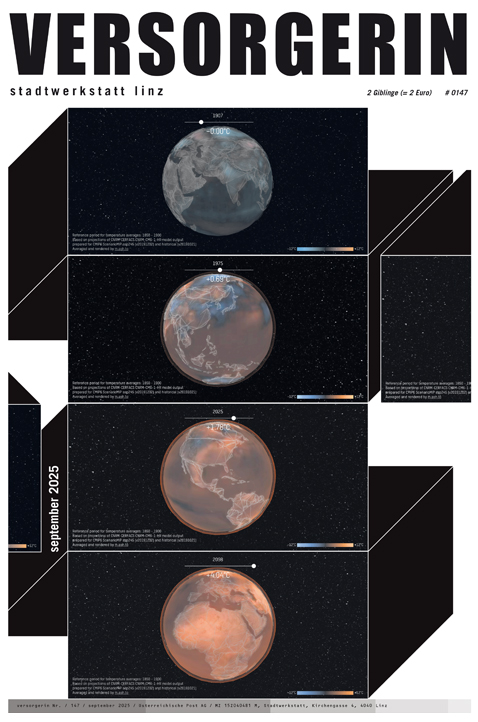1953 kommt der Psychiater und Philosoph Frantz Fanon in das Gebiet der algerischen Mitidja. Neben ärztlichen Utensilien führt er die Schriften von Sartre und Camus im Gepäck. Die Psychiatrie, an der er in den nächsten Wochen eine Stelle als Chefarzt antreten wird, liegt unweit eines Orangenhains, inmitten davon verflüssigen sich Früchte. Seit 1951 wird in der Fabrik der »Société Naranjina Nord-Afrique« in Boufarik eine Limonade mit geheimer Rezeptur hergestellt. Ein halbflüssiger Fruchtsatz bildet die Basis für das vor Ort abgefüllte Freizeitgetränk, seine Abnehmer findet es vor allem auf der anderen Seite des Mittelmeers. Im Mutterland nuckeln zu groß geratene Kinder die orangefarbene Milch aus bauchigen Fläschchen mit aufgerauter Oberfläche. Sie ähneln Flakons mit irisierendem Öl – und beim Öffnen soll ihnen ein ganz besonderer Geist entweichen.

Frantz Fanon mit dem medizinischen Team der psychiatrischen Klinik in Blida-Joinville, wo er von 1953 bis 1956 arbeitete. (Bild: Public Domain)
»Secouez-moi!« – den Inhalt von Flaschen wie diesen darf man nicht rühren, nur schütteln. Und sie keinesfalls von sich werfen. Dem Anschein nach lässt der Dschinn aus dem algerischen Frühzeit-Smoothie keine Wünsche offen: Er erfrischt ausgetrocknete Kehlen und trübe Gemüter – eine halbtropische Infusion, die nur für wenige Minuten wirkt, dafür aber an jedem Tag. Sie sorgt für exotisierendes Urlaubsfeeling, auf Werbeplakaten dargestellt durch tanzende Schatten unter Sonnenschirmen und Frauen mit Orangenbrüsten. Die Kolonie wird zur süßen Versuchung – eine servile Frucht, die sich öffnet, schäumt und stets verfügbar bleibt. Die »Société Naranjina Nord-Afrique« in Boufarik verkauft kein Getränk, sie vertreibt eine französische Fantasie – süß, kokett, verspielt.
Boufarik ist rund fünfundvierzig Kilometer südwestlich von Algier entfernt. Das landwirtschaftliche Anbaugebiet ist für seine süßen, saftigen Orangen bekannt. Als der französische Siedler Jean-Claude Beton im Herbst 1935 auf einer Landwirtschaftsmesse in Marseille auf den valencianischen Pharmazeuten Augustin Trigo Morralès traf, fanden beide in fruchtbarer Weise zueinander: Morralès wollte seine »Naranjina« nunmehr in Algerien herstellen, Beton half ihm beim Umzug mit seinen Verbindungen zur kolonialen Landwirtschaftsverwaltung. Die Orange war in der Mitidja zwar bekannt, doch erst mit der Gründung der Saftfabrik in Boufarik setzte man gezielt auf eine einzige Sorte: die Valencia Late.
Am 27. September 1836 erließ Marschall Bertrand Clauzel aus Toulouse ein Dekret, das jedem französischen Siedler drei Parzellen Land in Aussicht stellte. Damals begannen die ersten dieser Pieds Noirs mit dem Zitrusfruchtanbau auf geraubten Böden. Algerische Bäuer:innen wurden scharenweise vertrieben; vor den Siedlern, die mit Waffengewalt, juristischen Tricks und der Unterstützung durch militärische Schutztruppen vorrückten, flüchteten sie bis in die Ausläufer des Atlasgebirges. 1846 beschlagnahmte Generalgouverneur Clauzel zusätzlich dazu sogenannten »türkischen Besitz« – darunter die Ländereien ehemaliger osmanischer Beamter. Damit vermachte er den Siedlern weitere fünfundneunzigtausend Hektar Grund. Spanische und italienische Kolonisten folgten auf die französische Vorhut, auf den fruchtbaren Feldern der Mitidja kultivierten sie die ersten Monokulturen.
Mit Beginn des Jahres 1928 verdoppelte sich die für die Kolonisten reservierte Anbaufläche in der Mitidja. Nach den sogenannten Reformen hatten rund achtundvierzigtausend Araber:innen und Berber:innen ihr Land verloren. Nun galt es, sie zu unterwerfen – als Arbeitskräfte für die Bewirtschaftung der Plantagen. Das Wort »Fellah« leitet sich aus dem arabischen Wort für »Pflüger« ab und bezeichnete Kleinbauern, Pächter oder Bewirtschafter von Gemeindeland. Fortan galt es als Synonym für den unfreien, zu jeder Zeit verfügbaren, landwirtschaftlichen Lohnarbeiter, der für den Profit des Mutterlandes auf die Felder geschickt wurde.
Die koloniale Ordnung stellt keine bloße Episode im Übergang zur kapitalistischen Moderne dar, sie ist eine ihrer Voraussetz-ungen: Plantagen fungierten keineswegs als Vorläufer für die industriellen Produktionsstätten, Kolonialismus und Kapitalismus, Plantage und Fabrik gingen Hand in Hand – nicht nacheinander, sondern ineinander über: In den Obstgärten der Mitidja koexisitierten Enteignung und Verwertung von Beginn an. Bereits in »Freedom Dreams. The Black Radical Imagination« wies Robin D. G. Kelley auf die starken Verflechtungen von Sklaverei und Kapitalismus hin – nicht als zeitlich getrennte Stadien, sondern als sich gegenseitig konstituierende Systeme: die Kolonialplantage war die erste moderne Fabrik.
Bereits am ersten Tag in der psychiatrischen Klinik von Blida-Joinville stellt Frantz Fanon fest, dass dort nicht die Krankheiten der Köpfe und der Körper behandelt werden, sondern die Folgen eines kolonialen Machtverhältnisses. Vor Ort gibt es einen Trakt für französische und einen für muslimische Patienten – mit fundamental verschiedenen Diagnosekategorien und Behandlungsmethoden. Die Kolonialisierten, an Armen und Beinen gefesselt, hören Stimmen und sehen Phantome; jene, die auf diese Weise zu ihnen sprechen, sind keine Hirngespinste, sondern Menschen von nebenan: Ärzte, Pfleger und Kolonialbeamte, nur einen Trakt entfernt. Frantz Fanon ist davon überzeugt, dass es dieses Krankenhaus ist, das krank macht. »Heilung« wäre nur dann möglich, wenn die koloniale Realität selbst ins Zentrum der Behandlung rückt.
Für Fanon ist das Krankenhaus in Blida-Joinville Teil eines größeren Machtgefüges, das auf Entfremdung, Enteignung, Kontrolle und bedingungsloser Ausbeutung beruht. Der Wahn stellt sich nicht als individuelles Leiden dar, sondern als Symptom einer Beraubung. Nicht wenige von Fanons Patienten wurden eingeliefert, weil sie sich gegen Fremdherrschaft und Versklavung zur Wehr gesetzt hatten. Andere mussten mitansehen, wie Siedler ihre Familien abschlachteten – und wurden in Reaktion darauf selbst zu Mördern. In der Klinik ist er mit Suizidalen konfrontiert, die an den Jahrestagen ihrer Vergewaltigungen an Tische und Betten gebunden werden, um sie vom Versuch abzubringen, sich das Leben zu nehmen. Er begegnet bewaffneten Kämpfern und entlaufenen Landarbeitern, die in den Gefängnissen des algerischen Staates gefoltert wurden. Der Einfluss der fremden Macht ist noch nicht gebrochen – in phantasmatischen Situationen der Heimsuchung sitzen Herren und Knechte erneut an einem Tisch.
Der Zustand der permanenten Entfremdung ruft die fremden Geister – von Depression und Angst bis hin zu psychosomatischen Beschwerden mit unkontrollierbaren Affekten. Mit frühen Formen der Gesprächs-therapie kämpfte Fanon dagegen an – durch Tagebucharbeit, Gruppengespräche, die bewusste Berücksichtigung der Herkunfts-milieus und die Stärkung der politischen Handlungsfähigkeit seiner Patient:innen. Den rassistischen Lehren der Algier-Psychiatrie setzt er die Prinzipien seiner »institutionellen Psychotherapie« entgegen und macht aus einer geschlossenen Anstalt ein ambulantes Tageszentrum. Patienten und Pfleger gelten ihm als gleichwertig, mit beiden sitzt er zweimal pro Woche am selben Tisch. Fanon spricht mit ihnen wie mit seinen Schwestern und Brüdern, adressiert sie mit ihren richtigen Namen und hört gut zu. Die Anstaltskleidung weicht bald Selbstge-schneidertem, es gibt eine Fußballmannschaft und eine hauseigene Zeitung. Im Hof des Hospitals eröffnen die Patient:innen ein kleines Café – ein vertrauter Ort inmitten der Anstaltsmauern, der sich anfühlt wie ein Zuhause.
Ein lautloses Wort zum Lippenlesen, eine unauffällige Geste, die Vertrauen weckt – das waren die stummen Zeichen einer klandestinen Kompliz:innenschaft im Krankenhaus von Blida-Joinville. Einige der Frauen vor Ort waren nicht bloß Gehilfinnen, sondern Verbündete und Mitstreiterinnen. Alice Cherki, 1936 in Algier geboren, verteilte Flugblätter und sammelte Medikamente für die Maquisards in der »Wilaya IV«, dem Rückgrat der antifranzösischen Guerilla im militärischen Sektor um Algier. Während des Zweiten Weltkriegs erlebte sie Rassismus und Segregation, als Kind wurde sie der Schule verwiesen, weil sie als Jüdin galt. Mit 18 Jahren begann sie in Algier ein Medizin-studium, 1955 bot Frantz Fanon ihr eine Stelle als Ärztin in Blida an.
Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges existierte quer durch Algerien ein medizinisches Netzwerk. Pflegerinnen und Ärztinnen, die der Front de Libération Nationale (FLN) angehörten, schmuggelten Medikamente und organisierten Verbindungen zwischen Front und Hinterland. Eine dahingehend wichtige Figur war Farida Hamdiyous, 1940 in Souk Ahras nahe der tunesischen Grenze geboren. Nach ihrer Ausbildung im Habib-Thameur-Krankenhaus in Tunis versorgte sie zunächst Verwundete an der algerisch-tunesischen Grenze, später auch in entlegenen Dörfern und Berbergemeinden, wo es weder Medikamente noch Verbandsmaterial gab. Die Pflegerinnen Malika Gaïd und Zohra Drif verbanden medizinische Hilfe mit politischer Mobilisierung – sie waren nicht nur Krankenschwestern, sondern auch Kurierinnen, Informantinnen und Organisatorinnen.
Die Gynäkologin Janine Belkhodja, eine der ersten algerischen Frauen mit medizinischer Approbation, war ebenso Teil des Netzes um Frantz Fanon. In Frankreich promoviert, arbeitete sie seit 1954 als Schulärztin in Boufarik; von dort aus hielt sie engen Kontakt zum PCF-FLN, dem losen Bündnis zwischen der Kommunistischen Partei Frankreichs und der algerischen Befreiungsfront. Im Juni 1957 wurde sie verhaftet und aus Algerien ausgewiesen. 1958 ging sie nach Tunesien, wo sie als Chirurgin für die ALN (Armée de Libération Nationale), den militärischen Arm der FLN, tätig wurde.
Dschinns sind ambivalente Figuren – Wesen des Übergangs, der Unsichtbarkeit, der Wirkmacht im Verborgenen. Sie können heilen, helfen und beschützen, aber auch vernichten und zerstören. Die Ärztinnen und Pflegerinnen um Frantz Fanon wirkten auf ähnliche Weise: fast unsichtbar, oft unterschätzt, aber entscheidend. Ihr Beitrag zur algerischen Unabhängigkeit blieb lange aus den Archiven verbannt. Stattdessen geistern bis heute fremde Bilder durch die Erzählungen: In der »Orangina«-Werbung spukt weiterhin der Geist der Kolonialmacht, gefangen in bauchigen Flaschen mit gläserner Orangenhaut. In Gefäßen wie diesen darf man nicht rühren, sie nur schütteln. Im Sommer 1954 schien die Sonne nicht über der algerischen Mitidja, sie brannte schon. Kurz vor dem 3. Juli 1962, dem Tag der offiziellen Anerkennung der Unabhängigkeit Algeriens, zog sich die französische Fabrik von Boufarik nach Marseille zurück. Mit ihr verschwand die Zitrusfruchtpresse, die Plantagen liegen brach. Die Plätze am Tisch der Herrschenden sind frei.