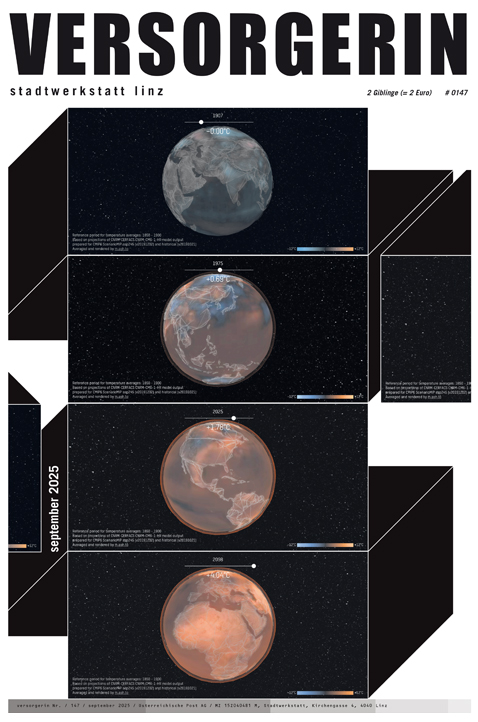Zweieinhalb Stunden mit dem Autobus entfernt von der griechischen Hauptstadt Athen befindet sich die kleine Stadt Delphi und davor – direkt am Berghang des Parnass – das einstige religiöse Zentrum der antiken griechischen Welt: das Orakel von Delphi. Hier sollen vor über 2500 Jahren Orakelsprüche von der kultischen Figur der Pythia in Trance empfangen und von Priestern ausgedeutet worden sein. Jene Weissagungen entschieden nicht selten über Krieg und Frieden und besiegelten das Schicksal jener Herren, die sie sich für die Geschicke der jeweiligen Polis zu eigen machten. Denn die Befragungen ergaben durchweg mehrdeutige Aussagen, selbst Paradoxien fehlten nicht, die mit Vorsicht genossen werden mussten. Ähnlich wie im Theater, gleich oberhalb des Apollontempels, wo das Orakel hauste. Dort wurden Tragödien aufgeführt, die ebenso mehrdeutig waren und der Auslegung bedurften, indem sie neben dem Verhältnis von Natur und Kultur jenes zwischen den Geschlechtern und das zu den Göttern verhandelten. Zumeist handelte es sich bei den Tragödien selbst wiederum um Auslegungen von noch älteren Mythen, die vor allem durch das Erzählen weitergegeben und durch die Theaterpraxis verdichtet wurden. Die meisten der Tragödien sind in der Zwischenzeit verloren gegangen. Von den aufgeführten Trilogien ist gar nur eine geblieben: die Orestie von Aischylos.

Aufnahme von Theodoros Terzopoulos‘ Inszenierung der Orestie (Bild: Johanna Weber)
Oberhalb des Orakels wird heute kein Stück mehr aufgeführt, man ist viel mehr damit beschäftigt, den Ort vor Steinschlägen zu schützen, die den Erhalt der Kultstätte bedrohen. Allerdings wurde am anderen Ende der Stadt ein Konferenzzentrum gebaut, das ein eigenes Amphitheater besitzt. Ende Juli diesen Jahres fand dort ein internationales Symposium zu »Mythos und Mneme: The Oresteia in the Contempororary World« statt, in deren Zentrum Aufführungen ebenjener Trilogie standen. Aischylos‘ Orestie beginnt mit dem Stück Agamemnon: Es handelt von der Rückkehr des Heerführers Agamemnon nach seinem Sieg über Troja und dessen Ermordung durch seine Ehefrau Klytaimestra und ihren Liebhaber Aigisthos. Aufgebracht hatte seine Frau, dass er die eigene Tochter, Iphigenie, geopfert hatte, um die Götter für den Feldzug auf seine Seite zu bringen, und aus diesem die Sklavin Kassandra als seine Konkubine mitbrachte. In den Choephoren, dem zweiten Teil der Trilogie, geht es um die Kinder von Agamemnon und Klytaimestra, nämlich Orest und Elektra, die sich am Grab ihres Vaters wiederfinden und, vom Gott Apollon angestiftet, einen Racheplan entwerfen und schlussendlich auch umsetzen. Orest, der das Schwert führt und den Muttermord begeht, wird dafür am Ende durch die Erinyen, eine Art von Rachegeistern, verfolgt und an den Rand des Wahnsinns gebracht. Im letzten Teil, den Eumeniden, wird die Entmachtung der Erinyen und deren Transformation in die Eumeniden verhandelt. Orest wird von Apollon vor jenen Gestalten geschützt, flüchtet sich dann zur Göttin Athene, die Gericht hält über die Anklage der Rachegeister. In diesem Prozess kann Orest in seiner Verteidigung Athene überzeugen, für ihn zu stimmen, weswegen es zur Stimmen-gleichheit und damit zum Freispruch für ihn kommt. Die Erinyen wiederum waren davon wenig begeistert, werden jedoch von Athene beschwichtigt und wandeln sich. Diese Transformation wird gemeinhin als das Ende der Blutrache und die Geburt des Rechts interpretiert, die dem Zirkel der Gewalt ein Ende gesetzt habe. Ebenso wird darin eine Art abgeschlossene Ur-Geschichte der Demokratie verhandelt.
So zumindest wird der Stoff gemeinhin interpretiert. Regisseur Terzopoulos zieht in seiner Adaption andere Schlüsse. Der Sieg der neuen Ordnung in Form des Freispruchs durch Stimmengleichheit und Entmachtung der Erinyen wird begleitet von einem der wenigen technisch vermittelten Momente: aus Lautsprechern ist der Satz »welcome to the new world« zu hören, daraufhin Kriegsgeräusche; und es werden zivile Opferzahlen von Krieg und Terror in Kontrast zu Börsenkursen verlesen. Dass sich »die Märkte« von Krisen und Krieg nicht unbedingt geschockt zeigen, sondern teils sogar belebt, wird wiederum kaum jemandem gänzlich neu gewesen sein. Am Ende dieser Orestie jedoch bleibt ein Mitglied des Chors auf der Bühne zurück und das Stück endet im wortlosen Jammer über das anhaltende Grauen der rationalisierten Welt. Die Rezeption dieser Endsequenz war vielsagend gespalten, denn mehrheitlich standen sich zwei Positionen gegenüber: das »konservative Lager« war erbost ob der Verunglimpfung der Geburtsstunde der griechischen Demokratie zu Zwecken eines geopolitischen Kommentars; das »progressive Lager« war begeistert von einem Schluss, der sich der aktuellen Weltlage annimmt und den eigenen Aversionen entgegenkommt. Interessanterweise teilen beide Lager den Glauben an die vorherige Ur-Geschichte, denn damit etwas vor die Hunde gehen kann, muss es intakt gewesen sein. Tragödien sind jedoch mehrdeutig und vielschichtig – auch diese Interpretation. Eine tiefere Schicht eröffnet sich unter anderem an einer weniger lauten Stelle: Während in der Abstimmung über Orest das Neue eingeläutet wird, bewegt sich ein Mitglied des Chores an den Rand der Bühne, setzt sich mit dem Rücken zum Publikum auf einen Absatz – er scheint verwundet, setzt jedoch immer wieder an, mit seinen Schultern nach hinten Bewegungen zu vollführen, die wirken, als kugelten sich die beide Schultergelenke immer wieder aus. Die Bewegungen wirken erschreckend, die Figur scheint nicht aus der restlichen Szenerie ableitbar. Dafür drängen sich Assoziationen zu einem geflügelten Wesen auf, das ansetzt, emporzusteigen oder, für die Anwesenden nicht wahrnehmbar, auf der Stelle schwebt. Während sich der Progress und Aufklärung bzw. Rationalisierung auf der Bühne abspielen, sitzt dieses Wesen am Rand, wie der Engel der Geschichte, von dem Walter Benjamin einst schrieb: »Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.« Diese Schicht des Stückes geht tiefer, ist durchaus anti-progressiv und anti-klassisch bzw. anti-konservativ, indem sie die neue Ordnung als Formwandel fortbestehender Herrschaftsverhältnisse kritisiert und damit die Irrationalität in der Rationalität selbst adressiert. Nach dem Stück habe ich den Dramatiker gefragt, was die neue Welt und ihre Zeit so neu macht und er antwortete: »the new time is not new, it is too old.« Beschrieben hätten sie auch andere schon wie Beckett. Oder wie es in einem Text von Terzopoulos heißt: »Die Heimat des Menschen ist der Alptraum«.
Terzopoulos ist 1945 in Nordgriechenland – während des Bürgerkriegs – geboren, in den 1970ern ist er nach Berlin gezogen, um bei Brecht am Berliner Ensemble zu lernen, war jedoch schnell eher von Heiner Müller angetan. Er hat in dutzenden Ländern der Welt inszeniert, seine Interpretation der Backchen von Euripides brachte im Weltruhm ein. 1994 gründete er die »Theatre Olympics« in Delphi mit anderen Dramaturgen wie Heiner Müller und Robert Wilson. 2015 wurde mit »The Return of Dionysus« ein Buch über seine Schauspielpraxis veröffentlicht, das inzwischen in 15 verschiedenen Sprachen erschienen ist. Zuletzt wurde der Band »Im Labyrinth: Theodros Terzopoulos begegnet Heiner Müller« ins Griechische übersetzt und bietet eine herausragende Grundlage, extrem verdichtet nachzulesen, was in seinen Stücken spürbar ist; nämlich die Nähe weniger zu den Lehrstücken Brechts als zur Formsprache von Müller und Samuel Beckett. In den letzten 40 Jahren hat er seine eigene Methode herausgearbeitet, die für Aufsehen gesorgt hat durch den ekstatischen Charakter der Aufführungen. Sie gründet in einer sehr eigenen Schauspieltechnik, für die der Atem im Fokus steht, und eine äußerst ungewöhnlichen Rhythmik, die vor allem durch Chöre getragen wird. Dafür trainieren die Schauspielerinnen und Schauspieler in exzessiven Formen, die rationale Hemmungen einer verstockten Bewegung aufbrechen und Blutzirkulation wie auch Atemzirkulation anregen sollen. Profaner ausgedrückt: Es soll ein größerer Resonanzraum ermöglicht und andere Formen von Rhythmus in Stimme und Bewegung etabliert werden. So konvergieren Impulse, die gegen die Jahrtausende wirkende Körperdressur bzw. Disziplinierung der Körper gerichtet sind mit der Rekonstruktion von Mythen als unabgeschlossene Urgeschichte des Menschen. Ein Versuch der Aufklärung über die Dunkelheit der Triebe und Traumata der Menschwerdung, die unverdaut und unterdrückt als andauernde Bedingung und Möglichkeit der Barbarei da sind. Ein Programm, das auch geschult wurde durch die »Dialektik der Aufklärung«, wie sie Horkheimer und Adorno formulierten: »Schon der Mythos ist Aufklärung, und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück.« Diese Praxis geht aus von einem kollektiven Unbewussten, das verdrängt wird und doch fortwirkt; das sich als System von Narben in die Körper einschreibt als auch in Form von »Alpdruck der Vergangenheit« (Marx) sich selbst in den Träumen sedimentiert, wo Individuelles und Gesellschaftliches verschlungen auftreten.
Die diesjährige Botschaft zum Welttheatertag wurde von Terzopoulos verfasst, dort heißt es: »Schauen wir in die Augen des Dionysos, des ekstatischen Gottes des Theaters und des Mythos: Dionysos, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint, Kind zweier Geburten, von Zeus und Semele, Ausdruck fließender Identitäten, weiblich und männlich, wütend und gütig, göttlich und tierisch, an der Schwelle zwischen Wahnsinn und Vernunft, Ordnung und Chaos, ein Seiltänzer an der Grenze zwischen Leben und Tod.« Und so geht es auch auf Terzopoulos‘ Bühne zu, wie in der Orestie, wo der Chor stark an Zwischenwesen erinnert, die in seltsamen Formationen über die Bühne stampfen und deren Stimme mal an das Zischen einer Schlange, mal an einen gestrandeten Fisch erinnert, dem der Atem stockt und dann wieder konvulsiv entspringt; mal vor Trauer Klagelieder hauchend, mal Drohungen zischend, Orest lebendig zu fressen. Und dagegen der verhärtete Agamemnon, der über Leichen läuft und Klytaimestra, die Frau mit »dem Herz eines Mannes« (Aischylos), die ihren Mann mit einer Doppelaxt erschlägt, wie man das sonst damals auf der Jagd mit Schweinen getan hat, die neben dem Stechschritt vor allem ein Lachen eint, das furchtbar vertraut wirkt. So nämlich, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt: »Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.«
Selten wird eine Inszenierung derart lebendig umringt von Vorträgen und Diskussionen. Anstatt des oft bemühten Publikumsgesprächs wurden an diesem Wochenende Thesen zu einer »Ästhetik des Metabolismus«, dem menschlichen »Leib als Archiv« und Theater als Ort einer »kollektiven Traumatologie« diskutiert. Getragen war das Ganze von einem Enthusiasmus, der quer steht zum Status Quo – nicht nur im Theater, aber auch dort. Ein recht ungebrochener Glaube an Kräfte der Veränderungen aus und durch den Mythos, um mit ihm über ihn hinauszukommen.