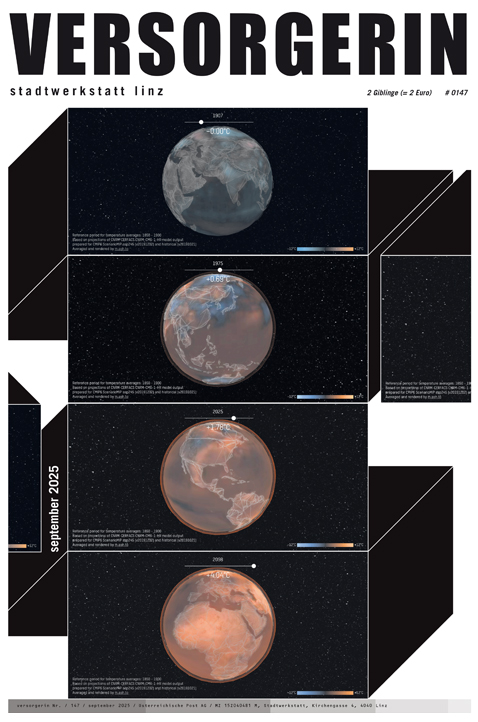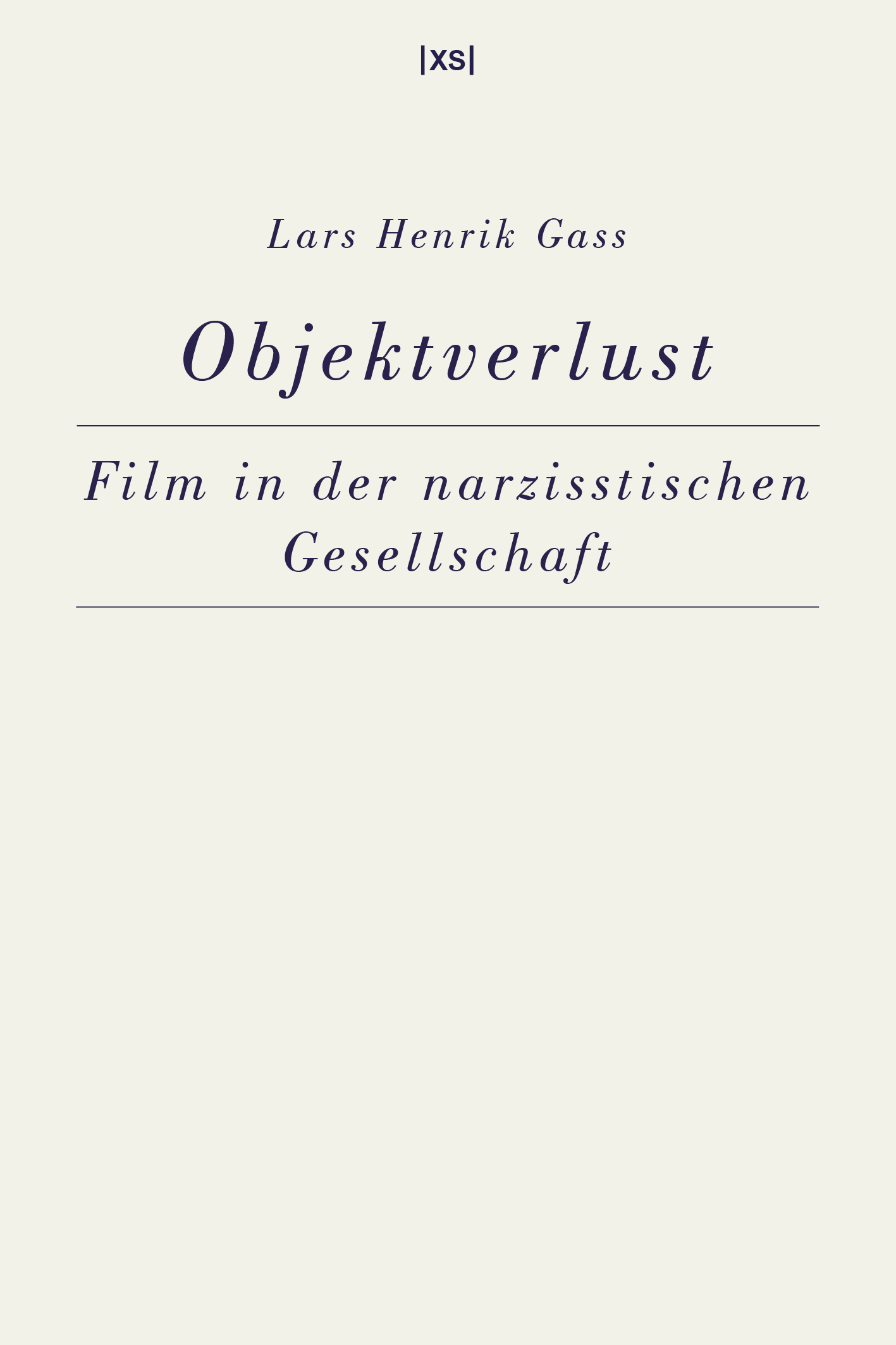Mit seinem Anfang des Jahres erschienenen Buch »Objektverlust. Film in der narzisstischen Gesellschaft« setzt Lars Henrik Gass seine Reihe filmkultureller Monografien fort. Sie gelten als einige der wenigen Filmbücher, für die sich das Feuilleton überhaupt noch interessiert. Was Gass’ Schriften auszeichnet, sind schlagkräftige Thesen und Argumente, in denen das Kino meist von seinem vermutlich bevorstehenden oder schon geschehenen Ende aus betrachtet wird. Was manche Filmhistoriker müde lächeln lässt, löste zumindest in der einen oder anderen Redaktion Handlungsbedarfsappelle aus. Nicht zuletzt deshalb, weil Gass bis 2024 die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, eines der wichtigsten deutschen Filmfestivals, leitete und in manchen Augen für seine politische Haltung als streitbare Person wahrgenommen wurde.
Sein neuester Essay, der beim Berliner XS-Verlag erschienen ist, nimmt sich programmatisch dabei nicht weniger vor, als eine Ideologiekritik des Gegenwartskinos im Sinne Siegfried Kracauers zu formulieren. Deutlicher als noch seine vorherigen Bücher wie »Filmgeschichte als Kinogeschichte« oder »Film und Kunst nach dem Kino« sind seine einleitenden Ausführungen von persönlichen Kinoerfahrungen und einer gewissen Melancholie gezeichnet. Zugleich fährt Gass aber gegen die derzeit angesagtesten Filmen argumentative Alleszermalmer von Theodor W. Adorno bis Wolfgang Pohrt auf: Dort, wo sich Kino als Quelle ästhetischer Erfahrung bei der Berührung mit dem Nichtidentischen ausweist – für Gass ist das der italienische Neorealismus –, bildet dahingehend den Ausgangspunkt und das Ziel seiner Kritik. Im Sinne eines aufklärerischen Universalismus und weniger einer partikularen Repräsentation ist für ihn deshalb das Kino die bürgerliche Institution schlechthin.
Diese Vorstellung gehört aber der Vergangenheit an, womit Gass zwar der Gesellschaft und dem Gegenwartskino mangelndes Interesse an sozialen Verhältnissen diagnostiziert, seine Thesen im Grunde allerdings auf eine soziologisch und psychoanalytisch informierte Medientheorie zielen lässt. Theoretisch gestützt von Alexandra Schauer und Melanie Klein seien technologische Bilder die Erzeuger von sozialen Rückkopplungseffekten, in denen eine misslingende Objektbeziehung und sogar das Ende des bürgerlichen Subjekts zum Ausdruck käme. Es heißt so prägnant wie rätselhaft, das Kino verschwinde im Film. Mithilfe von Richard Sennett und Christopher Lasch meint Gass dann, dass sich im Kino eine Wahrnehmungsökonomie durchsetze, die narzisstische Persönlichkeitsstörungen im gesellschaftlichen Verkehr kultiviere. Nicht mehr die Erfahrung mit »dem Anderen«, sondern nur noch die dauernde Selbstbespiegelung werde im Kino erkennbar. Als letzter Sargnagel hätte das Kino neben seinem aufgegebenen Wirklichkeitsbezug auch noch die Filmgeschichte im Dienst der Publikumsdistinktion fetischisiert.
Methodisch orientiert sich Gass offenbar zwischen den beiden Filmschriften Siegfried Kracauers, die im Abstand von dreizehn Jahren im amerikanischen Exil entstanden: der filmhistorischen Mentalitätsstudie »Von Caligari zu Hitler«, sowie der »Theorie des Films«, die eher eine Phänomenologie als Filmtheorie ist. Von einer Synthese kann dabei aber keine Rede sein, zumal beide Werke auch unter ganz anderem Einfluss standen. Gass’ filmkritischer Stunt, Gesellschaftskritik, Medientechnologie und Ästhetik in eins zu fassen, geht hier – treu materialistisch – zulasten der Ästhetik, die sich der Ideologiekritik am Individuum in der entzivilisierten Wirklichkeit zu fügen hat. Gegen die darin hochgezüchteten narzisstische Subjektivität helfe nun auch nicht mehr Athenes Schild, die Leinwand, wie Kracauer noch dachte, sieht man von den Filmen Kathryn Bigelows ab, die von Gass als einziges Gegenbeispiel etwas pflichtschuldig vorgetragen werden. Aber nicht die Beispiele, sondern eine fehlende Historizität, einst Kracauers Stärke, entpuppen sich hier als Gass‘ größte Schwäche, dessen Narzissmusdiagnosen aus den 1980er-Jahren einen fast kollektiven Limbus vermuten lassen.
Unter Gegenwartskino, von Massengeschmack kann keine Rede sein, versteht Gass weniger Blockbuster als eher Filme mit vorgeblich gehobenem ästhetischen und inhaltlichen Ansprüchen, die vor allem auf Leinwänden sogenannter Programmkinos laufen. Im Gegensatz zu Produktionsfirmen wie A24 oder Distributionsplattformen wie MUBI wählt er seine Beispiele vor allem anhand von Regisseuren und Regisseurinnen aus: Greta Gerwig, dahinter Ruben Östlund, Wes Anderson oder Giorgos Lanthimos, die allesamt mit ihren Filmen seit kurzer Zeit sowohl beim Publikum als auch dem Großteil der Kritik große Beachtung ernteten. Ihnen gegenüber übt sich Gass als Häretiker; und als guter Hermeneutiker lässt er Ästhetik, Narration, Rezeption und Filmhistorie ohnedies in eins fallen. Dass manche Brand-reden, wie für Bruce Willis oder gegen Quentin Tarantino und seine Fans an den Filmen komisch vorbeizielen, überrascht dabei nicht wirklich, sondern wirft die Frage auf, für oder gegen wen das Essay geschrieben wurde.
Es mag ansteckend sein, Gass so zu lesen, als würde sich dahinter keine Erfahrung sondern vor allem eine Gegenwartsdiagnose verbergen, mit der man von nun an selbst in aufgeklärter, Gassianischer Manier aus dem Kino gehen will. Bei seinen drei Kapiteln über technologische Bilder, Sozialcharaktere und filmhistorische Regressionen vergisst er allerdings ein mögliches viertes, das sich der Filmkritik widmen könnte, um den narzisstischen Zirkel zu schließen. Als André Bazin 1954 mit skeptischer Ironie die Équipe der Cahiers du Cinéma als Hitchcocko-Hawksianer taufte, galt die selbstgenügsame Bewunderung des amerikanischen Kino in Frankreich als blanke Provokation. Eine Provokation, die man in der gegenwärtigen Filmkritik vergeblich sucht, wo Formdebatten, wenn es nicht gerade um die Shoa geht, mit dem diagnostizierten Erfahrungsverlust aufgegeben wurden. Bevor ein Film beredt werden kann, scheint es das diskursive Diagnoseprimat zu brauchen, worin auch Gass’ Symptom-anamnese »Objektverlust« keine wirkliche Ausnahme bildet.