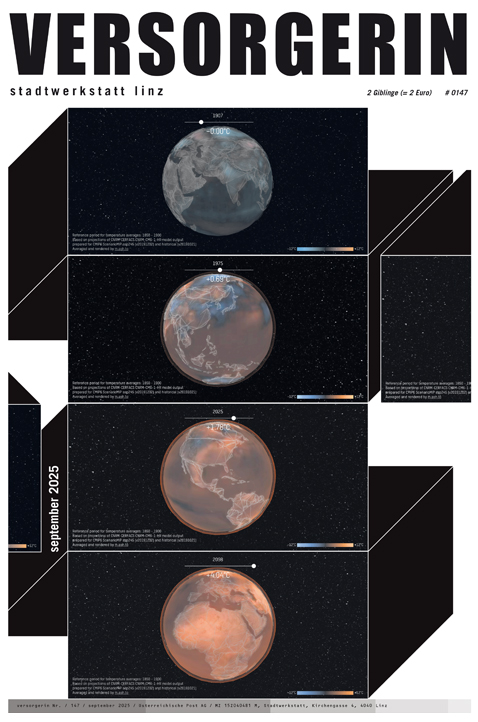Parallel Media, Barbara Doser || Hofstetter Kurt (BD || HK) präsentieren einen umfangreichen Werkkatalog und erklären darin ihre Motivationen, warum es zu dieser Arbeitsrichtung kam. Sie haben ihr Schaffen vor 45 Jahren zusammen in Innsbruck begonnen, und sind nach einigen Jahren nach Wien gewechselt. Sie arbeiten grundsätzlich getrennt, aber auch gemeinsam unter dem Namen »Parallel Media«. Ihr Zeichen sind zwei parallele Geraden, die sich in der Unendlichkeit treffen. Sie haben nun ihr Schaffen in einem 300-seitigen, großformatigen Buch aufgearbeitet, das im EIKON Verlag erschienen ist. Das Buch ermöglicht, die inhaltliche Nähe zu meiner eigenen Arbeit und zur Arbeit der Stadtwerkstatt der letzten Jahrzehnte herauszuarbeiten und dadurch auch, all diese Arbeiten besser verorten zu können. Inhaltliche Nähe sieht man sofort im prozessorientierten Arbeiten, bei näherer Betrachtung findet man dann mathematische Themen und den Bezug zum Irrationalen sowie eine gemeinsame kosmologische Perspektive.
Dazu gleich eine Textpassage aus dem Infolab der Stadtwerkstatt vom Frühjahr 2025 über den »Riss in der Symmetrie«. Ich will euch diese nicht vorenthalten und das soll die gemeinsamen Arbeitsthemen zwischen Parallel Media BD || HK und dem Infolab der STWST verdeutlichen.
Der Bruch in der Symmetrie - Wie das Irrationale die Zeit öffnet:
Wir neigen dazu, die Welt als ein strukturiertes Ganzes zu betrachten ... ein System, das aus Formen besteht, die sich gegenseitig spiegeln, wiederholen und ergänzen. Symmetrie findet sich überall: in Kristallen, in der Anatomie, in der Planetenbewegung, in der Mathematik. Symmetrie steht für Rationalität ... die Verkörperung der Ordnung. Und doch ist diese Wahrnehmung irreführend.
Denn wer genau hinschaut, wird feststellen, dass die »perfektesten« Figuren in unserem Denken ... der Kreis, das Quadrat, das regelmäßige Vieleck ... auf Zahlen beruhen, die sich der Rationalität entziehen. π für den Kreis. √2 für die Diagonale des Quadrats. φ, der Goldene Schnitt, für harmonisches Wachstum. Dies sind irrationale Zahlen: Sie können nicht als endliche oder sich wiederholende Dezimalzahlen ausgedrückt werden. Sie sind endlos und tragen immer einen Keim der Unvollständigkeit in sich.
Das macht sie zu mehr als bloßen mathematischen Abstraktionen. Irrationale Zahlen sind prozesshaft ... sie stellen keine festen Ergebnisse dar, sondern sich entfaltende Bahnen. Mit jeder zusätzlichen Ziffer produzieren sie neue Informationen. Dies verbindet sie grundlegend mit dem Konzept der Zeit.
Vielleicht begann die Zeit nicht mit einem Knall, sondern mit einer Symmetrie, die sich weigerte, sich zu schließen. Eine perfekte Form, die von einer Zahl durchbrochen wird, die sich nie auflöst. Ein Kreis, dessen Umfang sich der Einfachheit seines Radius entzieht. Ein Quadrat, dessen Diagonale das Gleichgewicht stört. Aus dieser winzigen Asymmetrie entsteht ein offenes System ... eines, das nicht ruhen kann, sondern sich weiterentwickeln muss.
Dies führt zu einem radikalen Wandel im Verständnis: Irrationale Zahlen sind nicht nur Werkzeuge der Berechnung ... sie sind Architekturen der Realität. Sie tragen das Potenzial zur Transformation in sich. Sie könnten der ursprüngliche Impuls dessen sein, was wir als Zeit wahrnehmen. Und vielleicht sind sie auch der Raum, in dem Information zum ersten Mal auftaucht.
Denn Information ist nicht das, was gespeichert wird ... sie ist das, was sich entfaltet, Schritt für Schritt, Ziffer für Ziffer. In einer irrationalen Zahl ist die Information kein Objekt, sondern ein Fluss. Sie ist nie vollständig, nie statisch. Und das unterscheidet sie grundlegend von der (noch) binären Logik unserer Maschinen. Diese operieren innerhalb endlicher Zustände ... ja oder nein, null oder eins. Aber das Irrationale liegt außerhalb dieses binären Systems. Es enthält eine imaginäre Komponente ... nicht unbedingt im streng mathematischen Sinne, sondern als Metapher für das Unsichtbare, das Unvorhersehbare, den Aspekt, den wir als Zukunft bezeichnen könnten.
Diese Sichtweise eröffnet ein neues Verständnis des Universums: Nicht als eine Maschine, sondern als ein offener Prozess ... einer, der mit einem Riss in der perfekten Form beginnt. Ein Riss, der nicht zerstört, sondern ermöglicht. Ein Bruch, der die Ordnung nicht beendet, sondern sie in die Zeit bringt.
Vielleicht sind irrationale Zahlen die wahren Uhren des Kosmos. Nicht weil sie ticken ... sondern weil sie niemals enden.
2025 wird seitens des Infolab das Quadrat und der Kreis in der Zeichnung von Leonardo da Vinci »Der vitruvianische Mensch« und das »Schwarze Quadrat« von Kasimir Malewitsch in einer endlosen Schleife in ihrem Browser berechnet. Diese Arbeiten finden sich auf den Netzseiten des Infolabs der STWST und ähnliche Arbeiten über das Irrationale findet man im Buch von Parallel Media und BD || HK.
Den wichtigsten gemeinsamen Zeitabschnitt sehe ich in der Medienkunst vor dem Internet, als die Weichen für diese großen Arbeitsthemen gelegt wurden.
Die Arbeiten von Parallel Media BD || HK fallen in eine Zeit, die heute für mich fast wie ein abgeschlossenes Kapitel wirkt: Es ist die Zeitspanne der analogen Medienkunst vor dem Durchbruch des Internets. Zwischen den späten 1970er Jahren und der Mitte der 1990er Jahre entstand mit der zweiten Generation der Medienkünstler:innen eine eigene künstlerische Praxis, die von den technischen Bedingungen dieser Zeit geprägt war – und die in ihrer Radikalität kaum wiederholbar ist.
Es war eine Phase, in der das Live-Signal noch ein zentrales Ereignis war. Zum Beispiel das analoge Videosignal, eine direkte Verkettung von Kamera, Monitor, Sender und Empfänger, ermöglichte eine Art Gegenwart, die nicht reproduziert, sondern erlebt wurde. Diese Gegenwart war nicht gefiltert durch Puffer, nicht zerlegt in Datenpakete oder verzögert durch digitale Verarbeitung. Sie existierte nur als Prozess – als kontinuierlicher Fluss von Energie und Information.
Wir alle, die in dieser Zeit gearbeitet haben, wussten, dass die Momente nicht reproduzierbar sind. Die Gegenwart ist einzigartig. Die Präsenz des Signals, seine Flüchtigkeit und Unwägbarkeit, ein Teil des künstlerischen Werts. Ob es um ein Videofeedback ging, ein Live-Event oder eine Übertragung über Distanzen – immer war es die Gleichzeitigkeit der Handlung und Wahrnehmung an verschiedenen Orten.
Diese Gleichzeitigkeit hatte ihre physikalischen Grenzen. Das Licht selbst – die Laufzeit des Signals definierte, wie nah oder fern zwei Ereignisse verbunden waren. Die Gegenwart war nicht nur eine soziale oder ästhetische Konstruktion, sondern der konkrete physikalische Raum. Dazu kam die Rauminstallation als skulpturaler Begriff in der dies passierte. Über einen Sender als Zeitbasis konnten sich mehrere Orte synchronisieren. Dieses Zeitbasis haben BD || HK in vielen ihrer Arbeiten thematisiert – ebenso wie die STWST rund um die 1990er Jahre in den Projekten von STWST TV. Es handelte sich um einen Versuch, Gegenwart herzustellen und den Sender mit dem Empfänger getauscht zu haben.
Es war auch die Zeit, in der ein Augenblick – das Delta zwischen Vergangenheit und Zukunft als kreatives Element begriffen wurde. Die Kunst sollte keinesfalls ein statisches Ergebnis, kein abgeschlossenes Produkt sein, sondern ein Prozess des Werdens, der in der Gegenwart entsteht und vergeht. Diese Haltung verband sich mit dem Glauben an die Möglichkeit, über Technik nicht nur Informationen zu transportieren, sondern auch Emotionen, Atmosphären und Zeitgefühl. Dazu kamen die ersten Zeitverschiebungen über Samplingversuche in Musik und Film (Max Headroom), die vor allem aus analogen Bausteinen hergestellt wurden und dadurch ohne jeden Zeitverlust eingesetzt werden konnten.
Mit dem Aufkommen des Internets, vor allem des World Wide Web in den 1990er Jahren, verschoben sich all diese Bedingungen grundlegend. Die digitale Logik – mit ihrer Speicherung, der Bufferung von Signalen, ihrer Reproduzierbarkeit, brachten eine Verzögerung des Signals – und ein anderes Verständnis von Medienkunst. Zudem erlaubte das ISO/OSI Schichtenmodell den Künstlerinnen nur mehr einen Zugriff auf die obersten Layer. Das gesamte Spektrum des Arbeitsmaterials Technologie war damit nicht mehr zugänglich. Vieles, was vorher selbstverständlich war, wurde unmöglich: das Gefühl der unmittelbaren Präsenz, die Authentizität des Signals und des Materials, die »Singularität« des Ereignisses waren damit verloren.
Wenn ich heute in das Buch von BD || HK blicke, erkenne ich darin diese frühe Phase der Medienkunst und somit ein beeindruckendes Werk. Ein Dokument einer Zeit, in der die Medienkunst noch zutiefst prozessorientiert war. Eine Zeit, in der man tatsächlich glaubte, die Technologie wird ein Mittel, um die Gegenwart zu erweitern – und nicht, um die Gegenwart simulieren zu können.
Dieser Glaube war kein naiver Fortschrittsoptimismus, sondern gründete auf konkreten Erfahrungen: Wie etwa auch die Künstlergruppe Van Gogh TV realisierte die STWST über STWST TV in den späten 80er und frühen 90er Jahren Live-Sendungen auf dem Satellitenfernsehsender 3sat, bei denen das Echtzeitsignal nicht nur technisches Mittel, sondern künstlerisches Material war. In diesen Übertragungen wurde der klassische Unterschied zwischen Rezipient:in und Akteur:in aufgehoben – das Publikum konnte aktiv eingreifen und selbst zur Akteur:in werden. In diesem Sinn entstand in Linz schließlich auch der Freie Radiosender FRO, der nicht nur Contentradio sein wollte, sondern – zumindest für einige Protagonist:innen – für die Idee eines offenen, unreglementierten elektromagnetischen Raums stand. Parallel dazu wurde mit servus.at ein unabhängiger Internetprovider aufgebaut, der Künstlerinnen und Kunstinitiativen ab 1995 erstmals den Zugang zum Internet über das universitäre ACOnet ermöglichte.
Bis heute existiert dieser globale elektromagnetische Raum – ein Raum der Radiowellen, in dem Signale ohne Puffer, ohne Verzögerung, ohne digitale Filter zirkulieren können. Er ist eine Art zeitloses Kontinuum, das sich der Abschaffung der Gegenwart widersetzt, wie wir es aus der digitalen Welt kennen. Für das Infolab ist dieser Raum geblieben und ebenso die Mathematik selbst, die eine künstlerische Ebene jenseits einer Technologie ermöglicht.
Warum erzähl ich das Ganze….. weil es unmittelbar auch die Arbeiten von Barbara Doser und Hofstetter Kurt betrifft.
Betrachten wir den gemeinsamen Nenner aller Beteiligten genauer. Er findet sich im Prozesshaften, im Gegenwartsereignis bei Barbara Doser sowie im Irrationalen und in der kosmologischen Perspektive von Hofstetter Kurt. Aufgrund meiner Erfahrungen während des »Artist in Residence« Programms der STWST auf dem Messschiff Eleonore verbürge ich mich bei Beiden für ihre Authentizität.
Barbara Doser – Die Gegenwart als künstlerischer Prozess
Bei Barbara Doser sehe ich einen entscheidenden Moment um 1993, als sie begann, mit dem Videoloopback zu experimentieren und damit die Gegenwart zum zentralen Element ihrer Arbeit machte. Es sind nicht nur die Bildframes, die sich in einer Schleife aus Kamera und Monitor unablässig selbst referenzieren – es ist auch das Licht, das über das Nachleuchten der Mattscheibe scheinbar gefangen bleibt und durch Verstärkung sekundenlang in einer eigenen Zeitspur gehalten werden kann. Der Prozess selbst wird damit Teil des Kunstwerks.
---
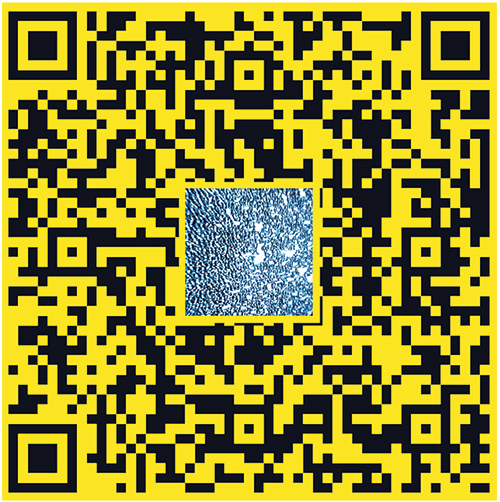
Barbara Doser: Videofeedbackmaterial ist nicht Kunst. FX Infolab: Aber Kunst kommt von Neuem. In diesem Beispiel entsteht das Signal des aufmodulierten Videofeedbacks durch eine Interferenz mit einer hochfrequenten Sendefrequenz. All dies bringt uns näher in das Zentrum des Ereigniskegels. Vergleiche S. 24-30 mit 1987: Der Falsche Fehler – Hochschule für angewandte Kunst. Kinetische Skulpturen im MHZ Bereich - 1993 Skug Magazin.
---
Barbara Doser erzeugt einen selbstreferenziellen Kreislauf, bei dem – wie sie selbst betont – die Technik allein noch keine Kunst ist. Erst ihre emotionale Bindung an diese fragile, flüchtige Gegenwart verleiht der Arbeit ihren künstlerischen Wert. Entscheidend ist auch die Umsetzung dieser prozesshaften Ereignisse in konkrete Rauminstallationen, in denen der Betrachter nicht nur visuell, sondern auch zeitlich involviert wird.
Wie sie ebenfalls anmerkt, hat ein solches Setting in einem klassischen Videofestival wenig Platz. Es braucht einen anderen Zugang, ein eigenes Umfeld, das mehr ist als die Oberfläche eines Screens – einen Raum, in dem der Prozess als Gegenwart erfahrbar wird. Dieses Spannungsfeld zwischen Bildproduktion und prozessualer Medienkunst erkannte schon in den frühen 1990er Jahren das junge Filmfestival Diagonale, das Videokunst und Medienkunst bewusst in zwei unterschiedliche Sektionen teilte. Während sich Videokunst und Film stärker als Bildproduktion verstanden, thematisierte Medienkunst – wie bei Barbara Doser – den Prozess selbst. Sie machte dies möglich, indem sie ihr Setting in kleinste Abläufe zerlegte und so verschiedene Zugänge zu einer Arbeit eröffnete, die sich der Eindeutigkeit entzieht.
Barbara Doser macht die Gegenwart als Dynamik erfahrbar – als Delta, als Übergang von einem Augenblick zum nächsten. Ich bezeichne diesen Ansatz oft als Prozesskunst, auch wenn er von der klassischen Definition abweicht. Vielleicht könnte man ihn am treffendsten als neue Prozess-kunst beschreiben: eine Kunst, die nicht nur den Entstehungsprozess einer Skulptur einbezieht, sondern in der die Skulptur selbst zum zeitlichen Prozess wird. Eine Art Zeitskulptur, in der Wahrnehmung, Technik und Emotion untrennbar miteinander verbunden sind.
Diese Liebe zum Moment und zum Festhalten des Augenblicks zeigt sich auch in ihren fotografischen Arbeiten, wie ich 2012 während des oben erwähnten Residenzprogramms auf dem Messschiff Eleonore im Linzer Winterhafen erleben durfte.
Im Buch verortet sie die Arbeit von Parallel Media BD || HK präzise und überzeugend. Sie bringt aufschlussreiche Texte und starke fotografische Dokumentationen in das Buch ein, die den Blick auf diese Form der Medienkunst nachhaltig erweitern.
Hofstetter Kurt – Der kosmologische Blick
Auch Hofstetter Kurt hat Bezug zum Gegenwartsereignis, aber er verarbeitete es anders. Während Barbara Doser in das Bild hineinging, zoomte er sich hinaus. Er entdeckte dort das Nichts und die Unendlichkeit – Grenzbereiche, die kaum mit technischen Mitteln abstrahierbar sind. Letztlich war es die Mathematik, die ihm ein Arbeiten in diesen extremen Feldern ermöglichte.
---

Hofstetter Kurt: Vergleiche imaginäre Zahlen von FX Infolab, 1986 Berechnungen zu Phi »Galerie V&V«. 1987/2025 ars electronica/KI Riemengetriebe über PI und endlose Annäherung an Null, 2005 Medienkunstlabor Graz, Entropia Symposion Lindabrunn/Linz, STWST48, 2017, mit Parallel Media, Hofstetter Kurt || Barbara Doser »Induktive Rotation« und S. 247, S. 74-76, S. 34-36 »Der Phi Orden«, die Konstruktion von Phi mit einem Zirkel in 5 Schritten. S. 94-99.
---
Die Mathematik als eigene Wissenschaft gehört weder zu den Natur- noch zu den Geisteswissenschaften. Sie kann aufgrund ihrer scheinbaren Logik nur mit einem sehr hohen Abstraktionsvermögen in der Kunst eingesetzt werden. Ob sie schon immer da war und vom Menschen entdeckt wurde oder ob sie konstruiert wurde, um die Welt zu verstehen, ist unklar. Ich selbst tendiere zu einer Mathematik, die immer existiert hat – als Grundlage, auf der Naturgesetze überhaupt erst entstehen konnten. Sie ist eine Art Konstruktionsprinzip der gesamten Welt, inklusive Zeit und Raum. Vielleicht ist sie sogar die Grundlage unserer Realität oder eines holografischen Prinzips. Dieser ganze Kosmos aus Zeit, Raum und Zahl ist das Universum von Hofstetter Kurt.
»minus delta t« bezeichnete in den frühen 80er Jahren eine Künstler-gruppe mit personellen Überschneidungen zur Stadtwerkstatt. Für mich war dieser geniale Name prägend. Da ich damals intensiv mit dem Faktor Zeit gearbeitet habe, war es genau dieser Begriff, der mich erstmals auf die Mathematik als eine Kunstform aufmerksam machte. Neben der Mathematik ermöglichte außerdem Hofstetter Kurts kosmologischer Blick auch einen Perspektivwechsel: den Blick von außen auf unsere Erde.
Das erste Mal begegnete ich seiner Medienkunst in den Installationen »Planet der Pendler« und »Einen Augenblick Zeit« am Bahnhof Wien Mitte und am Südbahnhof Wien. Ich erkannte sofort, dass wir dieselben Themen teilten. Er arbeitete immer autodidaktisch, aber wir lernten uns trotzdem Anfang der 90er Jahre aufgrund der inhaltlichen Nähe rasch kennen. Die Installation »Sunpendulum« hat meiner Vorstellungskraft dann fast den Boden entzogen. Als eher praktisch orientierter Mensch verlor ich kurz den Glauben an den Realitätsinn von Hofstetter Kurt. Obwohl ich selbst mit Wettersatelliten arbeitete und mich mit dem globalen Blick auf die Erde beschäftigte, war das eine Nummer zu groß und zu mächtig für mich. Genauso wie das »KUNST RAUM SCHIFF Stubnitz«, ein anderes Projekt in dieser Zeit. Aber es beeindruckte mich tief, mit welcher Konsequenz er dieses Vorhaben über Jahre verfolgte.
Als dann noch die Arbeiten rund um den Goldenen Schnitt auftauchten, dachte ich sofort: Das kann kein Zufall sein. Denn ich programmierte damals immer noch in Basic endlose Konvergenzen gegen Null – rekursive Funktionen, die in den Bereich des Goldenen Schnitts führten. Für mich war das eine Art Bestätigung meiner eigenen Arbeit, ein unerwartetes Echo, das mir zeigte, dass ich nicht allein mit diesen Gedanken war. Diese endlosen mathematischen Konvergenzen, die irrationalen wie die komplexen Zahlen, sind bis heute ein aktuelles Thema des Infolabs 2025 (siehe infolab.stwst.at).
Zur akustischen Umsetzung von Parallel Media sowie Hofstetter Kurt, die im Buch auch thematisiert sind, kann ich nur wenig sagen. Hier fehlt mir ein Stück weit die Praxis. Ich kenne die Logik der Akustik, die Prozesshaftigkeit und Überlagerungen, wie sie auch in der Elektroakustik verhandelt werden, aber das Zusammenwirken von Klang und bildender Kunst war nie mein unmittelbarer Arbeitsbereich. Hofstetter Kurts induktive Rotation ist da ganz anders. Hier erkenne ich sofort die mathematische Innovation. Sie lässt sich, wie er selbst sagt, auf verschiedene Medien übertragen – Stoffgewebe, Bildgebung oder andere Formate. Ich freue mich sehr, dass seine Sonifikation als eigenständige Komposition so große Anerkennung gefunden hat. Ich selbst kann den Wasserstoff des Weltalls oder Quantenrauschen in Echtzeit in Töne transformieren, aber ich traue mir nicht zu, seine akustischen Umsetzungen eines Werks kompetent zu hinterfragen oder zu beschreiben.
Der politische Faktor
Was ich abschließend noch anmerken möchte, betrifft den politischen Faktor unserer gemeinsamen Arbeiten. Mit dem epochalen Wechsel Mitte der 1990er Jahre wurden wir alle Zeitzeugen einer kulturellen Revolution der Medien. Aus Push-Medien wurden Pull-Medien. Wir haben erlebt, wie Softwarepatente und proprietäre Systeme zunehmend die künstlerischen Freiräume beeinflussten – und zugleich, wie wichtig es war, Alternativen zu suchen. Wir haben gemeinsam nach neuen Wegen geforscht, ohne dass das Ergebnis – das Werk – jemals die Bedingung stellte, ausschließlich mit quelloffenen Werkzeugen zu arbeiten.
Meine Arbeit und die Arbeit der Stadtwerkstatt hatten immer dieses Ideal offener Systeme. Doch oft endete das in einem Selbstzweck, oder der Zeitaufwand für solche freien Werkzeuge stieg ins Unermessliche. Parallel Media BD || HK zeigen in ihrem Buch sehr überzeugend, dass unsere gemeinsamen Themen auch mit proprietären Systemen bearbeitbar sind – vorausgesetzt, man betrachtet diese Werkzeuge bewusst als Black Box. Für mich bleiben quelloffene Ansätze trotzdem eine Notwendigkeit. Sie erlauben es, bestehende Systeme in neue Arbeitsmittel zu zerlegen und wieder neu zusammenzusetzen. Genau darin sehe ich eine große Chance: Die generative Kunst und diese neue Prozesskunst werden dadurch selbst Teil des Werks – nicht nur als Technik, sondern als Haltung.
---
---
Parallel Media – Barbara Doser || Hofstetter Kurt – tense_intense
An art monograph by and about Parallel Media with a focus on audiovisual synaesthetic art. Mit Texten von Barbara Doser, Azby Brown, Hofstetter Kurt, Wolf Guenter Thiel
EIKON Verlag, 2025, ISBN 978-3-904083-22-5
hofstetterkurt.net/barbaradoser-parallelmedia/-art_publication-.html