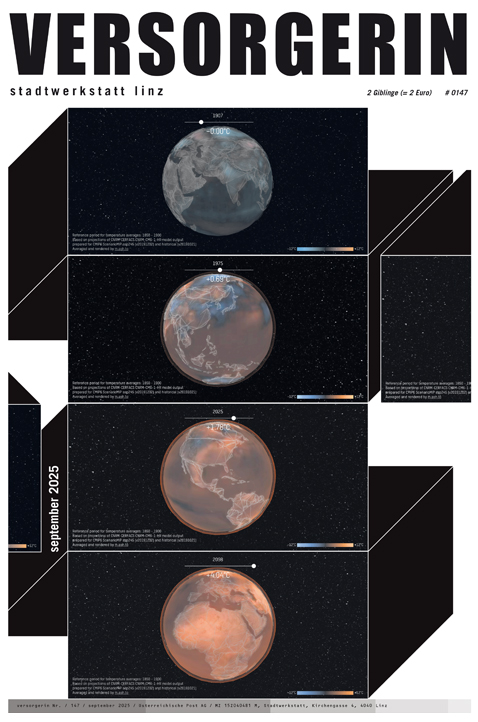Der Gesandte desselben Donald J. Trump, dem die USA nichts sind als ein Instrument seiner Persönlichkeit, hat Europa in der Münchner Rede – einen allerdings linksliberalen – Autoritarismus vorgeworfen. So flagrant der Selbstwiderspruch, und so durchsichtig die Parteinahme für das ökonomische Interesse US-amerikanischer Plattformbetreiber, zieht diese Propaganda ihre Wirkung gleichwohl aus realen Sachverhalten. Was in Trumps Amerika ängstigt, beklemmt, einschüchtert, ist weniger eine Verletzung der Meinungsfreiheit als ihr Amoklauf, den der im Niedergang befindliche Liberalismus auf beiden Seiten des Atlantiks, paradox und angreifbar, mit Maßnahmen gegen Falschnachrichten und Hassrede zu bekämpfen versucht. Einmal sollte dieselbe Tyrannei, die Theodor W. Adorno zufolge »mittelbar in der Konsequenz von Meinung selbst liegt« (Eingriffe, Meinung Wahn Gesellschaft, S. 167), durch deren Entfesselung aus der Welt gewiesen werden; dieser Widerspruch erscheint nun als geopolitischer zwischen den USA und ihren alten Verbündeten. Solidarität mit Abweichendem fordert daher keine Apologie der Meinungsfreiheit; eher wäre der Bewegung nachzugehen, durch die sich Freiheit als die Unfreiheit zu verwirklichen droht, die sie immer war. Karl Poppers Toleranz-Paradoxon hat den Widerspruch an der gesellschaftlichen Oberfläche benannt, der Materialismus aber muss ihn begreifen, um in der Kritik am losgelassenen Subjektivismus als schlechter Objektivität, am Gleichschritt von Repression und Enthemmung, festzuhalten, was Freiheit wäre.
Klarer als den englischen Begriffen ist dem deutschen der Meinungsfreiheit anzusehen, was es damit auf sich hat, ihr Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen. Wie über ihren Besitz verfügen die Individuen über gedankliche Inhalte; garantiert wird, ihretwegen keiner unmittelbaren, die freie Zirkulation von Waren und Meinungen durchstoßenden Verfolgung ausgesetzt zu werden. Nicht aber die materielle Selbsterhaltung. Ihr durch jene Verfügungsgewalt hindurch nachzugehen, bleibt dem Individuum selbst überlassen. Was dessen Emanzipation vom Staat begründet, ist eine staatliche Autorisierung und Form; in der freien Marktwirtschaft wird jedes Individuum zum Subjekt-Objekt seiner eigenen Planwirtschaft. Als Agens partikularer Selbsterhaltung ist Meinung a priori beschränkt und entfaltet sich zur permanenten Selbstkorrektur nach Maß der Mächte, von denen die eigene Stellung abhängt, zur lückenlosen Anpassung. Meinungsfreiheit war die, auf der Arbeit dem Chef recht zu geben und in der Freizeit auf die Ausländer zu schimpfen. Was später als Cancel Culture erregte Problematisierung erfuhr, war so normal, dass es nicht weiter auffiel: fürs unpassende Individuum wurde ein passender Ersatz gefunden, jenes von seiner Selbsterhaltung abgeschnitten. Die Arbeit zu geben hatten, die sie doch in Wahrheit nehmen wollten, richteten es so ein, dass die Gesellschaft formaler Freiheit »nur das Leben ihrer Getreuen einigermaßen [reproduzierte]« (Dialektik der Aufklärung, S. 158). Später, in der Zeit der Firmenhymnen, hat Arbeitszeit Freizeit eingezogen und damit die Selbstverständlichkeit von Cancel Culture zur unmittelbaren Totalität ausgebaut; erst während des kurzen Zwischenspiels des progressiven Neoliberalismus kam ihr Begriff kritisch zu Bewusstsein. Aber kopfstehend. Konservative registrierten damals den Widerspruch zwischen ihrer Triebstruktur als dem Produkt ungezählter Anpassungsleistungen und denen, die sie nun erbringen sollten, als unerträgliche Zumutung. Aber ihr Einverständnis mit Anpassung selber musste deren jüngste Form, die doch nichts war als der frei entfaltete Verkehr von Waren und Meinungen, als radikalen Einschnitt missverstehen. Denen die Reflexion auf ihre Ersetzbarkeit eine narzisstische Kränkung bereitet hätte, erschien die Meinungs-freiheit der anderen, die den Ersatz forderten, als neuer Totalitarismus: daher die Obsession jenes Gesandten, auch Elon Musks, mit der Rettung der Western civilization. Wie aber die verhasste Cancel Culture nichts anderes war als losgelassene bürgerliche Freiheit, kommt deren pathische Wiederherstellung als brutalisierte, politische nach rechts gewendete Cancel Culture zu sich selbst. Das ist das Geheimnis hinter Trumps Autoritarismus. Wer die Begeisterung für den great leader nicht sich zur Persönlichkeit macht, wird von den notwendigen Mitteln der Selbsterhaltung abgeschnitten: John Bolten, den das iranische Regime ermorden möchte, sein Personenschutz, AP, die vom Gulf of Mexico schreibt, sein journalistischen Zugang zum White House, unzähligen professionals, die einen Einwand vorzubringen wagten, der Job fortgenommen. Im Zeichen von Freiheit droht sich Trumps kulturindustrieller Anfang – You are fired! – als faschistisches Programm
zu vollenden.
Das stilistische Charakteristikum Amok laufender Meinungsfreiheit ist leerlaufende Polemik, der gegenüber die liberale Defensive abstrakte Sachlichkeit zu erzwingen versucht. Die aufeinander verwiesenen Pole sind auseinandergebrochen und haben sich in die Geschlechter-charaktere zurückgezogen: denn Sachlichkeit war das Mittel der Frauenemanzipation, durch sie vermochten sich Frauen als Subjekte abzuheben, zu den Machtzentren vorzudringen, an deren Tore der Kettensägenmann nun hämmert. Wer im Inneren zurückgesetzt ward, hat an ihm seinen Rächer, und wer von außen pöbelte, weil der Betrieb unter liberaler Verwaltung nicht so smart, vielfach nur nicht so brutal war wie er selber, den Exekutor seines Willens. Die polemische Dauerbelagerung legte Sachlichkeit die Gewalt nahe, für die sie sich, wenigstens dem Selbstbild nach, zu fein war. Nun richtet sie Musks Zerstörungswerk nach ihrem Maß; sie ist für die Herrschaft da, daher abgehoben, wo sie andere Loyalitäten kennt als die zum great leader. Wie zuvor der Wahrheit wird den staatlichen Institutionen das Rückgrat gebrochen, ihr Fetischismus als Aberglauben liquidiert, um sie der Führungspersönlichkeit dienstbar zu machen. Vermag die mit Sachlichkeit gesättigte Polemik den Sachen beizustehen, denen vom Betrieb versachlichter Herrschaft Gewalt angetan wird, so überflutet diese in der leerlaufenden die Sachlichkeit. Das allerdings hat seinen sachlichen Grund. Nur solche Individuen drücken ihre Meinung polemisch aus, die sich der Gesellschaft radikal entgegensetzen. Allein, »[was] sich in sich selbst als in das unmittelbar Gewisse und Substantielle verbeißt, wird eben dadurch Agent des Allgemeinen, Individualität zur trügerischen Vorstellung« (Negative Dialektik, S. 319). Smarten Männern, die sich Ideologiekritiker nennen und damit schon den inhaltlichen Anspruch preisgeben, den sie erheben, ergeht es darin nicht anders als den vom Markt als Ausnahmegenies ausgezeichneten Polemikern Musk und Trump. Seit Justus Wertmüllers Identifikationsangebot von 2009, dessen entscheidender Absatz Karl Kraus vereinnahmt, kommt solchen Ideologiekritikern metaphysische Wahrheit gleichsam als Person zu; danach zeitigte die gesellschaftlich-sprachliche Form eine kontinuierliche inhaltliche Annäherung, wie überhaupt unreflektierte Abgehobenheit mit der Bodenständigkeit des gesunden Menschenverstands zusammenstimmt. Der Wahrheit dient Polemik einzig als verzweifelte; die zum selbstvergewissernden Ritual erstarrte verkehrt sich in das Einverständnis, das sie hätte sprengen sollen. Solche Verzweiflung tastet nach dem Objekt, über das der Schein von Sachlichkeit betrügt, so als wäre im Liberalismus der Anspruch der als Arbeitskraftbehälter fungierenden Menschen auf Glück abgegolten. Leerlaufende Polemik beutet das nur um der offenen »Usurpation des Subjekts« (Ästhetische Theorie: S. 99) willen; sie ist Kehrseite einer Sachlichkeit, die dem Körper feind ist und nur den erhält, der sich sprechend in sie einschreibt; dadurch gerät dessen individuierter Geist in permanenten Widerspruch zur allgemeinen Denkform, an der er allerdings, wenn seine Polemik nicht noch gegen die eigene Verhärtung sich verhärtet, nur die Berücksichtigung des Objekts zum Zweck seiner Beherrschung tilgt, nicht diese selbst. Auf der Schattenseite des Klassengegensatzes bedeutet das, aus materieller Bedürftigkeit gegen das materielle Bedürfnis zu denken; wen aber Meinung nach oben führte, der erfährt das ideologische a priori der bürgerlichen Gesellschaft, die Autonomie des Individuums als trugvolle Substanz des eigenen Lebens. Er glaubt wirklich, sich selbst erhalten zu können. Der Unbedingte bedingt die anderen; leerlaufender Subjektivismus, vom hämmernden Posting, dem die Algorithmen hold sind, über das Investment, das Arbeitsplätze schafft, bis zum erlesenen Erbgut in der Spermienzelle, ist der Ausstoß, der sie formen, eigentlich ihre Existenz erst begründen soll. Steve Bannons flooding the zone ist nicht nur smarte faschistische Strategie, es drückt das Wesen des an sich irre gewordenen Geistes aus.
Der Liberalismus war selber ein Meer aus bullshit. Nun versucht er, Dämme zu errichten. Die alte Selbstverständlichkeit, die ihn hätte schützen sollen, Cancel Culture gegen mangelnde Sachlichkeit, reicht nicht mehr hin. Sie zerschellte an zu viel Sachlichkeit, der verblendeten Naivität, mit der besonders Mark Zuckerberg die öffentlichen Plätze des 21. Jahrhunderts konstruierte, deren User er nicht als reflektierende Subjekte sondern als manipulierte Reflexbündel setzte. Gatekeeping wurde gewissermaßen ins Subjekt hineinverlegt; gehört wird einzig, worauf die User anspringen; damit aber ist alle Beschädigung, die Sachlichkeit den Menschen heute antut, zur institutionellen Triebfeder ihrer Zerstörung geworden. Der, der Waren gleich welcher Art smart wie nie bewerben wollte, hat Quälgeister gerufen, die sich fürs Objekt weniger noch interessieren als er selber. Wie sein eigener Geist der quälender Naturbeherrschung ist, wird er sie nicht los; dass ihre beschädigt leerlaufende Subjektivität honoriert wird, ist sein ökonomisches Interesse nicht weniger als das politische Trumps. Versucht aber die liberale Defensive, Sachlichkeit auf den Plattformen und gegen sie durchzusetzen, so verletzt das in der Tat die Meinungsfreiheit. Durchaus nicht die der User. Ohne die Plattform wären sie keine, sind weiter nichts als die bewusstlosen Agenten des in ihr vergegenständlichten Kapitals, verhelfen der obersten Charaktermaske zur Selbstverewigung im durch ihr stures Treiben sich verwertenden Wert; Musks Umbau von Twitter hat drastisch genug dargetan, dass der Mann an der Spitze die Rolle der User bestimmt, nicht umgekehrt. Dessen Meinungsfreiheit ist es dann auch, die gefährdet erscheint. Dass die Plattform unter seinem Kommando Sachlichkeit autorisieren soll, statt leerlaufende Subjektivität, beleidigt seine eigene. Als staatlicher Zwang, der gleichsam von außen auf einen Produktionsmittelbesitzer ausgeübt wird, verliert Cancel Culture gegen das zeitlos Unsachgemäße die Selbstverständlichkeit, mit der sie einmal wirksam war. Sie wird zum Problem, politisch zur offenen Flanke, zumal an den Maßnahmen für mehr Sachlichkeit deren inhaltlicher Charakter offenbar wird. Behält dann die sachliche Berichtigung einmal unrecht, weil Paranoia längst ins Objekt eingewandert ist, so kennt diese kein Halten, ehe sie Sachlichkeit als universelles Bezugssystem exekutiert und ersetzt hat.
Der Formalismus von Meinungsfreiheit war allerdings immer eine gegen ihre inhaltliche Vermittlung verblendete Unmittelbarkeit. Stets hatte sie deshalb an der Reputation des Konkurrenten ihre inhaltliche Schranke. Rufschädigung, üble Nachrede und unlauter vergleichende Werbung sind in der freien Marktwirtschaft so verboten wie in der Diktatur das kritische Wort gegen die Einheitspartei. Innerhalb der Einzelkapitale herrscht Cancel Culture, zwischen ihnen staatlich erzwungene Sachlichkeit. Deren Rolle ist ambivalent. Zweifellos setzt sie dem leerlaufenden Subjektivismus die notwendige Grenze; im Rufschädigungsprozess Dominion Voting Systems v. Fox News Network ist Trumps Bewegung für ihre Propaganda zur Präsidentschaftswahl 2020 entschieden wie selten zur Rechenschaft gezogen worden. Dass erzwungene Sachlichkeit aber zugleich als juristisches Damoklesschwert über jeder Gesellschaftskritik hängt, die um die Vermittlung ihrer Sache durch den polemisch entfalteten Begriff weiß, verrät etwas von ihrer Verschränkung mit eben der verhärteten Subjektivität, deren Amoklauf sie bremsen soll. Das trüb unter dem Kapital sich reproduzierende Leben darf sich schmeicheln, es sei schon das richtige, als versachlichtes frei von Schuld. Vor Gericht wird sie vielmehr solchen zugesprochen, deren Anwürfe die Reproduktion eines anderen Einzelkapitals behindern. Die Individuen, die verstockt an ihrer sich durch die Ausnutzung anderer vollziehenden Selbsterhaltung haften, können dies Negative nicht Wort haben; regelmäßig gestattet der sie autorisierende Staat, es tatsächlich aus der Öffentlichkeit zu klagen. Der Zwang zur Sachlichkeit ist der zum Positiven; übrigens ist die Jurisprudenz zur Reflexion auf die eigene Verstrickung in Herrschaft von allen Berufsgruppen die unfähigste. Das warenförmig normierte, in dumpfer Selbstverständlichkeit sich vorwärtswälzende Leben ist dann auch stets geneigt, die Unschuldsvermutung, eine juristisch unverzichtbare Kategorie, zur moralischen umzufälschen. Was seine Wahrheit an der Hemmung strafender Staatsgewalt hat, muss zur Glorifizierung enthemmter Subjektivität herhalten; übergriffigen Männern zumal wird ihre juristische Vergeltungskampagne nie so übel genommen wie den Antagonistinnen die Anklage, die den Betrieb stört. Immerzu muss Sachlichkeit ihre Schuld – die von Verdinglichung – abwehren, aber dieser Mangel an Selbstbesinnung zerstört Sachlichkeit. Dass in der bürgerlichen Gesellschaft, mit Grund, nur von Sachen, nicht von Menschen die Rede sein soll, geht gegen die Sache der Menschheit. So verbitten sich sachliche Akademikerinnen und Akademiker das ad hominem, das auf ihre Anpassungsleistungen zielt; das Wort Unterstellung hat meist dieselbe Funktion; pikiert wie die Schuldabwehr bürgerlicher Betriebsamkeit überhaupt ist auch ihre kulturindustrielle Hymne, Fata Morgana von KC Rebell und Xavier Naidoo. Wer diesen, der schon 2009 Baron Totschild als Feind identifiziert hatte, einen Antisemiten nannte, wurde dann auch drastisch, per einstweiliger Verfügung, an die materiellen Bedingungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung erinnert. Regelmäßig verwandelt es sich in das des ökonomisch Stärkeren.
Auch der Vice President müsste zugestehen, dass diese Form der Disziplinierung in den USA nicht weniger virulent ist als in Europa; Trump selber bedient sich ihrer mit Vorliebe, und mit wachsendem Erfolg, weil die Beklagten angesichts seiner rabiaten Cancel Culture mittlerweile auch bei guten juristischen Aussichten nachzugeben geneigt sind. In Deutschland verschwimmt diese innerste, konstitutiv mit der Warenform zusammenhängende Grenze der Meinungsfreiheit indessen trüb mit der äußersten. Bezeichnend, welcher Stellenwert in der Reportage Policing the internet in Germany, die der Rechten als Bestätigung der Münchner Rede gilt, der Beleidigung zukam, während der Geist dieser Strafverfolgung doch ein antifaschistischer sein soll. Die Integration des heroischen Schwurs von Buchenwald in den Reproduktionsprozess des deutschen Kapitals ist dem Kampf gegen das Äußerste, den er meint, nicht gut bekommen. Die Schuld der Deutschen, die sich dadurch perpetuiert, dass sie weiterleben, als wäre nichts gewesen, vom Gewesenen profitieren und noch das Gedenken an es zum Markentitel machen, erscheint in ihrem Gemeinwesen als juristische Absurdität. Was nämlich die These, einer sei Antisemit, vor deutschen Gerichten zu einer so prekären Angelegenheit macht, ist nichts anderes als die Schwere des deutschen Verbrechens selber. Ihretwegen konnten Figuren wie Naidoo oder Jürgen Elsässer ihre Kritikerinnen und Kritiker juristisch belangen; in den Urteilsbegründungen steht das explizit. Die staatlich protegierte Schuldabwehr, das Verblendete der Einzelkapitale und ihrer Reproduktion, verhält sich hier proportional zur deutschen Schuld; der Schrecken des Verbrechens begegnet dem aufgeklärten Denken, das die Wiederholung verunmöglichen möchte, als gefährliches juristisches Hindernis. Indem es die Eindämmung eindämmt, verhilft erzwungene Sachlichkeit in seiner Gestalt dem leerlaufenden Subjektivismus, der pathischen Projektion, schlussendlich jenem Äußersten zum Durchbruch. Das Recht des NS-Nachfolgers diszipliniert den leerlaufenden Subjektivismus, wo er, schuldig primär durch einen Mangel an instrumenteller Vernunft, die Rechtslage nicht kennt, und dient dem smarteren als Waffe. Eher scheidet es innerhalb des faschistischen Potentials die Führungspersönlichkeit von der Gefolgschaft, als seiner Bündelung zur Massenbewegung entgegenzuarbeiten, fungiert gewissermaßen als Schule des Lebens, durch die alle Meinenden hindurchmüssen. Wo deren Freiheit wirklich eingeschränkt wird, im Äußersten, insbesondere die zur Holocaustleugnung, dort gerade behauptet sich quer zum gesellschaftlichen Reproduktions-prozess ein versprengtes Stück aufgeklärten Denkens; hingegen enthält die Verbissenheit, mit der die liberale Defensive unterdessen das Renommee ihres Personals schützt, schon den Kern der Niederlage. Diese abzuwenden steht einzig bei der Reflexion und nicht bei der Verdrängung des Schuldzusammenhangs. Keineswegs hasst Nancy Faeser die Meinungsfreiheit, verteidigt vielmehr ihr Humankapital mit den notwendigen Mitteln; das eben hat sie mit den Enthemmten gemein, die ihr das Gegenteil anhaften möchten. Deren Bezug auf Meinungsfreiheit ist naiv wie die liberale Fassade der Klassengesellschaft, die sie zertrümmern möchten. In Wahrheit ist die leerlaufende, von aller Sachlichkeit gelöste und deshalb selbst verdinglichte Polemik der Rechten beim deutschen Staat gut aufgehoben.
Überhaupt terminiert der unvermittelte Gegensatz von Sachlichkeit und Polemik in Identität. Ungerührt, ohne Beziehung auf ihr Anderes erstarren sie zu Erkennungszeichen konkurrierender Machtgruppen. Denn das Einverständnis der Warengesellschaft, Sachlichkeit bar des verzweifelten Einspruchs, der ihren Anschein in die soziale Wirklichkeit zerren möchte, ist gar nichts anderes als eben der bürgerliche Geist, der gegenwärtig die Hemmungen verliert und alternative Fakten schafft. Wird aber durch den Zauberschlag, mit dem Trump, seiner Sprecherin zufolge, den »fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America« produziert hat, Sachlichkeit etwas von ihrem Trug heimgezahlt, so ist es dieser Scheincharakter, der reizt und provoziert, Herrschaftspraxis real gemildert hat, heute den Unterschied markiert; kaum dürfte Wolodymyr Selenskyj bewusst gewesen sein, wie sehr er sich das White House durch die Bemerkung, Trump lebe in einem desinformation space, zum Feind gemacht hat. Das liberale Herrschaftspersonal ist dasjenige racket, das scheint, als wäre es keins; eben das können ihm die anderen, die zum Gewaltverhältnis zwischen ihnen allesamt authentisch sich bekennen, nie verzeihen. Meinungsfreiheit war nur ein Name dieses Scheins, bemäntelte die Herrschaft der Besitzenden in der Produktionssphäre, die sich später als Cancel Culture bewusstlose Geltung verschaffte, bemäntelt jetzt noch den faschistoiden Umbau der USA, dessen listige Ideologen schon nicht mehr an ihn glauben, sich weder blenden noch hemmen lassen. An der als Argument getarnten Brechstange, die jede Sachlichkeit zerstören und sich das Gebrochene als Material einverleiben möchte, erkennt sich, wen es zum illiberalen Projekt hinzieht; reflexionslos verhärtete Sachlichkeit gebraucht zu ihrer Markierung inzwischen den Terminus Verschwörungsmythen, weil die alte Rede von Verschwörungstheorien noch an den Zusammenhang des Wahns mit bürgerlicher Rationalität gemahnte, den solche Sachlichkeit nicht Wort haben kann, ähnlich wie vor zehn Jahren der Begriff Islamismus noch zu deutlich auf die Religion verwies, aus deren Schoß das Bezeichnete gekrochen war. Schon das war vergebliche liberale Defensive: Sachlichkeit, die nicht recht bei der Sache bleiben wollte, ihre Regression auf Habitus. Verhärtet sich die liberale Defensive aber zu dem Racket, das sie, gehemmt, immer auch gewesen ist, so versündigt sie sich ein letztes Mal an denen, die auch im Liberalismus unten waren. Ihre herrschaftliche Borniertheit wird offenbar im Moment der politischen Niederlage, ihrem Versagen vor den Hemmungslosen, die den Widerspruch leicht ausbeuten und zum Bösen wenden. Es ist die Unfreiheit am Arbeitsplatz, welche die Totalität in sich hineinschlingt, die sie durchzieht: der Triumph der Meinungsfreiheit und ihr Ende. Die Gedanken sind frei, sangen einmal die Bürger, die dem Feudalismus sich entwinden wollten. In ihrer Welt sind die Gedanken indessen nie frei gewesen, sondern gehörten der Monade, die ihren Bewusstseinsinhalt deshalb als Besitz beschlagnahmen und fixieren musste, weil sie selbst es nicht war; ihr bürgerliches Bewusstsein gerade diente dem Staat als Hebel, sie elegant zu regieren. Erst wenn die Quelle des Wahns versiegt, der Zusammenhang mit verstockter Selbsterhaltung durchschnitten, wenn nicht nur die Zensur verschwunden ist, sondern auch das Bedürfnis, den eigenen als Allgemeines durchzusetzen, und die Gedanken nicht mehr der Monade gehören, die eine Meinung haben, nämlich ihre Selbsterhaltung theoretisieren muss, sondern allen und keinem: dann, vielleicht, könnten sie frei sein.