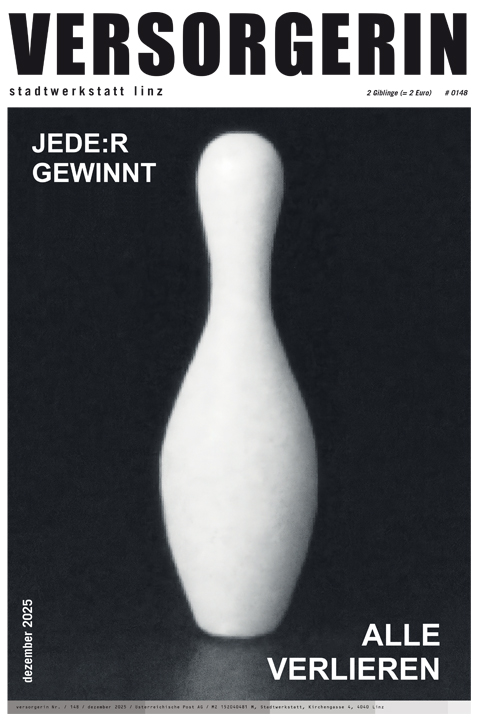Ein Bekannter aus Nürnberg (schöne Grüße an S.P.) hat dereinst vor vielen Jahren – in Anlehnung an das damals gerade erschienene Buch Blödmaschinen von Markus Metz und Georg Seeßlen – die Kontakt-Plattform Facebook geglückt als »Dorfmaschine« charakterisiert. Wie zutreffend dies ist, illustriert Richard Schuberth bereits auf der ersten Seite seines Romans »Der Paketzusteller«: Hauptfigur Gerhild Pfister schreitet über den digitalen Anger, inspiziert die neuen Postings auf den von ihr favorisierten Profilen und dirigiert die sich daraus entspinnenden Kommentarfehden; in Antizipation dessen, dass dort nach ihrem (bereits im ersten Satz als bevorstehend annoncierten) krankheitsbedingten Tod alle Dinge ihren gewohnten Gang gehen würden. In dem von ihr zwischen 2016 und 2018 beaufsichtigten Facebook-Grätzel1 herrscht sie als mitunter wohlwollende Despotin, die lobend und tadelnd ihren virtuellen Salon führt. Die dafür nötige Tagesfreizeit verdankt sie dem Umstand, dass sie – nach einer anfänglich erfolgversprechenden Karriere im Kunstbetrieb, in deren Verlauf die Anzahl von Kuratierungsangeboten und Preisverleihungen aber zunehmend sank, während der Altersabstand zu ihren »Mitbewerberinnen« größer wurde – durch eine Erbschaft davor bewahrt wurde, vom vivre en précarité in eine unglamorösere Armutsvariante abzudriften. Eine ihrer Online-Einkaufstouren bringt sie in Kontakt mit dem eponymen Paketzusteller, der sich als gebürtiger Iraner namens Haydar entpuppt und mit dem sie in Folge eine Liebesbeziehung beginnt. Diese endet durch sein plötzliches (aber nicht ganz unangekündigtes) Verschwinden, woraufhin Gerhild sich daran macht, dessen Hintergründen nachzuspüren und zunächst von einem Mord an Haydar durch dessen halsabschneiderischen Chef ausgeht. Wie von Richard Schuberth zu erwarten, ist das Buch voll scharfsinniger Beobachtungen, kluger Gedanken und kenntnisreichen Ausführungen2 zu diversen gesellschaftspolitischen Themen und Diskussionen (von den Mechanismen psychologischer Kämpfe um Aufmerksamkeit in digitalen Soziotopen bis hin zur Ausbeutung in der Paketlogistik), für die er auch adäquaten sprachlichen Ausdruck findet: Wo andere mit stilistischer Eleganz auf Kriegsfuß stehen oder bestenfalls in Fernbeziehung leben, pflegt Richard Schuberth hier intimeren Umgang.3 Als Essayist, Aphoristiker und Erzähler zeichnet ihn aus, Gedanken und Form durch ihre Verbindung wechselseitig mit Scharfsinn und Witz anzureichern (etwa in schönen Sätzen wie »Was die Gesellschaft für genial erklärt, ist bloß die Luxus-Edition ihrer Mittelmäßigkeit«). Wenn er aber – wie beim Paketzusteller geschehen – die Romanform wählt, brennt dies seinen Charakteren mitunter das Kainsmal auf, bloße Figuren zu sein: Sie artikulieren Innenleben und Gedanken mit der gleichen druckreifen Wortgewandtheit wie die erzählende Außenperspektive. Dadurch tendieren sie zu Folienexistenzen, welche primär dazu da sind, die Formulierkünste des Autors abzubilden. Besonders deutlich bauchreden die Figuren in den – für sich genommen sehr vergnüglichen – Einschüben wie Gerhilds Facebook Diaries oder auch ihrem Mailverkehr mit Magazinen behufs einer Artikelveröffentlichung, deren Witz auch ohne Kenntnis ihrer vermutlichen Vorbilder funktioniert. Kurz gesagt: Wer sich von einem Roman klassisch durchgebildete Charaktere erwartet, deren Leuchtkraft nicht daher stammt, dass sie um den Autor kreisen und davon befremdet ist, dass jemand aus dem Stand rhetorisch versierte Manifeste raushaut, wird vor allem aus der ersten Hälfte weniger Befriedigung ziehen – in der zweiten schwächt sich dieser Eindruck ab, da die Erzählperspektive viel größeren Raum einnimmt. Anders betrachtet ließe sich wiederum argumentieren, dass sich der Autor nicht klüger als seine Figuren macht, wenn sich beider Ausführungen auf demselben Reflexionsniveau befinden. Nachdem der Roman als genuine Erzählform des bürgerlichen Zeitalters in postbürgerlichen Zeiten ohnehin einen Anachronismus darstellt, verhält es sich aber eventuell auch wie bei Beckett, dessen Figuren Adorno als »Stümpfe von Menschen« bezeichnet hat. Diejenigen im Paketzusteller könnten (und hier passt das überstrapazierte Verb tatsächlich) gelesen werden als das, was der digitale Überwachungskapitalismus aus ihnen gemacht hat: High-Performance-Funktionsmarken, die ihre Oberflächen allseits auf eine möglichst präsentable Präsenz poliert haben müssen, deren Triebökonomie darauf ausgerichtet ist, sich narzisstisch im Glanz derer zu bewundern, die sich selbst in ihnen spiegeln wollen, sich dabei permanent selbst kommentieren und letztlich weniger als die Summe ihrer Kommentare ausmachen. Bezeichnenderweise sind die Figuren am berührendsten, wenn sich als Rudimente (bzw. Atavismen) Elemente organischen Lebens einschleichen (Besuche bei der Mutter im Altersheim, Leben mit einer Krebserkrankung). Der Epilog löst schließlich die zu Beginn vergegenwärtigte Situation ein, dass auf Facebook ohne sie alles so weiterlaufen werde wie bisher – allerdings nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Dass die Online-Existenz letztlich einen schalen Abglanz darstellt, drängt sich der Protagonistin gegen Ende beim Betrachten eines Laptops auf:
»All die kleinen Spielzeugmenschen, mit denen sie so gerne gespielt hatte, mochten dort drinnen in dem metallischen Gehäuse weiter ihr beengtes Leben führen, es sprach aber nichts dafür, die Spieldose zu öffnen. Hatte sie sich je für die digitalen Wesen dort interessiert?«
Das Buch
Richard Schuberth: Der Paketzusteller ist im Herbst 2025 als Hardcover bei Drava erschienen.