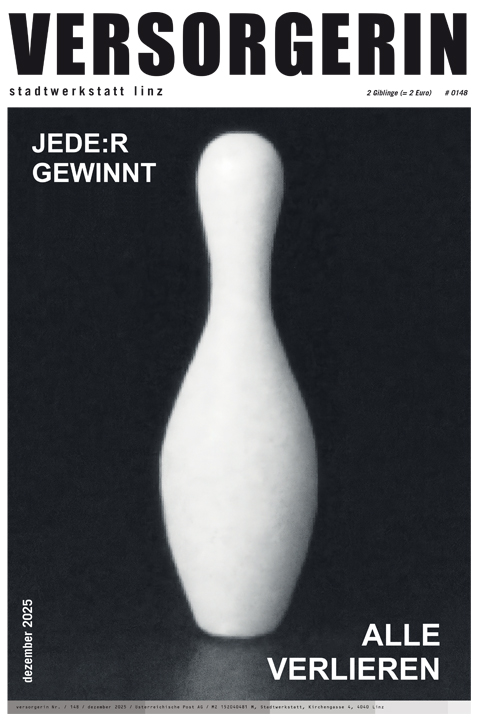Dass »die Frau« keine Stimme habe und in der abendländischen Geschichte diskursiv unsichtbar gemacht worden sei, und dass »das weibliche Subjekt«, von dem niemand so recht weiß, was es überhaupt bezeichnet, zum Verschwinden gebracht werde – solche mit anmaßend kritischem Gestus vorgebrachten Generalurteile waren immer schon Symptome für eine Krise der Frauenbewegung, nicht für ihre Radikalität. Die Hochzeit der Rede vom Verschwinden des weiblichen Subjekts waren die siebziger und achtziger Jahre, als sich das Erkenntnisinteresse feministischer Kritik vom Alltags-, Berufs- und Familienleben der Frauen stärker auf Sprache und Kommunikation als Sphären vorgeblich systematischer Erzeugung geschlechterspezifischer Ungleichheit verlagerte. Die Verlagerung ging theoriegeschichtlich einher mit dem Siegeszug des Poststrukturalismus und der »performativen Wende« in den Sprachwissenschaften. Beide Strömungen betonten den Handlungscharakter von Sprache gegenüber ihrer Repräsentationsfunktion, interessierten sich eher für das, was Sprache »tut«, als für das, was sie darstellt, und neigten dazu, die Überzeugung von der Erkenntnisfunktion von Sprache als (abendländischen, patriarchalischen, weißen) »Logozentrismus« unter Verdacht zu stellen. Aus solcher Hermeneutik des Verdachts entsprang vor allem bei französischen Feministinnen wie Hélène Cixous (»Das Lachen der Medusa«, 1975) und Luce Irigaray (»Speculum – Spiegel des anderen Geschlechts«, 1980) die Annahme einer konstitutiven Ausschließung aus der Sprache, die »die Frau« als dasjenige, was sich logozentrischer Zurichtung entziehe, aus dem Universum sprachlichen Austauschs tilge. Ja, diese Tilgung konstituiere die Sprache, wie wir sie kennen, überhaupt erst als immanenten Sinnzusammenhang.
Die Psychoanalytikerin und Literaturwissenschaftlerin Julia Kristeva, die zu Unrecht oft mit Cixous und Irigaray in einem Atemzug genannt wird, zeigte in ihrer 1974 veröffentlichten Studie »Die Revolution der poetischen Sprache«, dass sich dem Gedanken einer Ausschließung des Weiblichen als negativem Gründungsakt des Sprachvermögens durchaus etwas abgewinnen lässt, sofern er nicht unzulässig verallgemeinert oder biologistisch reduziert wird. Kristeva bestimmt das von ihr so genannte Semiotische, das der symbolischen Ordnung (dem sprachlichen Komplement der Gesellschaft) gegenübersteht, als Ensemble jener Aspekte der Sprachentwicklung des Kindes, die Sprache als Symbolisierungs- und Artikulationssystem mit dem Leib verbinden, dessen erfahrungsgeschichtlich erste Form der Leib der Mutter ist, an dem das Ungeborene und der Säugling somatisch teilhaben. Wie sich im Prozess der Individuation der Körper des Kindes vom anfangs mit ihm verbundenen Körper der Mutter lösen muss, damit Mutter und Kind als individuelle Wesen fortleben können, so muss sich der Sprachleib durch Identifikation mit der symbolischen Ordnung von den Impulsen des Semiotischen, die ihn mit dem Mutterleib verbinden, absetzen, ohne sich gegen sie zu verschließen. Der Ort, an dem die Dialektik zwischen Symbolischem und Semiotischem ausgetragen wird, ist für Kristeva die poetische Sprache. Insofern alle Poesie sich an dieser Dialektik abarbeitet, kann das im mütterlichen Leib repräsentierte Weibliche ebenso in der écriture männlicher Autoren (wie Charles Baudelaire oder Stéphane Mallarmé) zum Ausdruck kommen, wie es im Schreiben weiblicher Autoren durch Überidentifikation mit der symbolischen Ordnung zurückgedrängt und neutralisiert werden kann. »Weibliches Schreiben« (ein beliebter Topos jener Zeit) bezeichnet für Kristeva keine literarische Selbstvergewisserung von Frauen, keine weibliche Selbsterfahrungsliteratur, sondern Schreibweisen, die im Semiotischen aufbewahrte frühkindliche Impulse sprachlich artikulier- und entzifferbar machen.
Die Diskussionen über den Ausschluss »des Weiblichen« aus der symbolischen Ordnung und über die Möglichkeit »weiblichen Schreibens« zeugen trotz ihrer Vielfalt allesamt davon, wie stark die feministische Theoriebildung jener Jahre sich von der empirischen Lebenswirklichkeit der Frauen entfernt hatte. Sie entwarfen elitär-akademistische Gegenmodelle zu dem auf Empirie gerichteten Erkenntnisinteresse, das ebenfalls seit Ende der siebziger Jahre feministische Historikerinnen formulierten. Anders als die französischen Poststrukturalistinnen ließen sich Karin Hausen, Silvia Bovenschen, Barbara Duden, Ute Frevert, Karin Walser, Claudia Honegger und ihre Mitstreiterinnen keiner gemeinsamen theoretischen Schule zuordnen, verfolgten aber alle, ohne sich abgestimmt zu haben, ähnliche Ziele. Eine Gegenbewegung zum Poststrukturalismus bildeten sie insofern, als es ihnen darum ging, aufzuweisen, dass »die Frau« und »das Weibliche« im historischen Prozess keineswegs verschwunden oder ausgelöscht worden sind, sondern ihre Präsenz sich im Gegenteil in zahllosen Dokumenten und Realien, Archiven und Praktiken des Alltags niedergeschlagen hat, ohne jedoch in gleicher Weise erschlossen worden zu sein wie die die Sozial-, Geistes- und Alltagshistoriographie bestimmende »Männergeschichte«.
Die Historikerinnen erlagen nicht der Versuchung, die »Frauenge-schichte«, die zu rekonstruieren sie antraten, als Geschichte des Anderen der repressiven Vernunft oder als Gegengeschichte zur »patriarchalischen« Historiographie zu substanzialisieren. Vielmehr war ihnen bewusst, dass die Geschichte von Unfreiheit und Unmündigkeit mit der Individuationsgeschichte der Einzelnen derart verwoben ist, dass sie auf jeweils spezifische Weise die individuelle Entwicklung von Frauen wie Männern aus verschiedensten Milieus, mit unterschiedlichen Begabungen, Interessen und Erfahrungen betrifft. Die Gegenstände, denen die Historikerinnen sich immer wieder widmeten, fungierten als Prismen solcher Erkenntnis. Leitmotivisch durchzieht ihre Arbeiten die Frage nach der Genese der Frauenheilkunde und Gynäkologie, insbesondere danach, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen diese Tätigkeiten, die zu den frühesten Formen weiblicher Arbeit gehören, im 19. Jahrhundert in den meisten westlichen Staaten zu von Männern ausgeübten Berufen geworden sind. Bovenschen zeigte in ihrem Essay »Die aktuelle Hexe, die historische Hexe und der Hexenmythos«, der 1977 in dem Band »Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des Hexenbildes« erschien, wie an der Beschäftigung mit dem Körper der Frau gewonnene Fähigkeiten der Naturerkenntnis im Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit als Hexerei, Zauberei und Besessenheit denunziert und der aufkommenden instrumentellen Rationalität als archaisch entgegengesetzt wurden. So wurden, wie Bovenschen schreibt, die Frauen aufgrund der von ihnen erworbenen medizinischen Fertigkeiten, deren Vernunftaspekt nicht mehr erkannt und auch nicht anerkannt wurde, von »Subjekten der Naturaneignung« zu »Objekten der Naturbeherrschung«.
Die massenhafte Ermordung von Frauen als »Hexen« erklärt Bovenschen damit, dass die im Absinken begriffenen Formen klerikaler Herrschaft und ihr Konterpart, die frühbürgerliche Aufklärung, in der Frau als »Hexe« einen gemeinsamen Sündenbock zwecks Sistierung sozioökonomischer Konflikte gefunden hatten. Auch Barbara Duden in ihrer 1987 erschienenen Studie »Geschichte unter der Haut« und Claudia Honegger in »Die Ordnung der Geschlechter« (1991) erzählen die Geschichte der neuzeitlichen Medizin, insbesondere der Gynäkologie, als Geschichte der Halbierung von Aufklärung und Vernunft zum Schaden der Frauen. Halbierung wohlgemerkt, nicht Zerstörung: Duden rekonstruiert in ihrer Lektüre der Tagebücher und Krankenakten, die der Eisenacher Arzt Johann Storch um 1730 über Leibeskrankheiten, Schwangerschaften und »Weiberklagen« seiner Patientinnen geführt hat, wie damalige Vorstellungen vom Körper-inneren, von den Unterschieden weiblicher und männlicher Anatomie sowie von der Bedeutung von Schmerzen das Selbstverhältnis der Frauen zum eigenen Körper beeinflussten, an dem sie zugleich gebildet worden waren. Honegger wiederum zeigt, wie zwischen der Mitte des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts die Genese der Gynäkologie als exklusiv dem weiblichen Körper gewidmeter Männerberuf durch geschlechtertypologische und physiologische Vorstellungen vom »Weib« als Grenzform des »Menschen« in den Humanwissenschaften sekundiert wurde.
Weder Bovenschen noch Duden und Honegger unterschlagen, dass die von ihnen rekonstruierte Entwicklung Fortschritte einleitete, die es ohne sie nicht gegeben hätte. Wäre die neuzeitliche Medizin nicht aus ihrer Vorgeschichte in der Naturheilkunde herausgetreten, hätten die von den als »Hexen« verfolgten Frauen behandelten Krankheiten niemals auf ihre Ursachen hin analysiert oder gar aus der Welt geschafft werden können. Auch die Vorstellungen von Beginn, Dauer und Ende einer Schwangerschaft sowie von der inneren Beschaffenheit des weiblichen Körpers, nach denen sich Storch beim Umgang mit seinen Patientinnen richtete, waren gegenüber den diagnostischen und anästhetischen Möglichkeiten der modernen Gynäkologie defizitär: ungenau, begriffsschwach und teilweise gefährlich für die werdende Mutter wie für das Ungeborene. Selbst der von Honegger rekonstruierte wissenschaftshistorische Prozess, in dem die Frau zu »dem Weib« als epistemologischem Gegenstand einer personell männlichen Medizin wurde, war nicht nur ein Rückschritt, sondern hat mit der Sexualwissenschaft, Sozialpsychologie und nicht zuletzt mit der Psychoanalyse Institutionen und Denkformen hervorgebracht, mit denen er kritisiert werden konnte. Dieses fortschrittliche Moment zu konzedieren, beantwortet allerdings nicht die Frage, weshalb die Geschichte der modernen Medizin die Hexenverfolgungen hervorgebracht hat; weshalb die Geschichte der modernen Gynäkologie die von Duden ausführlich untersuchte »erste Regung« – die erste für die Frau spürbare Bewegung des Ungeborenen im Mutterleib – als Index der Schwangerschaft gegenüber diagnostischen Verfahren entwertete, die das Faktum der Schwangerschaft von der Körpererfahrung der Frau entkoppelten; und weshalb die Verwissenschaftlichung der Gynäkologie von geschlechtertheoretischen Konzepten begleitet wurde, die »das Weib« als Grenzfall des Menschen beschrieben.
Indem sie solche irrationalen Elemente von Fortschritt, Aufklärung und Vernunft in den Blick nahmen, machten die Historikerinnen dem Begriff des Fortschritts selber im Sinne einer Dialektik der Aufklärung die Rechnung auf, ohne ihn preiszugeben. Darin ähnelten Duden, Honegger und Bovenschen Karin Hausen, Ute Frevert, Karin Walser und anderen Vertreterinnen einer Sozial-, Mentalitäts- und Gefühlsgeschichte, die die Begriffe ihrer eigenen Disziplin durch das Brennglas der »Frauenge-schichte« in Frage stellten und schärften: Walser, indem sie an der Geschichte des Dienstmädchenberufs die Frage stellte, weshalb die Erwerbstätigkeit alleinstehender Frauen sich mit Anbruch der Moderne ausgerechnet auf einem Gebiet entfalten konnte, das objektiv ein feudales Relikt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft war; Hausen, indem sie die von ihr so genannte »Polarisierung der Geschlechtscharaktere« in einen aktiven, sachlichen, außenorientierten männlichen und in einen empathischen, introspektiven, fürsorglichen weiblichen Typus auf die Dissoziation des »ganzen Hauses« und die Transformation des Haushalts in eine außererwerbliche Privatsphäre zurückführte; Frevert schließlich, indem sie die Geschichte bürgerlicher Gefühle wie Ehre, Anstand und Vertrauen anhand der De- und Rekonfiguration des bürgerlichen Geschlechtscharakters rekonstruierte.
Lohnend ist die Lektüre dieser Autorinnen, weil sie zum Ausgangspunkt nehmen, was fast jede Auseinandersetzung mit dem Feminismus heute vergessen zu haben scheint: die Tatsache, dass der Eintritt der Frauen in die Geschichte schon lange stattgefunden hat. Dass das vielberufene »feministische Subjekt« selbst bereits eine Geschichte hat, die angenommen und reflektiert werden muss, um es zur Geltung zu bringen: Dies jedoch verleugnet nicht nur der Queerfeminismus, wenn er das Geschlecht zum Resultat einer voluntaristischen Wahl erklärt. Es wird auch durch die immer lauteren (und immer häufiger weiblichen) Apologeten eines selbst längst historischen Geschlechterkonservatismus verleugnet, wenn sie behaupten, die Emanzipation der Frau sei wenigstens in westlichen Gesellschaften beendet, weshalb der Feminismus hierzulande keine Daseinsberechtigung mehr habe.
Beide Seiten könnten, wenn sie belehrbar wären, an den Schriften der Historikerinnen lernen, dass es eine Zeit gab, in der die Frauen- und Geschlechterforschung Gegenstände aufzuschließen half, die den akademischen Disziplinen bis dato nicht zugänglich waren.