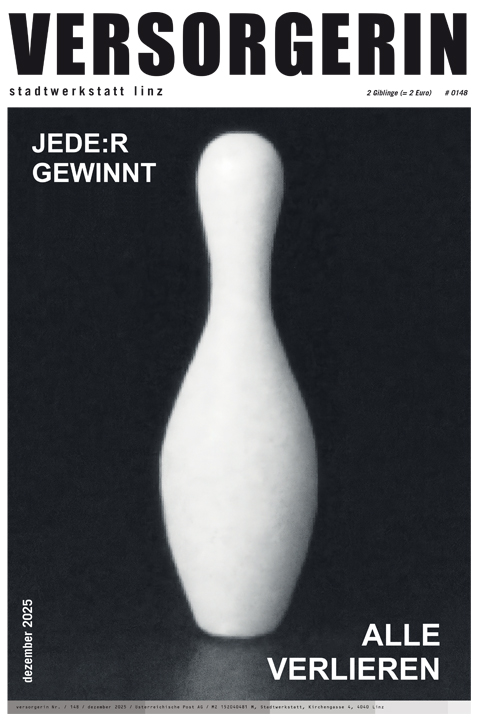Zwei auf genau analoge Weise beinahe hervorragende Horrorfilme sind 2025 in den Kinos gewesen. Sie verblieben bloß beinahe hervorragend aus dem gleichen, blöden, vermeidbaren, dabei hoch instruktiven Grund. Es geht erstens um »Sinners« (bei uns »Blood & Sinners«), ein auf Michael
B. Jordan zugeschnittenes Projekt von Ryan Coogler, und zweitens um »Weapons« von Zach Cregger mit Julia Garner und Josh Brolin in den Hauptrollen. Beide Filme haben das Potential, für ihr jeweiliges Subgenre stilbildend zu werden, denn beide bringen mit ihrer jeweiligen Formen-sprache die Schrecken eines je distinkten sozialen Verhältnisses der Vergangenheit (der USA) klar auf einen (der USA) sehr gegenwärtigen Punkt.
Im Fall von »Sinners« betrachten wir, durch die Linse eines Gangster- und Vampirfilms ungefähr im Format von »From Dusk Till Dawn« (R. Rodriguez 1996), das moralische und kulturelle Universum von share croppers im Mississippi der 1930er-Jahre. Will sagen, »Sinners« benutzt die gleiche Struktur wie Rodriguez‘ hohl-cooler Actionfilm damals, bei der ein Gangsterfilm sich ca. auf halber Strecke unangekündigt in ein Vampir-Vehikel verwandelt – hat aber, im Gegensatz zu »From Dusk Till Dawn«, tatsächlich etwas zu sagen.
»Weapons« dagegen ist die nonlineare, (nicht genau, aber ungefähr) nach Rashomon-Art dekonstruierte Version des Märchens von der Kinder fressenden Hexe im Setting einer zeitlosen amerikanischen Suburb – »zeitlos«, weil: es gibt heutige Autos, aber scheint‘s keine Mobiltelefone, die Fassaden sind heutig, die Interieurs nicht genau zuordenbar, usw. Alle möglichen »unschuldigen« architektonischen Elemente in »Weapons« weisen auf die sozialen Horizonte weißer Mittelstands-Abstiegsangst: Autoabhängigkeit; die Isolation in den Einfamilienhäusern, zwischen denen es keinen öffentlichen Raum mehr gibt …
Beide Filme greifen also auf alte Volkssagen und Erzähltraditionen zurück. In »Sinners« ist es direkt Teil der Handlung, dass der Protagonist, der Bluesman Sammie »Preacher Boy« Moore, Erbe einer zauberischen Erzähl- und Musiktradition sei, die in vorgeschichtliche Zeit zurückreiche. »Weapons« unterlässt solche Selbstreflexe innerhalb des Narrativs und bildet sie schlicht ab, die Hexe, die am Ende von ihren Opfern gefressen und/oder zerrissen wird (so, wie Grimms Hänsel und Gretel ihre Hexe in den Ofen schieben). Beide Erzählungen funktionieren also innerhalb ihrer Genres, und beide schreiben diese Filmgenres in ältere, nichtfilmische Kulturzusammenhänge ein.
»Weapons« hat Mut zum ausgesprochen weirden Detail, das sich nicht zwingend aus der Grammatik des restlichen Films ableitet – wo beispielsweise Josh Brolins Figur, der Vater von einem der Kinder, mit deren Verschwinden die Handlung einsetzt, im Traum über dem Haus der Hexe ein Maschinengewehr hängen sieht, aus Wolken geformt – und es gibt aber im ganzen restlichen Film sonst keine so eindeutige Anspielung an die häufigen mass shootings in US-Schulen, keine weitere Einladung, das vorliegende Märchen mit jener Wirklichkeit in Eins zu denken. Das Gewehr hängt da und verweist, worauf es offenkundig verweist, aber das erschließt sich nur dem Publikum. Dem Träumer in der Story muss es unerschließbar bleiben – unverständliches Zauberwerk! »Weapons« lebt dabei vom komischen Element. Dargestellt werden sämtlich traurige und traumatische Szenen, aber dies stets nach Gesetzen des komödiantischen Timings, und freilich ohne Zwang zur »lustigen« Pointe. Das sagt uns: so indifferent die Vorstadtlandschaft gegen das Leid der Menschen ist, so indifferent spult sich ihr eigenes Verhalten zueinander ab, just so, als gäbe es noch etwas zu lachen.
»Sinners« ist weit weniger komplex: Vermittels eines stilsicheren Actionfilms wird von minoritären Identitäten gehandelt, vom legitimen vs. illegitimen Behaupten eigener Herkünfte. Konkret heißt das, in der Fiktion des Films ist Musik, speziell der Blues, magisch, und die line of tradition transzendiert zeitliche Verortung: am Höhepunkt der Handlung spielt der »Preacher Boy« den Blues, und den Juke Joint bevölkern, mit seinen regulären Gästen, Figuren schwarzer Musik aus Vergangenheit und Zukunft. Der Jam inkludiert alles mögliche vom afrikanischen Zauberpriester bis zum Hip-Hop-DJ … Es ist diese Magie, die dann den Obervampir und seine Armee auf das Wirtshaus in der Randlage aufmerksam machen, wo die sprichwörtliche Musik spielt; denn der Vampir, der offenbar zu Lebzeiten auch so ein Musikerpriester war, verortet in der Tradition von irish folk, hat, als Untoter, seinen magischen Draht zu seinen Ahnen verloren und will ihn sich hier zurückholen … Wir verstehen deutlich: da steht die Musikindustrie, gefügt aus den toten Resten einst lebendiger, gesellschaftlich dissidenter Musiken, vor der Tür des Beisls, und will verständlicherweise das Schöne, Lebendige fressen, was es freilich in einen weiteren solchen Rest zu verwandeln droht.
Soviel zu den Inhalten der beiden Filme. Sie machen beide, wie gesagt, den gleichen Fehler, und sie machen ihn an der funktional analogen Stelle in ihrem Gefüge. Denn irgendwann kommt hier wie dort der Moment, wo sich uns, vermittels der Formensprache des jeweiligen Subgenres, klar und deutlich zeigt, was da eigentlich los ist in der jeweiligen Fiktion, da ja nun offenbar nicht die Regeln der wirklichen Wirklichkeit gelten, die wir, das Publikum, bewohnen. Solche Enthüllung ist, als Orientierungshilfe, für die meisten irgendwie fantastischen Filme unumgänglich, aber sie braucht nicht viel. Idealerweise bemerken wir sie beim Zusehen nicht: ein Blick, eine Überblendung, ein anhaltender Sound, und schon ist der entscheidende Zusammenhang zwischen dieser und jener Figur, Lokalität, Idee etabliert.
In »Sinners« nun, da die Party mit dem Zaubersänger rauscht, und da er (a) zaubert und sich damit (b) dem hungrigen Vampir ein paar Dörfer weiter aus der Ferne sichtbar macht, wird uns das zwar, wie gesagt, in Bild und Schnitt hübsch klar vermittelt – aber dann kommt so ein Voiceover aus dem Nichts, keiner Figur oder Perspektive in der Diegese zuzuordnen, und erklärt den Sachverhalt nochmal extra in einem Naturdokumentations-Vokabular, das selbst jene minimalsten Ambivalenzen ausmerzt, die auf der Bildebene eben noch wirksam und spannend waren. Aus dem wundersamen, und wundersamerweise plötzlich auch (durch den Vampir) angreifbaren Ahnenzauber der Musik macht das Geplapper eine technisch beschreibbare Telefonvorrichtung zwischen Zeitaltern. Transzendenz ist sistiert, und ihr Gehalt wird per Richtspruch ex machina der Immanenz zugeschlagen.
Ganz analog dazu ganz zum Schluss von »Weapons«. Die Kinder haben die Hexe – was? – gegessen? – »nur« in Notwehr erschlagen? … Das Kind, dessen Eltern von der Hexe in Geiselhaft genommen wurden, damit es seine Klassenkameraden ans Messer liefert, hat zaubern gelernt und den Tag gerettet. Was ist jetzt mit ihm, mit seinen Eltern? Was mit den vielen suburbanites, über deren Häuser und Rasenflächen hin sich dieser letzte Todeskampf der Hexe, als öffentlicher Akt des Kannibalismus einer Schar Halbwüchsiger an einer alten Frau abgespielt hat? War das jetzt der erlösende Moment, ding dong, the witch is dead, und sie lebten alle glücklich bis an ihr Ende? Weist ihr Trauma die Erwachsenen auf die Notwendigkeit, in Zukunft anders miteinander umzugehen, als die suburbs es ihnen bisher aufprägten? Ist die kannibalische Zauberei eigentlich besiegt, wenn es doch durch Magie war, dass die Hexe besiegt werden konnte? … Ein Voiceover pappt sich über die letzte Einstellung und beraubt uns der Notwendigkeit, solche und ähnliche Fragen selbst zu stellen; beraubt uns entsprechend auch der Möglichkeit, sie auf reale, vergleichbare Fälle von Schrecken und Überwältigung (s. o., Amoklauf) umzulegen. Geplapper kaschiert die soziale Dimension, das Verzahntsein der einzelnen Leben, wie wir es doch gerade einen Film lang vorgeführt bekommen hatten, und ersetzt Einfühlung durch ein statistisch-sadistisches Aufzählen individueller Beschädigungen. So erschöpft sich das Märchen in der schauerlichen Begebenheit und öffnet nicht den Blick auf die Schrecken der wirklichen Verhältnisse, die das ganze Zaubergeschehen überhaupt erst bedingen, also das Eingebunkertsein der Leute in ihren Häuschen, getrennt durch ihre Autos und Vorgärten …
Im Fall von »Weapons« schwirrt die Anekdote durchs Netz, es sei dieses Voiceover das Resultat von einem test screening gewesen, wo das Testpublikum am Ende Verwirrung, Ambiguität ausgedrückt hätte. Für »Sinners« mag Ähnliches gelten oder nicht: beide Male drückt das Voiceover ein Misstrauen der Filmemacher gegen ihr Publikum aus, und darüber hinaus ihre Unfähigkeit, wahrzunehmen, worin die Stärken ihrer eigenen Elaborate bestehen (könnten). Wenn wir die wirksamen Kräfte einer Welt als fixfertig durchschaute Mechanik vorausgesetzt bekommen, dann sehen wir, statt denkenden Leuten, bloßen Aufzieh-spielzeugen zu, die blind und mechanisch ihre Tänze aufführen. Genau das Erklären in Worten verhindert, paradoxerweise, dass sich dem Publikum die soziale Welt als beeinflussbar, als Schauplatz von echten Entscheidungen, erschließt.
Dass so ganz Ähnliches zweimal in so kurzer Folge passiert – und gerade in zwei so substantiellen, innovativen, ansonsten so viel nuancierteren Filmen –, das legt nahe, in solcher Ambiguitätsintoleranz einen allgemeinen Trend zu vermuten. Geht es nur um einen allgemeinen Wandel der media literacy – keine Notwendigkeit mehr, je noch zu lernen, dass und wie sich die Codierung von Information in (Film-)Bildern über die Jahrzehnte verändert? Sodass ein Studio, da es geldwerte Wetten auf die Lesbarkeit eines Films abschließt, auf Nummer Sicher geht? Oder hat sich die Theorie, die die Macher*innen selbst von ihren Werken haben, geändert – davon, was die Funktion eines solchen z. B. Films wäre?
Welchem veränderten Selbstbild von Autor*in und Rezipient*in entspräche das dann je? (… eine Frage, die wir nicht mit dem Voiceover einer Antwort zukleistern wollen …)